|
|
|
|
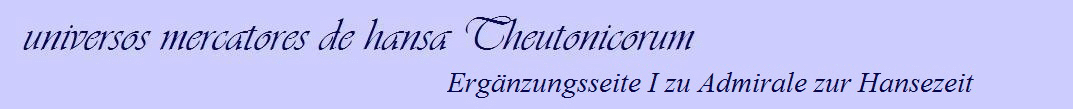 |
 |
 |
 |
 |
|
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie dem zu. Weitere Infos zu Cookies und deren Deaktivierung finden Sie hier
|
|
|
Titelregister zu:
|
|
|
|
Simon von Utrecht
Simon von Utrecht, auch Simon van Utrecht, (* 14. Jahrhundert in den Niederlanden; † 14. Oktober 1437) war ein Hamburger Schiffshauptmann im Mittelalter. Unter seinem Kommando wurde der Seeräuber Klaus Störtebeker gefangen genommen. Er war der bislang einzige Hamburger Ehrenbürgermeister.
Leben
Simon (von Utrecht) stammte vermutlich aus Utrecht in den Niederlanden und war bereits vor 1400 in Hamburg eingewandert, denn im Jahre 1400 erhielt er das Bürgerrecht.
Am 22. April 1401 stellte er mit einer von ihm kommandierten hamburgischen Flotte vor Helgoland den Seeräuber Klaus Störtebecker und dessen Vitalienbrüder, die er in der Seeschlacht nach erbittertem Kampf gefangen nehmen und auf dem von Herman Nyenkerken befehligten Schiff „Bunte Kuh“ nach Hamburg bringen konnte, wo ihnen der Prozess gemacht wurde. Angeblich soll dieser Erfolg erst durch die Hilfe eines Verräters ermöglicht worden sein, der unbemerkt flüssiges Blei in die Steueranlage goss und damit Störtebekers Schiff manövrierunfähig machte – alternativ wird dies mit der Zerstörung des Hauptmastes durch Geschosse der „Bunten Kuh“ erklärt.[1]
1425 wurde Simon von Utrecht in den Rat der Stadt Hamburg gewählt. 1428 nahm er am Seezug der Hanse gegen die Dänischen Inseln und Felsburg teil. In den Jahren 1432 bis 1433 befehligte er die Hamburger Flotte gegen Piraten in der Nordsee. Er schlug die Strandfriesen zur See, zwischen der Weser und Ems, und danach auch auf dem Festland. Er zerstörte ihr Hauptquartier, die Sebaldusburg, und nahm nach weiteren Siegen bei Norden und Lütetsburg die Hauptstadt Emden ein.
Für seine Verdienste wurde er 1433 zum einzigen Hamburger Ehrenbürgermeister ernannt. Es ist überliefert, dass Simon von Utrecht in seinen späteren Jahren am Rödingsmarkt wohnte.
Nachleben
Grabstätte
Er starb am 14. Oktober 1437 und wurde in der ehemaligen Hamburger St. Nikolai-Kirche bestattet.
Im Jahre 1566 wollte die St. Nicolai-Kirchenbehörde sein Grab verkaufen, da es keine gesicherten Nachkommen von Utrechts gab. Das Grab wurde an Hinrich Rheder verkauft. Dieser Handel wurde aber vom Hamburger Senat wieder aufgehoben, da man sich noch an die Dienste Utrechts erinnerte.
Fast hundert Jahre später, im Jahre 1661, wurde das Grab dann an Jürgen Kellinghusen, den damaligen Jurat der Kirche, für 150 Mark unter der Bedingung verkauft, dass er von dem Kauf zurücktreten müsse, sobald jemand Einspruch erheben sollte.
Ehrungen
Simon von Utrecht ist Namenspatron einiger Brücken und Straßen in Hamburg-St. Pauli und einer Straße im Rostocker Hafen.
An der 1897 eingeweihten Kersten-Miles-Brücke in Hamburg-Neustadt wurde Simon von Utrecht mit einem Denkmal ♁53° 32′ 51″ N, 9° 58′ 17″ O geehrt, als eine von vier an den Brückensockeln errichteten Statuen von früheren Hamburger Persönlichkeiten. Dieses Denkmal wurde 1985 durch Vandalismus beschädigt, indem Utrechts Kopf abgeschlagen wurde.[2]
Literatur
- Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind. Von Seeraub und Konvoifahrt. Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg 2001, ISBN 3-9805772-5-2.
- Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-593-34525-0.
- Hermann Joachim: Utrecht, Simon van. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 39, Duncker & Humblot, Leipzig 1895, S. 416–418.
Einzelnachweise
- ↑ Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind. Von Seeraub und Konvoifahrt. Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg 2001, ISBN 3-9805772-5-2, S. 28.
- ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-593-34525-0; S. 176 ff.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 17.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Jürgen Wullenwever
Jürgen Wullenwever (* spätestens 1488 in Hamburg; † 24. September 1537 in Wolfenbüttel) war von 1533 bis 1535 Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.
Leben
Wullenwever stammte aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Seine Mutter starb im Jahr seiner Geburt. Sein Bruder Joachim war als Ratsherr in Hamburg bei der dortigen Einführung der Reformation beteiligt. 1525 kam Jürgen Wullenwever als mäßig erfolgreicher Kaufmann nach Lübeck und heiratete die Lübeckerin Elisabeth Peyne. Er wohnte im Haus ihres Bruders in der Königstraße 27.
Politischer Aufstieg
In den 1520er Jahren kam es in Lübeck im Zuge der Reformation immer wieder zu Unruhen. Immer mehr Bürger kamen in Kontakt mit Martin Luthers Lehre, während der Rat mit aller Macht die Ausbreitung der neuen Religion zu verhindern suchte. Als der Rat unter anderem wegen der dem gesamten Reich auferlegten Türkensteuer Steuererhöhungen verlangte, wählten die Bürger einen Bürgerausschuss, der je zur Hälfte aus Handwerksmeistern und Kaufleuten bestand, und forderten als Gegenleistung mehr Mitspracherecht und evangelische Prediger. Wullenwever hatte sich damals offenbar bereits einen Namen als Lutheraner und vor allem als guter Redner gemacht. Deshalb wurde er 1530 in den Ausschuss der 64 gewählt, obwohl er weder ein Grundstück in der Stadt noch Bürgerrecht besaß. Er stieg schnell zum Wortführer des Ausschusses auf. Im selben Jahr mussten sich die Ratsherren dem Druck der Gemeinde beugen. Die Einführung der Reformation wurde beschlossen. Johannes Bugenhagen arbeitete eine Kirchenordnung aus, die am 27. Mai 1531 in Kraft treten sollte. Über den Ausschuss und neugeschaffene Ämter wie die Kirchenältesten erhielten die Bürger mehr Einfluss. Die Stadt beschloss, sich dem Schmalkaldischen Bund anzuschließen.
Aus Protest dagegen verließen Ostersonnabend, den 8. April, 1531 zwei der vier Bürgermeister, Nikolaus Brömse und Hermann Plönnies, heimlich die Stadt und begaben sich an den Hof Kaiser Karl V., um dessen Hilfe gegen die reformatorischen Kräfte zu suchen. Die Bürger fürchteten nun um ihre Sicherheit. Einige wollten den Rat auflösen, doch Wullenwever empfahl mit Verweis auf ein angebliches Mandat des Stadtgründers Heinrich des Löwen, ihn durch ratsfähige Mitglieder des Bürgerausschusses zu ergänzen. Er ließ neun Namen auf Zettel schreiben, von denen Mattheus Packebusch, der älteste der verbliebenen Bürgermeister, sieben ziehen musste. Obwohl Wullenwevers Name vermutlich auf einem der Lose gestanden hat, wurde er zur großen Enttäuschung der gesamten Bevölkerung nicht gewählt. Er gelangte erst bei einer weiteren Neuwahl am 21. Februar 1533 in den Rat und wurde kurz darauf erster Bürgermeister.
Kampf um Lübecks wirtschaftliche Vormachtstellung
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war die Monopolstellung der Hanse in Nordsee und Ostsee gefährdet. Während in den früheren Jahrhunderten aller Warentransfer von Ost nach West und umgekehrt über den Landweg zwischen Hamburg und Lübeck gegangen war und vor allem Lübeck durch das Stapelrecht, Zölle und Umschlaggebühren zu erheblichem Reichtum gelangt war, segelten nun die nicht zur Hanse gehörigen Niederländer nördlich um Dänemark herum, um direkt mit den Dänen sowie den östlichen Ostseeanrainern zu handeln. Auch war Dänemark, bisher mit Verträgen an alleinigen Handel mit Hansekaufleuten gebunden, nicht mehr bereit, sich weiterhin diesem Diktat zu unterwerfen. Lübecks Kaufleute sahen ihre Vormachtstellung und Wohlstand gefährdet. Als 1532 der dänische König Friedrich I. Lübeck um Hilfe bat gegen die Rückeroberungsversuche des abgesetzten Christian II., erhob Wullenwever als Lübecker Gesandter die Forderung, dass die Dänen als Gegenleistung den Holländern die Durchfahrt durch den Sund verwehrten. Der daraufhin geschlossene Vertrag wurde jedoch von dänischer Seite trotz der erfolgreichen Kriegshilfe nicht eingehalten.
Unter Wullenwevers Ägide begann Lübeck 1533 das Problem selbst in die Hand zu nehmen und die Niederländer durch Kaperfahrten aus der Ostsee zu vertreiben. Zur Finanzierung ließ Wullenwever konfiszierte Kirchenschätze einschmelzen. Obwohl auf diese Weise für Monate jeglicher Handel lahmgelegt war, scheiterte das Vorhaben an der mangelnden Unterstützung der Nachbarstädte. In Lübeck, das durch die doppelte Belastung, bei fehlenden Handelseinnahmen Schiffe stellen zu müssen, am meisten unter dem erfolglosen Kaperkrieg litt, wuchs die Kritik an Wullenwevers Außenpolitik. Durch Vermittlung des Hamburger Rats, dem auch Wullenwevers Bruder Joachim angehörte, kam es im März 1534 unter Mitwirkung kaiserlicher Gesandter und Abgeordneter anderer Hansestädte zu Friedensverhandlungen zwischen Lübeck und den Niederlanden in Hamburg. Als Hinrich Brömse, der Bruder des entwichenen Bürgermeisters Nikolaus Brömse, im Namen des Kaisers die Wiederherstellung der alten Ordnung in Lübeck forderte, verließ Wullenwever vorzeitig die Versammlung.
In Lübeck brachte Wullenwever die über sein eigenmächtiges Handeln empörte Gemeinde durch feurige Reden wieder auf seine Seite. Um weitere Opposition im Keime zu ersticken, verbot er Versammlungen ohne Zustimmung des Ausschusses. Die kritischen Stimmen im Rat schaltete er mit einem Verweis auf das Mandat Heinrichs des Löwen aus, nach dem jeweils ein Drittel der 24 Ratsherren für ein Jahr ausscheiden müsse. Auf diese Weise gelang es ihm, dass im Rat fast nur seine Anhänger saßen.
Grafenfehde
Im April 1534, als ein Jahr nach dem Tod des Königs Friedrich I. die Thronfolge in Dänemark noch ungeklärt war, bat Christoph von Oldenburg um Hilfe zur Befreiung seines Vetters, des abgesetzten dänischen Königs Christian II. Ausschuss, Rat und Gemeinde stimmten geschlossen für den Eintritt Lübecks in den dänischen Erbfolgekrieg, die sogenannte Grafenfehde. Die Lübecker sahen darin eine letzte Chance, die alte wirtschaftliche Vormachtstellung zu erhalten. Die benachbarten Hansestädte waren jedoch nicht bereit, diesen Krieg zu unterstützen. Im Juli trafen Wullenwevers Sendboten in Wismar, Rostock und Stralsund ein, wo sie die Bürger gegen ihren kriegsunwilligen Rat aufbringen sollten. Doch erst nachdem anfängliche Erfolgen einen leichten Gewinn zu versprechen schienen, traten die Städte und ihr Landesherr Albrecht VII. dem Kampf gegen Dänemark bei, ohne allerdings die versprochenen Mittel jemals aufzubringen.
Ohne Kriegserklärung fiel der Lübecker Feldherr, Wullenwevers Vertrauter Marx Meyer, in Holstein ein. Ersten schnellen Siegen folgten jedoch bald kriegerische Misserfolge. Herzog Christian belagerte Lübeck und unterband durch die Blockade von Travemünde jeden Handel. Wullenwevers Beliebtheit in der Stadt sank rapide. Zu diesem Zeitpunkt wurden erste Klagen laut, dass er auf niemanden mehr höre als auf den aus Hamburg gebürtigen Syndikus Johann Oldendorp und seinen Feldherrn, den Hamburger Ankerschmied Marx Meyer. Am 18. November 1534 beendete der Frieden von Stockelsdorf den Krieg in Holstein, während mit Zustimmung aller Beteiligten in Dänemark weitergekämpft wurde. Die Bürgerschaft empörte sich wegen der wirtschaftlichen Folgen des Krieges und setzte den Rücktritt des Ausschusses und die Rückkehr der abgesetzten Ratsherren durch.
Wullenwever begab sich nach Kopenhagen, um von dort den Fortgang des Krieges zu koordinieren. Einen erneuten Machtzuwachs Dänemarks konnte er jedoch nicht verhindern, zudem zwischen den Verbündeten Unstimmigkeiten auftraten - meist um den ausbleibenden Sold. Auch in Lübeck schwand Wullenwevers Einfluss. Nach dem Untergang der Lübecker Flotte im Juni 1535 beschuldigten ihn ehemaligen Anhänger des Verrats. Wullenwever fand jedoch immer noch Unterstützung in der Gemeinde. Am 7. Juli traf ein kaiserliches Exekutional-Mandat ein, das die Wiederherstellung der alten Ordnung und die Wiedereinsetzung Nikolaus Brömses binnen 45 Tage forderte. Ein Großteil der Bürger und auch der Ratsherren ließ sich lange von Wullenwever überzeugen, dass sein Rücktritt damit nicht gemeint sei. Erst am 26. August 1535, dem letzten Tag vor Ablauf des kaiserlichen Ultimatums, trat er auf Druck des Hansetages gemeinsam mit dem Bürgerausschuss und allen anderen aus diesem Kreis in den Rat Gekommenen zurück.
Ende
Um Wullenwever einen ehrenhaften Rückzug zu ermöglichen, sollte er in Bergedorf den Posten des Amtsmanns übernehmen, den normalerweise der dienstälteste Ratsherr innehatte. Diese Stelle trat Wullenwever aber nicht an. Stattdessen versuchte er südlich von Hamburg Söldnertruppen anzuwerben, um damit die verbündeten dänischen Städte Kopenhagen und Malmö zu unterstützen. Dabei wurde er im November 1535 vom Erzbischof von Bremen, Christoph von Braunschweig-Lüneburg, gefangen genommen, im März 1536 in Rotenburg mehrmals, zum Teil unter Anwesenheit der Lübecker Ratsherren Nikolaus Brömse und Nikolaus Bardewik, peinlich befragt. Unter der Folter gestand er, eine Verschwörung gegen den Lübecker Rat und die Aufrichtung eines Wiedertäufer-Regiments nach Vorbild des Münsteraner Täuferreichs geplant zu haben. Einige seiner Vertrauten aus dem Bürgerausschuss wurden daraufhin verhaftet, der ehemalige Bürgermeister Ludwig Taschenmaker starb infolge dieser Haft. Am 24. September 1537 wurde Jürgen Wullenwever durch den Bruder des Bremer Erzbischofs, Fürst Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel, bei Wolfenbüttel am Hohen Gericht am Lechlumer Holz hingerichtet. Kurz vor seinem Tod widerrief er seine Geständnisse.
Wirkungsgeschichte
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts galt Wullenwever als heldenhafter Kämpfer gegen jegliche Unterdrückung. So erscheint er bei Ehm Welk ähnlich wie die Likedeeler verklärt zum Sozialrevolutionär.[1] Nach 1933 ist die Gestalt des Jürgen Wullenwever von der nationalsozialistischen Traditionsbildung vereinnahmt worden. So wurde das bis dahin als "Buddenbrookhaus" bekannte Gebäude in Wullenweberhaus umbenannt.[2]
Auch noch das 1954 gegründete SPD-nahe Lübecker Druckunternehmen Wullenwever-Druck knüpfte an die sozialrevolutionäre Interpretation Wullenwevers an.[3]
Literatur
- Emil Ferdinand Fehling: Jürgen Wullenwever. In: Lübeckische Ratslinie, Nr. 636, 2. Auflage, Lübeck 1925, S. 95–99 (Wikisource)
- Dietrich Schäfer: Wullenwever, Jürgen. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 44, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 299–307.
- Georg Waitz: Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die europäische Politik. 3 Bände, Berlin 1855–56.
- Hellmuth Heyden: Zu Jürgen Wullenwevers „Grafenfehde“ und ihren Auswirkungen auf Pommern. In: Greifswald-Stralsunder Jahrbuch, Band 6, VEB Hinstorff Verlag, Rostock 1966, Seiten 29–41
Literarische Adaptionen
- Fritz von Unruh: Jürgen Wullenweber. Drama. 1910.
- Ehm Welk: Gewitter über Gotland. Roman 1926 (1927 von Erwin Piscator für die Bühne bearbeitet)
- Franz Fromme: Juergen Wullenwever unde Marks Meyer. Een nedderduetsch Spill, 1924
- Hugo Paul Uhlenbusch: Jürgen Wullenwever. Roman. Alemannen Verlag Stuttgart 1937
Einzelnachweise
- ↑ Rolf Hammel-Kiesow: Die Hanse; Beck’sche Reihe München 2000; S. 9
- ↑ Vgl. Thomas Mann: Deutsche Hörer! 2 (April 1942): "An Ort und Stelle freilich heißt es schon längst nicht mehr das Buddenbrook-Haus. Die Nazis, verärgert darüber, daß immer die Fremden noch danach fragten, hatten es umgetauft in Wullenweber-Haus. Das dumme Gesindel weiß nicht einmal, daß ein Haus, das den Stempel des achtzehnten Jahrhunderts an seinem Rokoko-Giebel trägt, nicht gut mit dem verwegenen Bürgermeister des sechzehnten etwas zu tun haben kann. Jürgen Wullenweber hat seiner Stadt durch den Krieg mit Dänemark viel Schaden zugefügt, und die Lübecker haben mit ihm getan, was die Deutschen denn doch vielleicht eines Tages mit denen tun werden, die sie in diesen Krieg geführt haben: sie haben ihn hingerichtet."
- ↑ Zur Unternehmensgeschichte siehe Andreas Feser: Vermögensmacht und Medieneinfluss: Parteieigene Unternehmen und die Chancengleichheit der Parteien. Berlin 2003 zugl. Diss Würzburg 2003, ISBN 978-3-8330-0347-9, S. 150
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 17.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
ADB:Wullenwever, Jürgen
Wullenwever: Jürgen W., 1492 oder 93 wahrscheinlich in Hamburg geboren, ist weithin bekannt geworden durch die Stellung, die er in einer der bewegtesten und bedeutungsvollsten Perioden lübischer und hansischer Geschichte an sich gerissen hat. Man weiß wenig über sein Leben vor seinem Eingreifen in die lübischen Händel. Die Familie ist seit dem Ende des 13. Jahrhunderts in Hamburg nachweisbar. Der nächstälteste Bruder Jürgen’s, Joachim, betrieb Handelsgeschäfte in den nördlichen Meeren, war zeitweise dänischer Vogt auf den Faröer, in Hamburg ein eifriger Vorkämpfer der Reformation und gelangte wahrscheinlich als solcher in den Rath. Jürgen war mit einer Lübeckerin verheirathet, hatte aber eigenen Grundbesitz in Lübeck nicht, sondern wohnte in einem Hause seines Schwagers in der Königsstraße, das noch heute gezeigt wird. Er ist erst Bürger geworden, als er anfing, in die Unruhen einzugreifen.
In diesen handelte es sich theils um politische, theils um kirchliche Fragen. Der Krieg, den Lübeck mit Danzig und den wendischen Städten 1522 begonnen hatte, um den baltischen Verkehr gegen die brutale Vergewaltigung des Unionskönigs Christian’s II. zu decken, war durch daß Bündniß der Stadt mit Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht worden. Christian II. hatte im April 1523 das Reich verlassen. In dem von den Lübeckern in sein Vaterland zurückgeführten Gustav Wasa hatte Schweden einen [300] selbständigen König erhalten. Lübecks Bundesgenosse Herzog Friedrich war, von Adel und Geistlichkeit gerufen, Herrscher Dänemarks geworden. Mißhelligkeiten zwischen den beiden Reichen, die zu neuen Wirren zu führen drohten, waren wesentlich durch Lübecks Vermittelung ausgeglichen. Beide Regenten hatten nicht umhin können, die Privilegien Lübecks und der Hansa zu bestätigen, zum Theil noch zu erweitern. Aber in einem Punkte blieb das Erreichte hinter dem Erwarteten zurück. Es gelang nicht, den holländischen Ostseehandel in dem Maße zu beschränken und zu erschweren, wie daß gegenüber der immer fühlbarer werdenden Concurrenz besonders in Lübeck gewünscht wurde. Alle Versuche, die befreundeten nordischen Könige und zumal den die Zugänge der Ostsee beherrschenden dänischen zu scharfem Vogehen gegen die holländische Schiffahrt zu bewegen, blieben erfolglos, ja man mußte erleben, daß, besondets von Seiten Gustav Wasa’s, dem für sein Reich vertragsmäßig sehr enge Verkehrsschranken gezogen waren, die getroffenen Verabredungen nicht einmal gehalten wurden. In Lübeck enttäuschte, verstimmte, erbitterte das. Nach den opfervollsten kriegerischen Anstrengungen nun doch nicht die ersehnte, die nothwendige Hebung des Verkehrs! Wir finden an der Bewegung der ausgehenden 20er Jahre vor allem Kreise beteiligt, deren Lebensinteressen am baltischen Handel hingen, die Schonen-, Bergen-, Holm-, Nowgorodfahrer u. A. Der Kaufmann Harmen Israhel, der „lange Israel“, ein Hauptförderer Gustav Wasa’s, ein Mann, dem gespreiztes, großsprecherisches Auftreten nicht fremd war, erscheint unter den Unruhstiftern als ein Haupturheber.
Die Unzufriedenheit richtete sich, wie fast immer in solchen Fällen, gegen die Finanzverwaltung des Raths. Die Kriegslasten machten sich in erhöhtem Steuerdruck fortgesetzt fühlbar. Dazu kamen die kirchlichen Streitigkeiten. Der Rath hing entschieden am Alten; die Masse der Bürger verlangte noch entschiedener den neuen Gottesdienst. 1529 mußte der Rath die Berufung zweier lutherischer Prediger gestatten, Ende Juni des nächsten Jahres – gerade während in Augsburg der Reichstag tagte – sogar die Abstellung des katholischen Gottesdienstes decretiren. 1531 ward Bugenhagen berufen, das Kirchenwesen der Stadt neu zu ordnen. Die Bürger gewannen in diesen Dingen völlig die Oberhand über den Rath.
In ruhigen Tagen pflegte die sogenannte „Gemeinde“, die vom Rath aus Kaufleuten und Aemtern zusammengerufen wurde – zumeist um die Verantwortung für wichtigere Maßregeln tragen zu helfen – völlig in der Hand des Rathes zu sein. Aber in diesen Jahren zeigte sie sich unlenksam. Sie setzte die Aufstellung eines ständigen Bürgerausschusses von 64 Mitgliedern durch und schloß sogar den Rath gegen alles Herkommen von der Theilnahme an der Wahl aus, die allerdings in der üblichen Art zur Hälfte aus den Aemtern und zur Hälfte aus den Kaufleuten erfolgte. In diesen Ausschuß trat am 7. April 1530 W. ein und zwar als Kaufmann. Er gewann in ihm bald einen steigenden Einfluß, den er wol vor allen Dingen einer volksthümlichen Beredsamkett und seinem ehrlichen Eifer für das Lutherthum verdankte. Das Verhältniß von Rath und Bürgerschaft wurde gespannter. Als vom Augsburger Reichstag das Mandat eintraf, daß der 64er Ausschuß sich auflösen und die alte Ordnung wieder hergestellt werden solle, erhob sich in der Stadt ein Tumult. Der Rath wurde gezwungen, dem Beschlusse zuzustimmen, daß man dem Kaiser nur so weit gehorchen wolle, als es mit Gottes Wort und dem Besten der Stadt verträglich sei, und ward zugleich genötigt, die Einsetzung eines zweiten, weiteren Ausschusses von 100 Mitgliedern zuzulassen. Derselbe wurde am 22. October 1530 und zwar ausschließlich vom Ausschuß gewählt. Am 18. Februar 1531 setzte man eine feierliche Versöhnung zwischen Rath und Gemeinde in Scene. [301] W. war dabei einer von den Vieten, welche die 64 und die 100 vertraten. Trotz des Ausgleichs verließen aber die führenden Bürgermeister Plönnies und Brömse am Tage vor Ostern (8. April) die Stadt. Die Ausgetretenen zu ersetzen und sonstige Lücken zu ergänzen, fand bald darauf eine Neuwahl statt, nicht, wie üblich, durch den Rath selbst, sondern von 64 und 100. W. war, – wie es scheint, durch den Zufall des Looses – diesmal doch noch nicht unter den Gewählten. Erst im Februar 1533 ist er in den Rath gekommen.
Schon vorher aber hat er in die Politik der Stadt bedeutungsvoll eingegriffen. Die in Holland gerüstete Expedition des vertriebenen Christian nach Norwegen (Herbst 1531) schien Lübeck noch einmal Gelegenheit zu bieten, gegen die verhaßten Rivalen einen entscheidenden Schlag zu führen. Die verfallene dänische Seemacht reichte nicht aus, dem gefährlichen Anfall zu begegnen; man war auf Lübecks Hülfe angewiesen. W. faßte diese Situation scharf ins Auge. Ganz gegen die Gewohnheit griff der 64er Ausschuß direct in die Führung der auswärtigen Angelegenheiten ein. Er richtete an Ouartiermeister und Gemeinde von Rostock einen Brief, der zu raschem Vorgehen gegen Christian II. und die Holländer drängte. W. war der Verfasser. An zwei Gesandtschaften, die im März und Juni 1532 in Kopenhagen erschienen, nahmen, eine unerhörte Neuerung, auch Vertreter des Ausschusses Theil und zwar in gleicher Stärke mit denen des Raths. W. war unter ihnen, und es ist kaum zu bezweifeln, daß er einen wesentlichen, wenn nicht einen entscheidenden Einfluß hatte zunächst auf das Zustandekommen eines Vertrags, in dem Dänen und Schleswig-Holsteiner in Aussicht stellten, daß sie den Handel der Holländer mit Stapelartikeln hindern würden, und der die Bedingung war für die Theilnahme der städtischen Flotte an der norwegischen Expedition gegen Christian II., und dann an dem von Dänen, Schweden und Lübeckern gemeinsam gefaßten Beschlusse, Christian II. gegen gegebene Zusage gefangen zu halten. Offenbar war W. Wortführer und Vorkämpfer jener kaufmännischen Kreise, die gesonnen waren, die letzten Kräfte der Stadt an eine rücksichtslose Vertretung der Interessen des Ostseehandels zu setzen.
Schon wenige Tage nach seiner Wahl in den Rath ist W. Bürgermeister geworden. In dieser Stellung war eine seiner ersten Amtshandlungen, daß er (16. März 1533) die Bürgerschaft aufs Rathhaus forderte, um sie für eine entschiedenere Politik gegen die Holländer zu gewinnen. In Dänemark hatte man die in der Noth gegebenen Versprechungen bald vergessen und zeigte jetzt, wo man Christian II. in sicherem Gewahrsam hielt, keinerlei Neigung, gegen seine niederländischen Freunde und Gönner vorzugehen und sich ganz Lübeck in die Arme zu werfen. Die Stadt sah sich abermals um die Früchte ihrer Anstrengungen betrogen. W. legte das mit eindringlichster Beredsamkeit dar und vermochte die Gemeinde zu einem Beschluß, nach welchem das bei der Kirchenreform confiscirte Silber zur Ausrüstung von Schiffen gegen die Holländer verwendet werden sollte; der riesige Kronleuchter der Marienkirche ward als Kanonenmetall eingeschmolzen. Als schon sechs Schiffe zur Ausfahrt bereit lagen, schuf das Ableben Friedrich’s I. (10. April 1533) noch einmal eine neue Situation.
In Dänemark zögerten Adel und Geistlichkeit mit der Neuwahl. Der Nächstberechtigte, Friedrich’s ältester Sohn Christian, erschien ihnen besonders als eifriger Lutheraner wenig geeignet. Auf ihn übte der holsteinische Adel, der damals in Johann und Melchior Ranzau, in Wolf Pogwisch und dem Kanzler Wolfgang Utenhofen ebenso entschlossene wie begabte Führer besaß, einen starken Einfluß. W. versuchte noch einmal, auf Grund der vor Jahresfrist getroffenen Verabredungen, Dänemark und Schweden in den Kampf gegen die Holländer mit hineinzuziehen. Im Juni erschien er an der Spitze einer lübischen Gesandtschaft in Kopenhagen. Aber er traf hier auf die Holsteiner, die ihm schon in [302] den Niederlanden entgegengewirkt hatten, und die jetzt den Reichsrath völlig hinüber drängten auf die holländische Seite. Weder das dänische Regiment, noch Gustav Wasa wollten von einem Bündnisse gegen die Niederländer etwas wissen. Die Frage des Lübecker Kirchenguts, um daß Stadt und Adel in heftigen Zwist gerathen waren, machte die unmittelbaren Nachbarn, zu denen das Verhältniß stets ein schwieriges gewesen war, zu ausgesprochenen Gegnern der Stadt. Diese sah sich ausschließlich auf sich selbst gestellt. Durch sein persönliches, vielfach prahlerisches Auftreten, besonders auch durch sein Eingreifen in den dänischen Reformationsstreit zu Gunsten Tausen’s, hatte W. die Schwierigkeiten in Kopenhagen noch vergrößert. Gustav Wasa hat noch im Juli Lübecks Privilegien einfach widerrufen.
Eben in Kopenhagen ist W. aber auf den Gedanken gekommen, sein Ziel auf einem anderen Wege zu erreichen. Ueber das Adels- und Geistlichenregiment war man in den beiden Hauptstädten des Landes und auch in bäuerlichen Kreisen unzufrieden genug. W. trat mit den Bürgermeistern Ambrosius Bogbinder von Kopenhagen und Jürgen Kock von Malmö in Verbindung. Sie wünschten einen König und dachten dabei zunächst an Herzog Christian von Schleswig-Holstein, den auch einflußreiche lutherfreundliche Adlige gern gewählt hätten. Christian lehnte es aber ab, auf diesem Wege die Krone zu erlangen. Das führte auf den Gedanken, Christian II. zu befreien. Der Ursprung des Planes ist doch wol bei den beiden Bürgermeistern, wahrscheinlich bei Jürgen Kock, zu suchen, denn W., wenn er in seinen Entschlüssen und Versuchen auch leicht genug hin und her gesprungen ist, konnte sich doch nicht verhehlen, daß eine Wiederherstellung Christian’s II. kein Gewinn für Lübeck sein konnte. Er verneint auch ausdrücklich, daß die Absicht gewesen sei, Christian II. wieder zum Könige zu machen. Er mochte sich denken, daß es möglich sei, ihn in Lübecks Gewalt zu bringen und dadurch auf die dänische Regierung einen Druck auszuüben.
Indem man diesen neuen Weg betrat und unverzüglich Vorbereitungen traf, schien es geraten, mit den Holländern, denen man zur See wesentliche Verluste nicht hatte beibringen können, einstweilen Frieden zu schließen. Anfang März 1534 ward mit ihnen unter Vermittelung haunsischer Rathssendeboten in Hamburg verhandelt. Die Art, wie W. hier auftrat, ist doch charakteristisch für den Mann. Dürchaus gegen den Brauch auf hansischen Tagfahrten ritt er in voller Rüstung in die Stadt ein, einen Trompeter voraus, gefolgt von 60 lübischen Stadtdienern in blankem Harnisch. Seine Mitgesandten und Genossen vom Rath waren schon einige Tage zuvor in herkömmlicher Stille und Einfachheit eingezogen. Bei den Verhandlungen fuhr W. heftig auf, als sich die städtischen Vermitteler nicht ganz auf den lübischen Standpunkt stellen wollten. Der alte Stralsunder Bürgermeister Klaus Smiterlow warnte: „Herr Jürgen, ich bin bei vielen Handlungen gewesen, aber nie habe ich gesehen, daß man so mit Sachen verfahren, wie Ihr thut; Ihr werdet mit dem Kopf an die Mauer laufen“. Am 12. März hat W. Hamburg plötzlich verlassen. Von den Holländern, die auf ihrem Standpunkt beharrten, hat man den gewünschten Stillstand nur dadurch erlangt, daß man ihren abziehenden Sendeboten nachschickte, sie in Delmenhorst ereilte und dort in die volle Freiheit ihrer Schiffahrt für vier Jahre willigte (26. März).
Anlaß zu Wullenwever’s plötzlicher Heimkehr waren wol Nachrichten über Unzufriedenheit mit dem neuen Regimente, die sich in Lübeck zu zeigen begann. Das eigenmächtige Verlassen seines Postens führte zu einer offenen Anklage, die angesehene Bürger, meistens Kaufleute, an den Rath brachten. W. rechtfertigte sich in der Marienkirche vor versammeltem Volke von der Kanzel herab. Seine Beredsamkeit trug einen glänzenden Sieg davon. Die Gegner mußten, [303] der Verhaftung zu entgehen, schleunig die Stadt verlassen. Man schritt dann zu einer Reinigung des Raths, entfernte die alten Mitglieder bis auf vier und ersetzte sie durch Anhänger der neuen Ordnung. Wullenwever’s Herrschaft war befestigt, die Bahn geebnet für sein neues Beginnen.
Am 14. Mai 1534 überrumpelte Marcus Meyer, der vom Hufschmied und Landsknecht in lübischem Dienst zu einem angesehenen Söldnerführer emporgestiegen war und durch seine im Herbst 1533 geknüpften Beziehungen zu Heinrich VIII. von England wahrscheinlich auch Einfluß auf Wullenwever’s Entschließungen gewonnen hat, das feste Schloß Trittau an der Hamburg-Lübecker Straße. Gleichzeitig fiel Graf Christoph von Oldenburg an der Spitze der von Lübeck geworbenen Kriegshaufen ohne Absage in Holstein ein. Kaum je ist eine Fehde leichtfertiger begonnen worden. Aus Holstein waren die Städtischen auch bald genug wieder hinausgeschlagen. Aber am 21. Juni erschien eine lübische, 21 Segel starke Flotte mit 1500 von Christoph geführten Knechten an Bord im Sunde. Die Bürger von Malmö hatten sich schon in den letzten Maitagen erhoben und das Schloß ihrer Stadt dem Erdboden gleich gemacht. Als der Graf seine Truppen landete, erhob sich überall auf Seeland der Aufruhr, schlug bald nach Schonen, nach Fünen und den Nebeninseln, im September auch nach Jütland hinüber. Hier übernahmen die Bauern, dort die Bürger der Städte die Führung. Der Adel fand nur in Jütland und Fünen Kraft zum Widerstande; in Seeland und Schonen schloß er sich scheinbar der Bewegung an, um nicht Schaden zu leiden, und huldigte dem Oldenburger Grafen im Namen Christian’s II. Seit Mitte Juli stand auch die Reichsbauptstadt auf Seiten Lübecks und des Grafen. Der jütische Adel ward am 15. October von den Bauern bei Aalborg gänzlich geschlagen. Auch Dänemark erlebte seinen Bauernkrieg und seine Bürgerrevolutionen. Im Herbst 1534 schien Lübeck in der That Herr im Königreich zu sein.
Aber gegen diese plötzlich emporgewachsene Gewalt erhoben sich von allen Seiten die überlieferten, organisierten Kräfte. Unter den deutschen Fürsten hatte Lübecks Vorgehen gegen den holsteinischen Nachbarn, bei dem auch, allerdings vergeblich, ein Aufhetzen der Bauern versucht worden war, allgemein den größten Unwillen erregt. Man verglich die lübischen Hergänge mit den münsterschen und fand, daß der Krieg „allein zur Dämpfung der Fürsten und Obrigkeit unternommen sei“, daß es sich also auch hier vor allem darum handele, den Herrn Omnes niederzuhalten. Man ging dem Herzog Christian in jeder Weise zur Hand; besonders Landgraf Philipp und Herzog Heinrich von Braunschweig unterstützten ihn mit Werbungen und Truppensendungen. Auch bei den hansischen Genossen fand das Vorgehen der lübischen Machthaber keine Billigung. Nur die Nachbarstädte Rostock, Wismar und Stralsund, in denen unter Lübecks Einfluß die Verfassungen ebenfalls demokratisch umgestaltet wurden, kamen Lübeck zu Hülfe. Gustav Wasa rückte alsbald gegen Schonen heran, dort die Lübischen und den Aufstand zu bekämpfen. Der schleswig-holsteinische Adel schaarte sich fest um seinen Herzog. Lieber solle in Lübeck kein Stein auf dem andern bleiben, als daß man den Herzog vom Königreiche abdrängen lassen wolle. Alsbald nach Ausbruch des Aufstandes hatte zunächst der jütische und dann der fünensche Adel Herzog Christian zum Könige gewählt. Am 17. Juli 1534 ward ihm die Krone angeboten, und jetzt nahm er sie an. Den Aufstand auf Fünen versuchten die Holsteiner allerdings vergeblich niederzuschlagen, aber den Krieg an der Trave führte ihr Herzog mit Kraft und mit Glück. Er überbrückte den Fluß und schloß die Lübecker vom Meere ab. Man bekam in der Stadt die Drangsal des Krieges zu kosten, was W. und Marcus Meyer nicht populärer machte. Der Stimmung nachgebend schloß W. am 9. November 1584 den Stockelsdorfer [304] Vertrag, der gegenüber Holstein Ruhe schuf, den Krieg in Dänemark aber fortbestehen ließ. Anstatt einen völligen Frieden herzustellen, was unter annehmbaren Bedingungen möglich gewesen wäre, verschlechterte man, der augenblicklichen Verlegenheit zu entgehen, die Aussichten auf einen glücklichen Ausgang.
Denn darüber konnten die zeitigen Machthaber nicht im Zweifel sein, daß die Stadt nicht im Stande sein werde, Dänemark gegen den von seinem Adel gestützten schleswig-holsteinischen Herzog zu behaupten, wenn derselbe jetzt seine Truppen ins Reich wandte und sich als König an die Spitze desselben stellte. W. hat sich daher auch eifrigst bemüht, neue Bundesgenossen zu gewinnen. Er verhandelte mit Herzog Albrecht von Meklenburg, mit dem sächsischen Kurfürsten, mit Heinrich VIII., überall unter Angebot der dänischen Krone. Gegen den gefährlichen Schwedenkönig suchte er dessen Schwager, den Grafen von Hoya aususpielen, indem er ihm Aussichten auf die schwedische Königskrone eröffnete. Wegen der Rolle, welche die beiden Grafen spielten, hat der ganze Krieg den Namen der Grafenfehde erhalten. Gleichzeitig bot er Schwedens Krone dem Kurfürsten Johann Friedrich, zeitweise auch dem Meklenburger, dann dessen Bruder Heinrich an. Gustav Wasa hatte nicht so Unrecht, wenn er sagte, daß die Lübecker mit diesen altberühmten Königreichen hausiren gingen wie der Krämer mit seinem Knappsack. Albrecht von Meklenburg ist wirklich zur Theilnahme am Kriege bewogen worden. Seltsam genug, da gerade dieser Fürst eifrig katholisch war, während doch der eben so eifrig evangelische W. nicht müde wurde, zu behaupten, daß das dänische Unternehmen auf Ausrichtung und Befestigung der neuen Religion im Reiche abziele. Er suchte den Meklenburger in der Religionssrage durch Vertragtsclauseln zu binden. Entscheidend war aber, daß dieser, als er im April 1535 wirklich nach Dänemark übersetzte, nur wenige Fähnlein mit hinüberführte, eine Verstärkung, die kaum den Unmuth aufwog, den das Heranziehen des Meklenburgers beim Oldenburger erregte. Im Westen und Osten des Landes war inzwischen die Entscheidung schon gefallen. Noch im December 1534 hatte Johann Ranzau den jütischen Aufstand völlig niedergeworfen; im Januar war der schonensche den Schweden und den mit ihnen vereinigten Adligen erlegen, die abermals die Partei gewechselt hatten. Marcus Meyer selbst war hier durch Verrath in Gefangenschaft gerathen. Die Herzoglichen kamen gerade noch früh genug, um am Kampf auf Fünen theilzunehmen. Aber auch hier wurden die Verbündeten unter Johann von Hoya am 11. Juni 1535 am Ochsenberge bei Assens vollständig geschlagen, der Graf selbst getödtet. Fünf Tage später ward die städtische Flotte vor Svendborg von einem vereinigten schwedisch-dänisch-preußisch-schleswig-holsteinischen Geschwader unter Führung Peter Skram’s völlig vernichtet, die schwerste Niederlage, welche je eine hansische Flotte betroffen hat. Man darf wol sagen, daß es allein die unsinnige Politik Wullenwever’s war, die eine solche Coalition gegen daß Haupt der Hansa ermöglicht hatte. Bald war auch Seeland überschwemmt; nur Kopenhagen und Malmö leisteten noch lange Widerstand, dieses bis in den April, jenes gar bis zum 29. Juli 1536. Graf und Herzog haben hier mit Knechten und Bürgern ausgehalten.
Inzwischen war W. längst eine gefallene Größe. Schon gleich nach dem Stockelsdorfer Vertrage waren die beiden Ausschüsse ohne Schwierigkeit aufgelöst worden. Die Mehrzahl der Bürger sehnte sich offenbar nach Rückkehr zu den alten Zuständen. Die zuletzt ausgeschiedenen Mitglieder des Raths traten wieder ein. W. konnte das nicht angenehm sein. Er hat um diese Zeit beim Kurfürsten von Sachsen um Dienst nachgesucht. Aber als Führer der neuen Rathsglieder behauptete er doch noch einen maßgebenden Einfluß. Erst die Mißerfolge in Dänemark haben seinen Gegnern den vollen Sieg gebracht. Die [305] endliche Entscheidung ward durch die Hansestädte herbeigeführt. Ihnen stand das Schicksal Münsters warnend vor Augen. Die dortigen wiedettäuferischen Unruhen hatten dieses alte und werthvolle Glied des Bundes den Genossen entrissen und dem Streben der Fürsten, die Selbständigkeit der Städte zu brechen, eine nur zu bequeme Handhabe geboten. Da es auch in anderen Städten an täuferischen Neigungen nicht gefehlt hatte, betrachtete man in den Rathscollegien alle populären Bewegungen mit erklätlichem Mißtrauen. Im April 1535 versammelten sich in Hamburg sächsische und wendische Städteboten, um über die Wiedertäufer zu berathen. Hamburg und Bremen schlugen für Juli einen allgemeinen Hansetag in Lüneburg vor, der zu Stande kam und ungewöhnlich zahlreich besucht war. Die Mißstimmung gegen Lübeck trat hier deutlich hervor. Man forderte die Stadt auf, die ebenso ungerechte wie verderbliche Fehde, die allen Städten zum Schaden gereichen müsse und nur die Pläne der Fürsten fördere, schleunigst beizulegen. W. war nicht zugegen; er soll die Theilnahme an der Gesandtschaft verweigert haben. Sofortige Beendigung der Fehde ward doch von den Vertretern der Stadt als unmöglich bezeichnet und schroff abgelehnt. Nach einigen Tagen haben diese aber erklärt, sie seien ohne weitere Instruction und haben um Verlegung der Verhandlungen nach Lübeck gebeten, worin man ihnen willfahrte. Dort ist besonders Danzig heftig aufgetreten. Seine Rathssendeboten haben sich bitter beklagt über die lübischen Kreuzer, die den Danziger Handel schädigten, haben Schadenersatz und freie Fahrt verlangt und sogar Bestrafung Wullenwever’s als des Schuldigen.
Mitten in diese Verhandlungen hinein kam ein kaiserliches Executorialmandat vom Kammergericht zu Speier, das von den aus der Stadt Entwichenen unter Führung Brömse’s erwirkt war. Es forderte bei Strafe der Acht die Abstellung aller Neuerungen innerhalb 45 Tagen, die Ausschließung der seit Brömse’s Abreise Neugewählten aus dem Rathe und die Wiedereinsetzung der Verdrängten. Die Städte, die man um Rath anging, mahnten zum Gehorsam. Die Dithmarschen, Lübecks getreue Bundesgenossen, hatten schon im Frühling zur Rückberufung Brömse’s gerathen. Unter den Bürgern wurde dieselbe vielfach als daß einzige Mittel der Rettung bezeichnet. Der Rath aber, zusammengesetzt aus Alten und Neuen, schwankte unschlüssig hin und her. Einer Versammlung der Bürger, die berufen wurde, setzte W. auseinander, daß Brömse’s Rückkehr die Wiederaufrichtung des alten Kirchenwesens bedeuten werde, machte damit aber nicht den erwarteten Eindruck. Da hat er sich am 15. August als Führer einer städtischen Gesandtschaft zu Herzog Heinrich von Meklenburg begeben und ist, durch widrige Zwischenfälle aufgehalten, erst am 23. heimgekehrt. Inzwischen war die Entscheidung gefallen, nicht ohne daß die Städte nachgeholfen hatten. Wullenwever’s Genossen waren aus dem Rathe zurückgetreten; es blieb ihm nichts übrig, als am 26. August den gleichen Schritt zu thun. Zwei Tage später ward Brömse, mit dem die Städte die Ausgleichsverhandlungen geführt hatten, feierlich wieder eingeholt und in die oberste Stelle des Rathsstuhles gesetzt. Bedingung seiner Restitution war die Anerkennung des neuen Kirchenwesens.
Wullenwever’s Entfernung aus dem Rath trägt nicht den Charakter feindseliger Verfolgung. Es ward ihm die wichtige und ehrenvolle Stelle eines Amtmanns in Bergedorf auf sechs Jahre übertragen, welches Amt er aber nicht einmal angetreten hat. Er konnte sich auch jetzt noch nicht entschließen, seinen Projecten zu entsagen. Aussichten auf Hülfe von Heinrich VIII., vom Pfalzgrafen Friedrich, der auf Antrieb des Kaisers Christian’s II. Tochter geheirathet hatte, schwebten ihm vor. In der ersten Hälfte des November 1535 unternahm [306] er eine Reise ins Land Hadeln, um sich dort mit Landsknechten in Verbindung zu setzen, die früher unter dem Oldenburger gedient hatten; wahrscheinlich, daß er sie zum Entsatz Kopenhagens zu gebrauchen dachte. Auf dem Wege wurde er zu Rotenburg im Bremischen gefangen gesetzt; der Erzbischof mochte von Wullenwever’s Gegnern in Lübeck verständigt sein. Er war Anhänger der alten Religion und ein Bruder Herzog Heinrich’s von Braunschweig.
Dieser, der sich stets den Städten und zumal dem Lübecker Unternehmen mit Eifer entgegengesetzt, nahm sich alsbald der Sache lebhaft an. Er erschien im December beim Bruder, und in seiner Gegenwart wurde W. am letzten Tage des alten und ersten des neuen Jahres zunächst ohne Folter und dann peinlich verhört. Erst der Zwang führte zu compromittirenden Aussagen. W. bekannte, von den Kirchengütern 20 000 Gulden für sich empfangen, mit seiner letzten Reise es gegen Lübeck abgesehen zu haben; er nannte Mitwisser und Mitschuldige in Lübeck und andern Städten und enthüllte, daß man zunächst dort, dann an anderen Orten wiedertäuferisches Regiment habe einführen wollen. Das größte Interesse an dem Gefangenen hatten die wiederhergestellten Machthaber in Lübeck und Christian III. von Dänemark und Schleswig-Holstein, dem W. nicht geringen und mehr Schaden als irgend einem Andern gethan hatte. Herzog Heinrich setzte sich mit ihnen in Verbindung. Am 22. Januar 1586 ist er in Buxtehude mit den Lübecker Bürgermeistern Brömse und Gerken, am 24. ebendaselbst mit König Christian zusammengekommen. W. ward dann in Gegenwart schleswig-holsteinischer Räthe am 26. Januar zum zweiten und im Beisein zweier Lübecker Rathsherren (Brömse und Bardewik) am 18. März zum dritten Male verhört. Er wiederholte seine früheren Aussagen. Trotzdem ist nicht zu bezweifeln, daß sie unrichtig waren, soweit sie todeswürdige Verbrechen: Veruntreuung, Verschwörung gegen die Vaterstadt und wiedertäuferischen Umsturz betrafen. Diese Geständnisse sind im ersten Verhör durch die Folter erpreßt und in den späteren aus Furcht aufrecht erhalten worden. W. hat dazwischen, in Briefen und sonst, bekannt, daß er dieser Dinge unschuldig sei. Im Kerker zu Rotenburg schrieb er an die Wand:
- Kein Dieb, kein Verräther, kein Wiedertäufer auf Erden
- Bin ich nie mehr gewesen, wills auch nimmermehr erfunden werden.
- O Herr Jesu Christ, der du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben,
- Ich bitte dich durch deine Barmherzigkeit, du wollest Zeugniß von der Wahrheit geben.
Später ist W. vom Bremer Erzbischof dem Bruder Herzog Heinrich ganz übergeben und auf Schloß Steinbrück zwischen Braunschweig und Hildesheim zur Haft gebracht worden. Mit der gerichtlichen Aburtheilung hat der Herzog lange gezögert. Erst auf den 24. September 1537 ward zu diesem Zweck ein Termin vor einem Landgericht bei Wolfenbüttel angesetzt. Beauftragte des dänischen Königs und der Stadt Lübeck waren dazu geladen und sind erschienen. Sie haben nacheinander die Anklagen erhoben, die Wullenwever’s Geständnisse an die Hand gaben. Der Verklagte ist jetzt aber unerschütterlich dabei geblieben, daß er an allem unschuldig sei, nur gegen den Herzog von Holstein, den jetzigen König von Dänemark, habe er wol genug gehandelt und damit wol auch den Tod verschuldet. Doch fand man ihm daß Urtheil, geviertheilt und auf vier Räder gelegt zu werden. Noch auf der Richtstätte widerrief W. seine früheren Aussagen über Mitschuldige und betheuerte, kein Dieb, kein Verräther und kein Wiedertäufer gewesen zu sein. „Darauf will ich sterben.“ Er ward mit dem Schwert gerichtet, der Leichnam geviertheilt und auf vier Räder gelegt.
Daß dieses Verfahren einen groben Rechtsbruch in sich schloß, kann nicht bezweifelt werden. Schon die Zuständigkeit Herzog Heinrich’s und seines Landgerichts [307] muß verneint werden. Geständig war W. vor Gericht nur des Schadens, den er Schleswig-Holstein und Dänemark zugefügt hatte; aber der war in offener Fehde begangen und durch Friedensverträge längst gesühnt. Daß man ohne Absage in Holstein eingefallen, konnte man ihm doch nicht allein zur Last legen, wie denn die ganze Fehde mit Zustimmung von Rath und Bürgerschaft begonnen war. Das über W. ergangene und an ihm vollstreckte Urtheil entstammt politischer Gegnerschaft, ist kein rechtlich begründetes. Und doch hatte W. kein unrichtiges Gefühl, wenn er meinte, daß er – zumal nach den Anschauungen der Zeit über Strasmaß – den Tod wol möge verdient haben. Er hatte sich Großes vermessen auf Grund einer Gewalt, die revolutionären Hergängen ihren Ursprung verdiente; schwere Wunden waren durch ihn geschlagen worden daheim und in der Fremde und Ströme Bluts geflossen. Wer solche Verantwortung auf sich nimmt, der muß sich gegenwärtig halten, daß in den Stürmen, die er entfesselt, sein eigenes Leben ein Kleins ist. Es kann die Bürde wenig erleichtern, daß geltend gemacht werden kann, er habe Gutes gewollt, Größe und Wohlfahrt seiner Stadt und ihrer Bürger. In solchen Fällen entscheidet das Können, der Erfolg. Bleibt er aus, so ist der Wagende gerichtet.
An den persönlichen Voraussetzungen des Erfolges fehlte es W. nur zu sehr. Wahre Größe war nicht in ihm. Eine gewisse Selbstgefälligkeit und ein kecker, leichter, ja leichtfertiger Muth sind seine hervorstechendsten Charakterzüge. Hochtrabendes, prahlerisches Auftreten kann man ihm bei mehr als einer Gelegenheit zum Vorwurf machen. Er besaß die Herrschaft über das Wort, war aber ein schlechter Unterhändler. Er glaubte da ertrotzen und erpoltern zu können, was nur durch ein Ineinandergreifen von Vorsicht und Schmiegsamkeit mit Zähigkeit und Entschlossenheit zu erreichen ist. Sein vielseitiger Geist ward auch in schwierigen Lagen nicht müde, nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen; aber in ihrer Durchführung war er nicht selten unbeständig, in seinen Hoffnungen überhaupt sanguinisch, zur Leichtgläubigkeit geneigt. So gewinnt seine Unternehmungslust nur zu oft den Charakter unruhiger und – unfähiger Projectenmacherei. Gewiß, daß die Beziehungen zu abenteuerlichen Männern zweifelhaften Charakters, wie Marcus Meyer, Oldendorp, Pack, von Einfluß gewesen sind, aber das kann Wullenwever’s Schuld und Verantwortung nicht mindern. Zu einem wirklich bedeutenden Manne fehlte ihm so gut wie Alles. Durch einen leichtgeschürzten Ehrgeiz und einige fördernde Fähigkeiten in unruhiger Zeit emporgekommen, erkühnte er sich, Probleme zu lösen, an die die Stadt durch Jahrhunderte ihre beste Kraft gesetzt hatte, deren vollständige Erledigung aber ihr Vermögen überstieg und deshalb von der überlieferten, zugleich besonnenen und entschlossenen Politik nach den Tagen Waldemar Atterdag’s nie mehr ernstlich ins Auge gefaßt worden war. W. hat durch sein Beginnen dem Gemeinwesen nicht genützt, sondern geschadet, Lübecks Sinken beschleunigt. Irrthum und Verfehlung aber hat er durch seinen Tod gebüßt und so wohl verdient, daß spätere Geschlechter, die an den Vorfahren sich und ihr Streben emporzurichten suchten, auch an seiner Gestalt sich erwärmten. Wollen und Geschick des Mannes ließen ihn in vaterländisch bewegter Zeit wie geschaffen erscheinen, Held nationaler Dramen zu werden, und unter den Dichtern, die sich an dieser Aufgabe versucht haben, sind Namen, die nicht zu den schlechtesten zählen (Gutzkow, Kruse).
G. Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die Europäische Politik I–III. Berlin 1855, 56. – Paludan-Müller, Grevens Feinde I,II. Kopenhagen 1853. – D. Schäfer, Gesch. v. Dänemark IV, 230 ff. Gotha 1893.
Dietrich Schäfer.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren bzw. Versinonsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 17.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Vitalienbrüder
Vitalienbrüder (auch: Vitalier; Lateinisch: fratres Vitalienses) nannten sich die Seefahrer, die gegen Ende des 14. Jahrhunderts zunächst als Blockadebrecher die Lebensmittelversorgung Stockholms bei der Belagerung durch dänische Truppen sicherstellten und anschließend als Kaperfahrer den Handelsverkehr in der Nord- und Ostsee beeinträchtigten.
Die bekanntesten Anführer der ersten Generation waren Arnd Stuke und Nikolaus Milies, später werden Klaus Störtebeker, Gödeke Michels, Hennig Wichmann, Klaus Scheld und Magister Wigbold genannt.
Name
Die Herkunft des Ausdrucks Vitalienbrüder ist nicht endgültig geklärt, stammt jedoch vermutlich aus dem Mittelfranzösischen, in dem zu Beginn des hundertjährigen Krieges jene Truppen, welche das Heer versorgten, vitailleurs genannt wurden (siehe auch: Viktualien = Lebensmittel). Lange Zeit wurde der Name aus diesem Grund unmittelbar mit der Versorgung des belagerten Stockholms in Verbindung gebracht.
Wahrscheinlich ist diese Verknüpfung jedoch unrichtig, da die Bezeichnung in Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg schon vor der Belagerung der schwedischen Stadt auftaucht.[1] Die Bezeichnung wurde also bereits vor der Versorgung Stockholms gebraucht. Vielmehr wird damit auf die Selbstbestimmung der Seefahrer angespielt, die (im Unterschied zu Söldnern) nicht Lohn und Verpflegung von ihrem Auftraggeber erhielten.
Ab 1398 ist auch die Bezeichnung Likedeeler (niederdeutsch für „Gleichteiler“, was sich auf die Aufteilung der erbeuteten Prisen bezieht) überliefert, hier wird der Fokus auf die soziale Organisation der Bruderschaft gerichtet, die sich erheblich von der streng hierarchisch strukturierten mittelalterlichen Gesellschaft mit ihrem ständischen Lehnswesen unterschied und neben der Autorität der Hauptleute auch Mannschaftsräte ins Leben rief. Somit war dem gemeinen Seemann ein gewisses Maß an Mitspracherecht gewährleistet, das der feudalen Gesellschaft fehlte.[2] Zudem impliziert der Name Likedeeler Loyalität und gegenseitige Unterstützung, was sich positiv auf den inneren Zusammenhalt des Seeräuberbundes ausgewirkt haben dürfte. In einem ähnlichen Sinne dürfte die selbstgewählte Losung „Gottes Freunde und aller Welt Feinde“ zu verstehen sein.
Herkunft und Organisation
Die Vitalienbrüder, die besonders in der Frühphase ihrer Entstehung von unterschiedlichen Territorialmächten angeheuert wurden,[3] erhielten im Gegensatz zu Söldnern weder Lohn noch Verpflegung. Sie waren auf Selbstversorgung angewiesen und fuhren auf eigene Rechnung anstelle eines geregelten Soldes.
Zunächst rekrutierte sich ihre Führungsschicht aus verarmten mecklenburgischen Adelsgeschlechtern. Eine seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts andauernde Agrarkrise ließ viele von Armut bedrohte Männer aus dem niederen Adel ihr Glück jenseits der Legalität suchen, zu Lande wie auf See. So sollte mit gezielten Raubzügen die einsetzende Verarmung kompensiert werden.[4]
Als Hauptleute der „ersten Generation“ der Vitalienbrüder sind Arnd Stuke und Nikolaus Milies überliefert, erst später werden Namen wie Gödeke Michels, Klaus Störtebeker, Hennig Wichmann, Klaus Scheld oder Magister Wigbold genannt. Diese „zweite Generation“ rekrutierte sich vermutlich nicht mehr aus den mecklenburgischen Adelsgeschlechtern, sondern erlangte ihre Führungsposition durch Geschick und Wagemut.[5]
Über die Mannschaften selbst ist wesentlich weniger bekannt. Vermutlich handelte es sich bei den Vitalienbrüdern vor allem um eine Anlaufstelle für Verfestete, also vom bürgerlichen Leben der Städte ausgeschlossene Existenzen, flüchtige Schuldner oder Glücksritter. Zeitgenössische Quellen stehen mit Hinblick auf die Männer selbst kaum zur Verfügung. Die Chroniken, die sich 150 Jahre später mit den Vitalienbrüdern beschäftigen, enthalten schon erste Elemente der Glorifizierung, an deren Ende die Legendenbildung der „Störtebeker-Sage“ steht. Auch vereinzelt operierende Seeräuber dürften zu den Vitaliensern gezählt worden sein. Mit der Ausstellung von Kaperbriefen und damit der Legitimation ihres Handwerks erschien die Beteiligung im dänisch-mecklenburgischen Konflikt ertragreich.
Vermutlich organisierten sich die Kaperfahrer der Nord- und Ostsee ab 1390 in einer Art Bruderschaft; anders ist das plötzliche Aufkommen der Bezeichnung fratres Vitalienses, Vitalienbrüder, ab eben jenem Jahre nicht zu erklären. Gründungen von Bruderschaften stiegen ab dem Ende des 14. Jahrhunderts rapide an; so wurde beispielsweise in Hamburg im Jahre 1350 die Bruderschaft der Englandfahrer gegründet. Bruderschaften wie diese mögen den Kaperfahrern bei der Bildung ihrer „Dachorganisation“ als Vorbild gedient haben. Dabei hat es eine geschlossene Bruderschaft im Sinne einer straffen Organisation nie gegeben: Zeitweise fochten Vitalienbrüder als Verbündete unterschiedlicher Parteien gegeneinander.
Der rechtliche Status dieser Bruderschaft ist nicht immer einfach zu bestimmen, die Grenzen zwischen Piraterie, Seeraub oder Kaperfahrt verwischen: Wiederholt wurden Vitalienbrüder mit Kaperbriefen unterschiedlicher Herrscher ausgestattet und unterschieden sich somit objektiv vom gemeinen Seeräuber. Die Hanse aber beispielsweise akzeptierte diese Legitimation durch Kaperbriefe nicht, für sie handelte es sich unterschiedslos um Piraten. Die Zugehörigkeit zu den fratres Vitalienses genügte zumeist, um ein Todesurteil auszusprechen.
Dennoch entwickelt sich die Bruderschaft schnell. Im Jahre 1392 schätzten die Generalprokuratoren des Deutschen Ordens die Gesamtzahl der Vitalienbrüder auf rund 1500.[6] Auf dem Höhepunkt ihrer Macht, zur Zeit der Herrschaft über Gotland, kann die Größe der Bruderschaft auf etwa 2000 Mann geschätzt werden.[7]
Trotz ihrer Größe und Bedeutung für Politik und Handel verfolgten die Vitalienbrüder nie territorialpolitische Interessen im engeren Sinne, im Gegenteil: Sie waren immer auf die Anbindung an eine Territorialmacht angewiesen.
Geschichte
Die Vitalienbrüder in der Ostsee
Thronwirren in Skandinavien
Den Ausgangspunkt der Entwicklung der Vitalienbrüder bildete der Konflikt zwischen Dänemark und Mecklenburg in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Waldemar IV. „Atterdag“, König von Dänemark, eroberte in den Jahren 1361 und 1362 Schonen, Öland, Bornholm und schließlich Gotland. Daraufhin wurde auf dem anschließenden Hansetag in Köln im Jahre 1367 die Gründung der Kölner Konföderation beschlossen, mit dem Ziel, Dänemark und das alliierte Norwegen zu bekämpfen. So sollten die als bedroht angesehenen Handelsprivilegien gewahrt werden.
Der Konföderation gelang der Sieg über den Dänenkönig: Am 24. Mai 1370 wurde der Friede von Stralsund geschlossen, der die Handelsprivilegien der Hanse bestätigte und ihr zudem für 15 Jahre die Kontrolle über die vier dänischen Schlösser im Sund, Skanör, Falsterbo, Helsingborg und Malmö, zusprach.[8] Das Gewinnen dieser Kraftprobe war ein triumphaler Erfolg der Hanse.[9]
Waldemar IV. starb am 24. Oktober 1375. Seine Tochter Margarete (Ehefrau des norwegischen Königs Håkon VI.) setzte nun ihren Sohn Olaf IV. in der Thronfolge gegen den eigentlich erbberechtigten Albrecht IV., Sohn ihrer älteren Schwester Ingeborg, der Ehefrau des Mecklenburger Herzogs Heinrich III., durch. Ein Jahr darauf wurde Olaf am 3. Mai 1376 gegen den Willen der Mecklenburger und Kaiser Karls IV. zum König gekrönt. Die Hanse, der nach den Friedensverhandlungen ein Mitspracherecht bei der Besetzung des dänischen Throns zugesprochen worden war, nahm die Entscheidung mit Wohlwollen auf[10] und bestätigte ihn im Amt.[11]
Mecklenburg verfolgte nun eine „Politik der Nadelstiche“[12] und startete einen Kaperkrieg gegen Dänemark, in dem Albrecht II. erstmals Seeräuberschiffe mit Kaperbriefen ausstattete. Vermutlich übernahmen mecklenburgische Adlige die Führung über diese Schiffe.[13] In den Folgejahren machten beide Seiten von Seeräubern Gebrauch, insbesondere um Kauffahrer zu stören.
Die Hanse rüstete sogenannte „Friedeschiffe“,[14] um so zur Wahrung ihrer Interessen die Seewege vor Überfällen zu schützen. Es kam jetzt zu ersten Unstimmigkeiten mit den Hansestädten Rostock und Wismar, die das Verbot der Hanse, geraubte Waren zu kaufen oder zu verkaufen, umgingen, damit allerdings im Interesse ihres Landesherrn Albrecht II. handelten. Die Kauffahrer selbst schützten sich in Konvois: „Der Seeräubergefahr gegenüber schlossen sich die Seefahrer einer Stadt oder ganzer Städtegruppen zu Flotten zusammen.“[15]
Nachdem Albrecht II. am 18. Februar 1379 verstarb, schloss sein Sohn Albrecht III., König von Schweden, im August des Jahres einen Friedensvertrag mit Dänemark, da auch sein Bruder Heinrich III. als neuer Herzog von Mecklenburg Waffenstillstandsverhandlungen mit Dänemark begonnen hatte und so ein Kampf gegen die Dänen wenig aussichtsreich erschien. Albrecht IV., Heinrichs Sohn, verzichtete auf Anraten seines Vaters zudem auf die dänische Krone.[16]
Als Håkon VI. 1380 verstarb, geriet Margarete über die nun neu zu bestätigenden Handelsprivilegien in Konflikt mit der Hanse. Auch sie bediente sich der Seeräuber, um den Schiffshandel zu stören. Ziel war allerdings nicht mehr Mecklenburg, sondern der gemeine Hansekaufmann. 1381 schwenkte die Regentin dann auf einen hansefreundlicheren Kurs um und vermittelte sogar bei einem befristeten Friedensschluss zwischen dem Städtebund und den Seeräubern: Margarete erschien geradezu als die vermittelnde Macht zwischen ihren räuberischen Adligen und der Hanse.[17]
Mit bloßen Verträgen konnte die Hanse ihres Problems aber nicht nachhaltig Herr werden, und so rüstete sie wiederholt Friedeschiffe. Auch Margarete unterstützte die Hanse nun aktiv im Kampf gegen die Seeräuber, denn sie musste sich eine möglichst günstige Position für die Verhandlungen hinsichtlich der vier Sundschlösser verschaffen, deren Rückgabe in dänische Hand nach den Vereinbarungen des Stralsunder Friedens in eben jenem Jahr zu leisten war. Die Übergabe gelang: Die Zurücknahme der Schlösser wurde am 11. Mai 1385 beurkundet, und sie bestätigte im Gegenzug die Handelsprivilegien der Hanse in Dänemark:
„Vortmer tho wat tiden se des van uns begerende sin, dat wy en vornyen de confirmacien, de wy en gegeven hebben up ere privilegien und vriheit in unsem ryke tho Denemarken, der vorniginge schulle wy en nicht wegeren. Ok schal desse bref nicht hinderlik wesen al eren anderen breven eder vriheiden, de se edder erer jenich hebben van uns und unseren vorolderen in dem rike tho Denemarken, men der schulle se bruken und de schullen by erer vullen macht bliven.“[18]
Die Hanse versuchte sogar, der Ausrüstung und des Streitens über die Finanzierung der Friedeschiffe überdrüssig, einen Privatmann mit der Bekämpfung der Seeräuber zu beauftragen. Unter der Führung des Stralsunder Bürgermeisters Wulf Wulflam, der bislang mit der Verwaltung der vier Sundschlösser beauftragt gewesen war, startete eine bewaffnete Expedition gegen die Seeräuber:
„Für alle ihm für die Schiffe und die Leute entstehenden Kosten soll[te] er selbst aufkommen. Und hierfür [gaben] ihm die Städte 5000 Mark Sundisch. […] Wulflam konnte das, was er den Seeräubern abnahm, behalten, es sei denn, die Seeräuber hätten das von einem Kaufmann geraubt.“[19]
In der Folgezeit begannen sich sowohl Dänemark als auch Mecklenburg von den Vitalienbrüdern zu distanzieren. Vom 28. September 1386 an schloss die Hanse gar einen offiziellen Friedensvertrag mit Abgesandten der Kaperer; dieser sollte bis 1390 halten.
Am 3. August 1387 starb Olaf IV.; Margarete wurde nun auch offiziell Herrscherin über Dänemark. Sie trat sogleich in Verhandlungen mit dem schwedischen Adel, der ihr im Jahre 1388 offen huldigte, sie also als Herrscherin des Reiches anerkannte und ihr die Treue schwor.
Albrecht III., der legitime König, begab sich derweil nach Mecklenburg, um Bundesgenossen und Finanzen auszuheben. Im Dezember kehrte er mit einem Heer nach Schweden zurück, wo er allerdings am 24. Februar des Folgejahres bei Falköping eine vernichtende Niederlage erlitt und mit seinem Sohn Erich in Gefangenschaft geriet. Binnen kurzer Zeit brachte Margarete, die seit dem Tode ihres Mannes Håkon im Februar auch Regentin Norwegens auf Lebenszeit war, ganz Schweden unter ihre Kontrolle – mit Ausnahme Stockholms, das Albrecht weiterhin die Treue schwor und auch einer militärischen Eroberung standhielt. Die Stadt wurde infolgedessen belagert und in den Jahren 1389 bis 1392 von den Vitalienbrüdern von See aus versorgt.
Kaperfahrer in der Ostsee
Ab 1390 fuhren die Mecklenburger eine doppelte Kriegstaktik: einerseits direkte Angriffe (dazu wurde eine Kriegssteuer erhoben; der von Herzog Johann von Stargard, einem Onkel Albrechts III., geleitete Kriegszug[20] endete jedoch erfolglos), andererseits ein Kaperkrieg gegen dänische Schiffe, was zu einem rasanten Wiederaufleben der Seeräuberei in der Ostsee führte. Es wurden Kaperbriefe ausgestellt an
„[…] Scharen adliger Räuber, denen der Landraub gefährlicher und weniger gewinnbringend schien. Die Scharen Verfesteter, flüchtiger Schuldner und Übeltäter aus Stadt und Land, dazu arme Teufel, fahrendes Volk und wandernde Gesellen strömten zusammen. Mecklenburgische Adlige und Städtebürger wurden Führer, die Häfen des Landes stellten die Schiffe, Kaperbriefe gegen die drei Reiche des Nordens wurden ausgegeben […].““[21]
Im Jahre 1391 öffneten sich die Häfen von Rostock und Wismar für alle, die das Reich Dänemark schädigen wollten.[22] Zudem erlaubten Rostock und Wismar den Vitaliensern, die auf dem Wege der Kaperei künftig erworbenen Güter auf den Märkten dieser Städte zum Verkauf anzubieten.[23]
Die Hanse war in dieser Auseinandersetzung zunächst um Neutralität bemüht, um die Handelsbeziehungen während und vor allem nach Ende des Konfliktes nicht zu gefährden: Angriffe gegen die Vitalienbrüder, die mit Kaperbriefen ausgestattet die Mecklenburger tatkräftig unterstützten, wären als Parteinahme für Dänemark gewertet worden und hätten die Ausweitung des Kaperkriegs auf hansische Schiffe nach sich gezogen.
Ab 1392 spitzte sich die Situation in der Ostsee zu. Die Vitalienbrüder gefährdeten den gesamten Ostseehandel. Kauffahrer organisierten sich wieder in Konvois. Bis einschließlich 1394 kam die Handelsschifffahrt auf der Ostsee fast vollständig zum Erliegen:
„Anno 1393 [beherrschten] […] die tapferen Vitalienbrüder die See […], weshalb zu Lübeck die gesamte Schiffahrt ruhte […],“[24]
was insbesondere für die wendische Stadt hohe Gewinnausfälle bedeutete. Es mangelte an wichtigen Waren (Salz, Hering, Korn etc.). Auch Margarete war vom ruhenden Schiffsverkehr betroffen, fehlten ihr so doch Zolleinnahmen, die gerade am Ende des 14. Jahrhunderts von beträchtlicher Höhe waren.[25] Die Hanse forderte sie auf, in Verhandlungen mit Mecklenburg zu treten.
Der Überfall auf Bergen
Am 22. April des Jahres 1393 überfielen die Vitalienbrüder die Stadt Bergen – Norwegen war seit 1380 in Personalunion mit Dänemark:
„Im dem selben Jahr, […], da fuhren die Rostocker und die Wismarer Vitalienbrüder nach Norwegen und schunden den Kaufmann zu Bergen; sie nahmen viele Kleinode in Gold und Silber und kostbare Kleider, Hausrat und auch Fische. Mit dem großen Schatz fuhren sie dann, ohne zurückgehalten zu werden, nach Rostock und verkauften ihn unter den Bürgern; das war denen willkommen; den anderen Teil des Raubs fuhren sie nach Wismar und verkauften ihn dort: die Bürger beider Städte machten sich wenig Gedanken, ob die Ware rechtlich oder widerrechtlich in Besitz genommen worden war.“[26]
Hierbei zeichnet sich insbesondere der Interessenkonflikt ab, in dem die Städte Rostock und Wismar standen: Stellten sie sich mit der Hanse gegen die Vitalienbrüder und schlössen ihre Häfen, wendeten sie sich gleichsam gegen ihren Landesherrn, Albrecht von Mecklenburg. Dieser hatte auch primär den Angriff auf die norwegische Stadt zu verantworten, denn bei sämtlichen Anführern der Operation handelte es sich um mecklenburgische Fürsten:
„Die Deutschen hatten 900 Schützen; der Anführer hieß Enis, ein Deutscher, Verwandter Albrechts; ein anderer hieß ‚Maekingborg‘, ebenfalls ein Verwandter Albrechts.“[27]
Sehr wahrscheinlich handelte es sich bei jenem „Maekingborg“ um den Herzog von Stargard, Johann II., und bei „Enis“ um Johann IV. von Schwerin.[28] Bei dem Überfall auf Bergen waren also höchste mecklenburgische Adlige als Rädelsführer beteiligt.
Der Friede von Skanör und Falsterbo
Am 29. September 1393 begannen die Friedensverhandlungen in Skanör und Falsterbo, das Treffen brachte jedoch kein Ergebnis, und der Status Albrechts III. sowie Stockholms blieb unklar. Im darauf folgenden Winter versorgten die Vitalienbrüder im Auftrag der Mecklenburger das belagerte und durch Hunger von der Aufgabe bedrohte Stockholm wiederholt mit Lebensmitteln, acht große Schiffe kamen dabei zum Einsatz: „Die Hoffnung, Stockholm zu erobern, mußte Margrethe nun aufgeben.“[29] Es herrschte trotz der Annäherung zwischen Dänemark und Mecklenburg weiterhin Krieg.
Von Stockholm aus eroberte der Hauptmann Albrecht von Pecatel im Jahr 1394 für Mecklenburg mit Hilfe der Vitalienbrüder Gotland. Die Insel diente den Likedeelern in den nächsten Jahren als Operationsbasis. Im selben Jahr wurden Klaus Störtebeker und Gödeke Michels zum ersten Mal in einer englischen Klageakte als Hauptleute der Vitalienbrüder benannt.[30]
Mit dem Aufkommen Michels und Störtebekers begann eine neue Entwicklung in der Organisation der Vitalienbrüder: Zum einen schienen sich ihre Hauptleute nicht mehr primär aus mecklenburgischen Adelsgeschlechtern zu rekrutieren, zum anderen begannen die Seeräuber, autonom zu agieren. Sie nutzten zwar immer noch die Häfen der mecklenburgischen Städte, bildeten jedoch mehr und mehr eine unter eigener Regie handelnde Gemeinschaft.
Nach dem Friedensschluss von Skanör und Falsterbo am 20. Mai 1395, in dem Hanse, Deutscher Orden, Dänemark und Mecklenburg die Einstellung der Feindseligkeiten besiegelten, wurde den Städten Rostock und Wismar die Aufnahme von Vitalienbrüdern untersagt. Dies spaltete die Gruppe in viele Klein- und Kleinstgruppen, da sie nun weder über eigenes Land noch über die Unterstützung einer Territorialmacht verfügten. Die einzelnen Gruppen operierten in der Folgezeit vereinzelt sowohl in Nord- und Ostsee als auch vor Russland. Es kam hierbei zu ersten Kontakten mit den Ostfriesenhäuptlingen an der Nordsee, denn einige Vitalienbrüder zogen es vor, andere Schauplätze der Tätigkeit zu suchen, räumten die Ostsee und nisteten sich in den friesischen Küstenlandschaften ein, wo sie in den inneren Fehden, die nur selten ruhten, und in dem holländisch-friesischem Kriege, der eben begann, allen Parteien als Helfer sehr willkommen waren.[31]
Herrschaft über die Ostsee und Vertreibung
Auch nach dem Friedensschluss schwelte der Konflikt zwischen Dänemark und Mecklenburg weiter, da sich die mecklenburgische Seite mit dem Verlust der Herrschaft über Schweden nur schwer abfinden konnte. Gotland wurde nicht komplett an Margarete zurückgegeben, hier standen sich im Jahre 1395 Albrecht von Pecatel, der für die Mecklenburger die Stadt Visby hielt, und der dänische Hauptmann Sven Sture, der die übrige Insel kontrollierte, gegenüber.
Jene Gruppen der Vitalienbrüder, die Gotland nun mehr und mehr als Operationsbasis nutzten, wurden von beiden Hauptleuten angeheuert und nahmen es infolgedessen in Kauf, auch untereinander in Gefechte verwickelt zu werden.[32]
Im Sommer 1396 landete Erich, Herzog von Mecklenburg, der Sohn König Albrechts III., mit Truppen auf Gotland und besiegte im Frühjahr 1397 Sven Sture, der infolgedessen Erich einen Lehnseid leisten musste.[33] Im gleichen Jahr wurde mit der Kalmarer Union die Vereinigung der Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden unter der Regentschaft von Königin Margarete besiegelt. Diese hatte damit ihr ehrgeiziges Ziel – die Vereinigung ganz Skandinaviens unter dänischem Zepter – erreicht. Die mecklenburgischen Hoffnungen auf ein Wiedererlangen der schwedischen Krone waren damit endgültig zerschlagen.
Als am 26. Juli 1397 Herzog Erich auf Gotland verstarb, überließ er den Bewohnern der Insel seine Befestigungen. Gotland wurde zur Kolonie von Seeräubern.[34] Die Witwe Erichs, Margarete von Pommern-Wolgast, übergab Sven Sture den Oberbefehl über die Insel.
Die Situation geriet nun für Mecklenburg endgültig außer Kontrolle. Die Seeräuber unter Stures Führung bemächtigten sich vollends der Insel und starteten einen Kaperkrieg gegen jeden Kauffahrer, der die Ostsee bereiste. So schilderte Konrad von Jungingen, dass jedem Kaperfahrer für die Hälfte seiner Beute, welche an die Herzogin und Sven Sture zu entrichten war, freier Aufenthalt auf dem Land und auf den Schlössern von Gotland, Landeskrone und Sleyt, gewährt würde.[35] Es kam zu „chaotischen Zuständen“ und „einer Welle unkontrollierbarer, totaler Seeräuberei.“[36]
Gegen Ende des Jahres wollte Margarete von Dänemark mit Margarete von Pommern-Wolgast in Verhandlungen treten,[37] denn die Situation auf der Ostsee gestaltete sich zunehmend heikel. Nun geriet der Deutsche Orden in Zugzwang, denn auch für seinen livländischen Besitz und die preußischen Städte stellten die Vitalienbrüder eine Bedrohung dar. Zusätzlich drohte in den Augen der Ordensführung die Macht Margaretes überhandzunehmen, vor allem und besonders nach der Gründung der Kalmarer Union. So entschloss sich der Hochmeister Konrad von Jungingen zu einer militärischen Intervention: Am 21. März 1398 erreichte eine Ordensflotte mit 84 Schiffen, 4000 Bewaffneten und 400 Pferden Gotland.[38] Es kam zu Verhandlungen zwischen Johann von Pfirt (als Oberbefehlshaber des Unternehmens), Herzog Johann von Mecklenburg und Sven Sture. Die Übergabe der Insel an den Orden durch Johann von Mecklenburg wurde am 5. April besiegelt:
„Wir, Johan, von Gotes Gnaden herczog czu Mekelborg, greve czu Swerin, Rostogk unde czu Stargarde der lande herre, mit unsern rechten erben bekennen unde beczugen in desem keginwertigen brieve […]das unser stat Wisbue, hafen, unde lant czu Gotlant sal offen Stein unde ein offen slos sein deme homeistere des Dutschens ordens, deme gann orden unde den seinen czu alle irem orloge czu ewier czit […].“[39]
Drei Raubschlösser wurden geschleift, um die Infrastruktur für zukünftige Operationen von Seeräubern zu untergraben. Mecklenburg hatte Gotland an den Orden verloren, die Vitalienbrüder, welche die Ostsee von 1395 bis 1398 beherrschten, wurden in der Folgezeit vertrieben: „Die lübischen und preußischen Flotten machten energisch Jagd auf die Seeräuber, so daß die Ostsee im Jahre 1400 gänzlich gesäubert war.“[40]
Die Vitalienbrüder in der Nordsee
Ostfriesland, das sich westlich von der Ems bis zur Weser im Osten erstreckt und im Norden an die Nordsee grenzt, bot in mehrfacher Hinsicht ein ideales Refugium für die aus der Ostsee flüchtenden Vitalienbrüder: Zum einen waren hier zahlreiche Verstecke zu finden, begünstigt durch die verwirrende Topographie der Landschaft, die weiträumig von Flüssen, Deichen und Moorlandschaften durchzogen war: „Meeresarme durchziehen das Land, kleine Inseln und Buchten kennzeichnen die Küstenlinie.“[41] Die Gezeiten, die Priele, die Tiefs, die komplizierten Strömungsverhältnisse, die möglichen Landeplätze und Schlupfwinkel machen deutlich, dass sich gerade dieser Küstenstrich für kenntnisreiche Seeräuber als Rückzugsgebiet anbot.[41] Zum anderen sorgte die politische Verfasstheit Ostfrieslands für beste Bedingungen für die Likedeeler, die ihrer Operationsbasis beraubt worden waren.
Die Ostfriesenhäuptlinge
Ostfriesland unterstand keiner singulären Herrschaft, vielmehr war es in Gemeinden und Territorien unterschiedlicher Größe zersplittert, über die sogenannte „hovetlinge“, also Häuptlinge, herrschten. Diese standen in immer wechselnden Koalitionen in Fehden untereinander, Illoyalitäten, rasche Parteiwechsel einzelner Häuptlinge traten immer wieder zutage.[42]
Da den Ostfriesen Lehnsherrschaft ebenso unbekannt war wie Steuern, mussten die Anführer anderweitig die Finanzierung ihrer Streitigkeiten organisieren: Die Häuptlinge bestritten eben einen großen Teil ihres Lebensunterhalts durch den Seeraub und gewannen auf diese Weise die nötigen Mittel, um Krieg zu führen.[43]
Bereits im 12. und 13. Jahrhundert hatten sich die „freien Friesen“, so die Selbstbezeichnung, in genossenschaftsähnlichen Landesgemeinden organisiert, in denen prinzipiell jedes Mitglied gleichberechtigt war. Diese grundsätzliche Gleichberechtigung galt für alle Eigentümer von Hofstellen und zugehörigem Land in ihren jeweiligen Dörfern und Kirchspielen.[44] Die öffentlichen Ämter der Richter oder „Redjeven“ wurden durch jährliche Wahlen bestimmt. Doch de facto stachen einige „nobiles“ aus dieser „universitas“ hervor: Insbesondere die Mitglieder der großen und reichen Familien besetzten die öffentlichen Ämter. Statussymbole der nobiles waren ab dem 13. Jahrhundert Steinhäuser (als Vorläufer der späteren Häuptlingsburgen) und kleine Söldnerheere. Im späten 13. Jahrhundert und bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts führte eine Vielzahl von Krisen (Hungersnöte, Sturmfluten, mangelnder Absatzmarkt für Waren, Seuchen) zu einem Verlust der öffentlichen Ordnung, die Macht der nobiles verfestigte sich und das ostfriesische Häuptlingswesen begann Gestalt anzunehmen: Die Häuptlinge lernten es rasch, ihre Autorität nicht mehr vom Willen der Gemeinden abzuleiten, sondern als dynastischen Besitz zu verstehen und zu verteidigen.[45]
Zu den größten Häuptlingsfamilien um 1400 gehörten die aus dem Brokmerland stammende Familie tom Brok, die aus Emden stammenden Abdenas sowie die Familie um den Osterhusen beherrschenden Folkmar Allena. Eine besondere Position nahm auch der Häuptling der Rüstringer Friesen sowie über Bant und Wangerland, Edo Wiemken der Ältere, ein. Dieser tat sich besonders als Gastgeber der Vitalienbrüder hervor,[46] weshalb sich eine erste Strafexpedition der Hanse besonders gegen ihn richtete: Er musste am 4. Juli 1398 Lübeck, Bremen und Hamburg zusichern, dass er den Vitalienbrüdern seinen Schutz entziehen und sie aus seinem Gebiet weisen würde.[47] Dass solche Versprechen wenig zu bedeuten hatten, beweist die weitere Korrespondenz zwischen den hovetlingen und der Hanse.
Die ohnehin komplizierte Lage wurde noch zusätzlich diffizil durch die Expansionsabsichten Albrechts von Bayern, der gleichzeitig Graf von Holland war und von dort ausgehend in östliche Richtung Druck auf die Häuptlinge ausübte. Alles in allem kann die Unübersichtlichkeit der Territorialpolitik Ostfrieslands gar nicht überschätzt werden.
Zusammenarbeit zwischen Häuptlingen und Vitalienbrüdern
Aus der Zusammenarbeit zogen beide Seiten einen Nutzen: Die Vitalienbrüder brachten Kriegserfahrung und Flexibilität mit sich, vor allem aber war ihr Einsatz im Unterschied zu dem gewöhnlicher Söldner enorm günstig, machten sie doch Beute auf eigene Rechnung und verlangten keinen Sold und keine Verpflegung. Die Häuptlinge dagegen boten einen sicheren Unterschlupf vor Verfolgung sowie einen Absatzmarkt für gekaperte Waren – beides grundlegende Voraussetzungen für den Aufbau einer neuen Operationsbasis.
Bereits im Jahre 1390 ist ein Gefecht zwischen Hamburgern und Vitalienbrüdern dokumentiert,[48] und auch in den Folgejahren arbeiteten Häuptlinge vereinzelt mit Seeräubern zusammen.[49] Zu einem signifikanten Anstieg der Aktivitäten kam es nach der oben skizzierten Vertreibung der Vitalienbrüder von Gotland durch den Deutschen Orden im Jahre 1398.
Bei den Kaperfahrten auf Nordsee und Weser blieben auch hansische und holländische Schiffe nicht von Überfällen verschont, so dass die Vitalienbrüder ein weiteres Mal zu einem drängenden Problem der Hanse, diesmal insbesondere der Städte Hamburg und Bremen, wurden.
So schilderte beispielsweise das Brügger Hansekontor am 4. Mai 1398 einen Vorfall, der sich auf der Nordsee ereignet hatte:
„[…] so hebben de vitalienbruderes, dye Wyczold van dem Broke in Vresland uphold unde huset kort vorleden eyn schif genomen in Norweghen, […] de sulven vitalienbruderes zeghelden uyt Norweghen vorby dat Zwen in de Hovede, unde dar so nemen se wol 14 off 15 schepe […]. Vort zo nemen ze up de zulven tiid eyn schip, dat uyt Enghelande qwam unde wolde int Zwen seghelen, dar inne dat koplude van unsen rechte grot gut vorloren hebben an golde unde an wande, unde de sulven koplude hebben ze mit en gevoret in Vreslande […].“[50]
Einem dieser Kaufleute, Egghert Schoeff, gaben die Vitalienbrüder zudem den Auftrag auszurichten, sie seien „Godes vrende unde al der werlt vyande, sunder der von Hamborch unde der van Bremen, want se dar mochten komen unde aff unde to varen, wanner dat ze wolden.“[51] Daraufhin forderten die flandrischen Städte Gent, Brügge und Ypern in einem Schreiben keine drei Wochen später die Hansestädte auf, energisch gegen die Vitalienbrüder vorzugehen und Hamburg und Bremen den Ankauf der geraubten Waren zu verbieten.[52] Die beiden Städte versuchten sich von den Vorwürfen der Kollaboration frei zu machen und legten infolgedessen ein besonders energisches Verhalten an den Tag.
Es wurde klar, dass mit der Vertreibung der Vitalienbrüder aus der Ostsee das Problem der Hanse nicht gelöst war, es hatte sich lediglich an einen neuen Ort verlagert: Es kam im Juni 1398, wie oben schon kurz angedeutet, zur ersten großen Operation der Hanse gegen die Seeräuber im Gebiet des Jadebusens. Auch während des Jahres 1399 operierten Lübecker Schiffe unter dem Kommando des Ratsherren Henning von Rentelen vor der ostfriesischen Küste.
Am 2. Februar 1400 wurde auf einem kleinen Hansetag zu Lübeck die Entsendung von elf bewaffneten Koggen mit 950 Mann in die Nordsee beschlossen.[53] Keno II. tom Brok reagierte umgehend, indem er sich in einem auf den 25. Februar datierten Schreiben an die Hansestädte für die Beherbergung der Vitalienbrüder entschuldigte und ihre sofortige Entlassung versprach.[54] Da die entlassenen Vitalienbrüder allerdings sogleich bei Kenos Gegnern Hisko von Emden und Edo Wiemken sowie beim Grafen von Oldenburg Anstellung fanden,[55] heuerten auch Keno tom Brok und seine Bundesgenossen, allen voran Folkmar Allena, Enno Haytatisna und Haro Aldesna, in der Folgezeit wieder Seeräuber an. Eine „Rüstungsspirale“ hatte sich gebildet, es war dem einzelnen Häuptling kaum mehr möglich, auf die Hilfe der Vitalienbrüder zu verzichten, weil er mit seiner eigenen Hausmacht unmöglich das militärische Potential der Seeräuber, das seinen Gegnern zur Verfügung stand, ausgleichen konnte.[56]
Lübeck drängte zur Tat: Am 22. April stach die verabredete Hanseflotte von Hamburg aus mit Kurs auf Ostfriesland in See. Am 5. Mai traf sie auf der Osterems auf von Folkmar Allena beherbergte Vitalienbrüder und besiegte diese. Hierbei kamen 80 Seeräuber zu Tode, 34 wurden gefangen genommen und später hingerichtet.[57]
Die Hanse verlieh ihrem Ansinnen Nachdruck, indem sie sich am 6. Mai die Stadt und das Schloss Emden von Hisko übereignen ließ. Damit wurde die Basis für weitere Operationen gelegt; von hier ausgehend wurden weitere Schlösser und Burgen erobert.[58] Diese Unnachgiebigkeit ließ das Unternehmen zu einem vollen Erfolg für die Hanse werden. Am 23. Mai bestätigten alle Häuptlinge und Gemeinden Ostfrieslands, nie wieder Vitalienbrüder aufzunehmen.[59] Ein Teil der Seeräuber verließ daraufhin Ostfriesland und suchte sich neue Verbündete: Ein Schreiben zweier Schiffshauptleute an Hamburg vom 6. Mai gibt an, dass zwei Hauptleute, Gödeke Michael und Wigbold mit 200 Wehrhaften nach Norwegen gesegelt seien.[60] Auch Herzog Albrecht von Holland nimmt am 15. August des Jahres 114 Vitalienbrüder auf, unter acht Hauptleuten auch einen „Johan Stortebeker“.[61] Ausgestattet mit holländischen Kaperbriefen machten die Vitalienbrüder Helgoland zum Ausgangspunkt ihrer Operationen.
Das Ende der Vitalienbrüder
Ihr eigentliches Ziel erreichte die Hanse nicht: Sie konnte weder Ostfriesland dauerhaft befrieden noch das Seeräuberproblem nachhaltig lösen. Wieder waren diese ihnen, wenn auch diesmal unter einem höheren Blutzoll, entwichen, die Führungsriege gar vollständig.
Nun jedoch setzte ihnen Hamburg direkt und entschlossen nach und stellte zumindest jenen Teil der Seeräuber, der gen Helgoland gezogen war. Das genaue Datum und die Hintergründe dieser Expedition sind nicht überliefert, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sie zwischen dem 15. August und 11. November des Jahres 1400 durchgeführt wurde.[62] Die Operation unterstand der Leitung zweier Hamburger Ratsherren, Hermann Lange und Nikolaus Schoke, wie die Hamburger Kämmereirechnungen aus dem Folgejahr bestätigen: Für die Reise der Herren Hermann Lange und Nikolaus Schoken nach Helgoland im vergangenen Jahr gegen die Vitalienbrüder: zusammen 57 Pfund.[63] Dazu die Rufus-Chronik:
„In deme sulven jare vochten de Engelandesvarer van der Stad Hamborch uppe der zee myt den zeeroveren, de syk vitalyenbroder nomeden, unde behelden den seghe jeghen se. se slughen erer beth den 40 doet by Hilghelande unde vinghen erer by 70. de brachten se myt syk to Hamborch, unde leten en alle de hovede afflan; (...) desser vitalien hovetlude weren ghenomet Wichman und Clawes Stortebeker.[64] (Übersetzung nach Seebald: Im selben Jahr (1402) fochten die Englandfahrer der Stadt Hamburg auf See mit den Seeräubern, die sich Vitalienbrüder nannten, und errungen einen Sieg über sie. Bei Helgoland erschlugen sie bis zu 40 von ihnen und nahmen 70 gefangen. Die führten sie mit sich nach Hamburg und ließen sie alle enthaupten (...) Die Hauptleute dieser Vitalienbrüder hießen Wichmann und Klaus Störtebeker.[65])“
Die Englandfahrer, wie Lange und Schoke in der zeitgenössischen Quelle bezeichnet werden, bildeten aus gutem Grund das Rückgrat im Kampf gegen Seeräuberei in der Nordsee, da unter diesem im letzten Jahrhundertviertel unerträglich ausgearteten Übel der Englandhandel am meisten hatte leiden müssen.[66]
Im Jahr 1401 ging Hamburg gegen Störtebekers alten Weggefährten Gödeke Michels vor. Wieder wird das Datum durch Kämmereirechnungen bestätigt: „Für die Reise der Herren Nicolaus Schoke und Hindrik Jenevelt über die Weser gegen die Vitalienbrüder 230 Pfund und 14 Schillinge.“[67] Drei Schiffe wurden ausgerüstet und Michels und seine Mannschaft gestellt:
„(...) dar na nicht langhe quemen de sulven Enghelandesvarer uppe eynen anderen hupen der zeeroveren unde slughen syk myt en (...) unde vynghen erer by 80 unde vorden se myt syk to Hamborch; dar worden se unthovedet (...). desser hovetmanne weren gheheten Godeke Michels unde Wygbold, ein meyster an den seven kunsten.[68] (Übersetzung nach Seebald: Nicht lange danach stießen dieselben Englandfahrer auf eine andere Seeräuberbande und kämpften mit ihnen. Und Gott gab doch den tüchtigen Helden den Sieg, denn sie ermordeten viele von ihnen, fingen etwa 80 und brachten sie mit sich nach Hamburg. Dort wurden sie enthauptet (...) Ihre Hauptleute hießen Godeke Michels und Wigbold, ein Magister der sieben Künste.[69])“
Mit der Hinrichtung Michels' hatte man den bedeutendsten Anführer der Vitalienbrüder unschädlich gemacht.[70] Hier ist ein weiterer Wendepunkt in der Geschichte der Likedeeler erreicht. Auch wenn Seeräuber in der Folgezeit weiterhin Schiffe der Hanse aufbrachten,[71] die Bezeichnung „Vitalienbruder“ bereits zu einem Synonym für den Seeräuber an sich geworden war und von daher auch weiterhin in den Quellen der folgenden Jahre auftaucht, so sind diese Unternehmungen doch nicht mehr in Zusammenhang mit den Wirren der dänischen Erbfolge oder des ostfriesischen Häuptlingswesens zu setzen: Piraterie, sowohl in der Nord- als auch in der Ostsee, hat es vor und auch nach den hier geschilderten Ereignissen gegeben. Es besteht aber keine kausale Kontinuität mehr zu der Geschichte der Vitalienbrüder, die 1391 auf den Plan traten und bis einschließlich 1401 eine immense Bedrohung für die Handelsschifffahrt darstellten. Mit einer zweiten Plünderung Bergens im Jahre 1429 ist zwar noch eine letzte herausragende Operation der Seeräuber überliefert, einen definitiven Schlusspunkt in ihrer Geschichte stellt aber die große Strafexpedition Hamburgs gegen Sibet Lubbenson, den Enkel Edo Wiemkens, dar: Simon van Utrecht, der bereits bei der Überwältigung Gödeke Michels' mitgewirkt hatte, brach im Jahr 1433 mit 21 Schiffen gen Emden auf und eroberte die Stadt.
1435 beschloss der Rat der Stadt Hamburg eine Landesherrschaft über das eroberte Emden zu etablieren, als die offensichtlich stabilste Gewähr gegen ein von Häuptlingen begünstigtes Wiederaufleben von Seeräuberei[72] und schleifte die nach zähen Kämpfen errungene Sibetsburg (auf dem Gebiet des heutigen Wilhelmshaven), die frühere Residenz Edo Wiemkens.
Nach 1435 schwinden die Zeugnisse der Vitalienbrüder in der Geschichtsschreibung, ihr Ende war erreicht. Dies bedeutete für die Hanse allerdings nicht die Lösung ihres „Seeräuberproblems“. Kaperfahrt, Seeräuberei und Piraterie existierten auch weiterhin – sie überlebten die Hanse.
Vitalienbrüder und Hanse – Wirtschaftliche Aspekte
Seeraub und seine Bekämpfung als Kostenfaktor
Die tatsächlichen Dimensionen des Schadens, die der Seeraub der Vitalienbrüder der Hanse zufügte, sind heute nur noch schwer zu bestimmen. Zu häufig dokumentieren zeitgenössische Quellen nur „großen Schaden“ oder „viel Ungemach“ durch Einwirken der Vitalienbrüder.
Allein der Verlust von Schiffen stellte den ersten großen Posten in dieser Rechnung: Der Wert einer Kogge kann bei mehreren hundert Pfund veranschlagt werden, in lübischer Währung über 1000 Mark. Es sind Fälle überliefert, bei denen Kaufleute ihre zuvor geraubten Schiffe, teilweise gar die Ladung, von den Likedeelern zurück kaufen konnten.[73] Eine weitere Einnahmequelle für die Seeräuber stellten Lösegeldforderungen für gefangen genommene und entführte Kaufleute dar.
Nicht nur der tatsächliche Seeraub, also das aktive Kapern von Kauffahrern, wirkte sich dabei negativ auf die Wirtschaft der Hanse aus: Auch die Tatsache, dass zeitweilig weite Strecken der Nord- und Ostsee nicht ohne Weiteres befahrbar waren, sorgte für immensen Schaden beim hansischen Kaufmann und für Preissteigerungen bis zum Zehnfachen des vorherigen Warenwerts:
„[Die Vitalienbrüder] bedrohten leider die ganze See und alle Kaufleute, ob Freund ob Feind, so daß die Schonenfahrt wohl drei Jahre darniederlag. Darum war in diesen Jahren [ab 1392] der Hering sehr teuer.“[74]
Doch auch die Gegenwehr, beispielsweise unter der Zuhilfenahme von Friedeschiffen, bedeutete einen hohen Kostenaufwand für die hansischen Städte. Um solche militärischen Interventionen zu finanzieren, erhoben die Städte ein Pfundgeld, eine Art Sondersteuer auf die in den Häfen der Hanse gehandelten Waren. Der erste Beschluss für das Erheben eines solchen Pfundgeldes ist für das Jahr 1377 überliefert. Für das Folgejahr sind allein für die Friedeschiffe von Lübeck und Stralsund Kosten von über 10.000 Pfund dokumentiert.[75] Jedoch wurde das Pfundzoll, wenn überhaupt, nur in Zeiten akuter Bedrohung durch die Vitalienbrüder oder vor großen Operationen akzeptiert.
Immer wieder weigerten sich einzelne Städte, Pfundzölle zu erheben oder hielten sich gar komplett aus der Finanzierung der Kriegsflotten heraus. Allen voran sei an dieser Stelle ein weiteres Mal auf den Interessenkonflikt der Städte Rostock und Wismar hingewiesen, die sich in dieser Hinsicht besonders hervor taten: Ein entschiedenes Eintreten für die Belange der Hanse hätte ihr Landesherr, Albrecht von Mecklenburg, als Verrat begriffen. Daher übten sich beide Städte in Zurückhaltung, wann immer es um die Bekämpfung der seeraubenden Verbündeten ihres Herrschers ging. Die Hanse nahm jedoch mit Blick auf die territorialpolitisch diffizile Situation Rücksicht und sah von schweren Strafen gegen die beiden Städte ab.
Auch zwischen Bremen und Hamburg sowie Lübeck und den preußischen Städten, beziehungsweise der Leitung des Deutschen Ordens, sind immer wieder Meinungsverschiedenheiten dokumentiert. Diese führten wiederholt zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Hanse und schließlich zum Suchen neuer Wege bei der Bekämpfung der Seeräuber: Hier sei auf die oben ausführlicher geschilderte Übertragung der Aufgabe auf den Privatmann Wulf Wulflam verwiesen.
Damit sind jedoch längst nicht sämtliche Kosten der Bekämpfung der Seeräuber abgedeckt: So sind Fragen der Logistik (Kosten für Sendeboten, Zahlungen und Verträge mit nicht-hansischen Landesherren, Schadenersatzzahlungen, Kosten für Ausliegerschiffe etc.) bislang gar nicht berücksichtigt. Die Rekonstruktion solch weit verzweigter Ausgaben gestaltet sich außerordentlich kompliziert.
Geraubte Waren und Absatzmärkte
Zu einem weiteren Streitpunkt innerhalb der Hanse entwickelte sich die Praxis einzelner Städte, den Vitalienbrüdern in ihren Häfen einen Absatzmarkt für ihr Kapergut bereitzustellen. An erster Stelle ist hierbei der Vorwurf gegen Hamburg und Bremen zu nennen, der nach dem Überfall auf den Danziger Kaufmann Egghert Schoeff im Jahre 1398 im Raume stand: Nachdem ihn die Vitalienbrüder ausrichten ließen, sie seien „Gottes Freunde und aller Welt Feinde, mit Ausnahme der Städte Hamburg und Bremen“, da sie dort jederzeit ihre Waren verkaufen könnten, sahen sich beide Städte mit erheblichem Misstrauen konfrontiert. Tatsächlich eigneten sich Hamburg und Bremen ebenso wie die einzelnen Märkte in Ostfriesland oder Groningen bestens zum Verkauf von Raubgut. Immer wieder sind diese als Anlaufstellen für Seeräuberschiffe dokumentiert.[76] Doch auch im Binnenland boten sich den Vitaliensern Absatzmärkte, allen voran die Städte Münster und Osnabrück.[77]
Rechtliche Aspekte des Seeraubs um 1400
Als serovere, Seeräuber, galt, wer aus eigener Initiative, das heißt ohne staatliche Ermächtigung, und auf eigene Rechnung andere Schiffe in räuberischer Absicht überfiel.[78] Staatliche Ermächtigung bedeutete in diesem Falle, in Besitz eines Kaperbriefes zu sein. Bezogen auf die Vitalienbrüder implizierte dieser die Anerkennung der Kaperfahrer als Verbündete des Herzogs zu Mecklenburg. Das Aufbringen feindlicher Schiffe war damit vom Kriegsrecht legitimiert. Folglich handelte es sich bei den Vitaliensern per definitionem nicht mehr um Seeräuber oder Piraten.
In der historischen Wirklichkeit verschwammen diese Grenzen jedoch stark: Zum einen hielten sich die Vitalienbrüder nicht an die Satzungen der Kaperbriefe und enterten auch Schiffe, die nicht direkt in den dänisch-mecklenburgischen Krieg involviert waren.[79] Zum anderen akzeptierten die Hansestädte den Status der Kapererlaubnis in den seltensten Fällen oder ignorierten ihn schlicht: Für sie handelte es sich bei den Vitaliensern um bloße Piraten, die es aufs Schärfste zu bekämpfen galt.
Dementsprechend hart war nach heutigem Empfinden das Strafmaß für Seeräuberei: Enthauptung durch das Schwert. Nach der mittelalterlichen Rechtsnorm galt diese Hinrichtung jedoch als die einzig ehrenvolle.[80] Sie war für gewöhnlich adligen Delinquenten vorbehalten. Alle in Hamburg üblichen Strafen sind in einer Illustration des Hamburger Stadtrechts von 1479 dargestellt: Das Schließen der Beine in einen Stock, Rädern, Hängen, Prangerstehen, Stäupen und schließlich die Enthauptung.[81]
Dass Hamburg als unnachgiebiger Widersacher der Vitalienbrüder dennoch nicht von dieser Vollstreckungsmethode abwich, kann als letztes Zugeständnis an die eigentlich vom Kriegsrecht Legitimierten interpretiert werden. Zudem hielt das Strafrecht den Vitalienbrüdern das Kriterium der Offenheit zugute: Ein heimlicher Angriff, beispielsweise der Diebstahl ab 16 Schillingen, wurde mit Erhängen geahndet.[82]
In der Regel wurden die Köpfe der Hingerichteten auf dem Hamburger Grasbrook auf Pfähle gesteckt und längs der Elbe aufgestellt. Hiermit sollte ein Abschreckungspotential aufgebaut werden und eine Warnung an sämtliche die Stadt anlaufende Schiffe ausgesprochen werden: Hamburg hatte den Vitalienbrüdern den Kampf angesagt.
Die Schiffe der Vitalienbrüder
Schiffstypen: Kogge und Holk
Vitalienbrüder und Hanse nutzten die gleichen Schiffe bei ihren jeweiligen Unternehmungen. Dass die Seeräuber schnellere Schiffe benutzten, kann nach Erkenntnissen der Forschung nicht bestätigt werden, die höhere Schnelligkeit kann jedoch auf geringere Ladung und den damit einhergehenden Geschwindigkeitsvorteil zurückgeführt werden. Die zwei bedeutendsten und größten Schiffstypen für die Seefahrt waren die Kogge und der Holk.
Die Kogge konnte aufgrund ihres flachen Kiels nicht gegen den Wind kreuzen, da die seitliche Abdrift sonst zu groß wurde. Dies führte bei widrigen Windverhältnissen zu langen Wartezeiten, die die Kaufleute aufgrund der dennoch zu leistenden Heuer für die Seeleute teuer zu stehen kamen. Besonders aufschlussreich bei der Erforschung dieses Schifftyps sind die Erkenntnisse, die nach der Bergung einer Hansekogge in Bremen am 9. Oktober 1962 gewonnen werden konnten.[84]
Für den später eingesetzten Holk war aufgrund seines tiefer reichenden Kiels mit weniger Abdrift zu rechnen.[85] Den entscheidenden Nachteil hinsichtlich der Navigierfähigkeit teilte er jedoch mit der Kogge: Beide bedienten sich eines einzelnen, riesigen Rahsegels von circa 200 m², dessen Bedienung insbesondere bei starkem Wind eine große Mannschaft erforderte.[86]
Beide Schiffe hatten gemein, dass sie besonders hochbordig gebaut waren. Dies bedeutete für die Seeräuber, dass sie zum erfolgreichen Entern der Kauffahrer mindestens ebenso hochbordige Schiffe benötigten. Ein Betreten des jeweils anderen Decks wäre sonst nicht möglich gewesen.
Besatzung
Die höhere Zahl der Besatzung sorgte für die Überlegenheit der Likedeeler im Vergleich zum gemeinen Kauffahrer. Für ein der Bremer Hansekogge hinsichtlich der Größe vergleichbares Schiff ist eine Mannschaft von einem Schiffer sowie zehn Mann überliefert.[87] Hinzu kamen noch sogenannte Jungknechte, also Schiffsjungen, die jedoch nicht zur Mannschaft gezählt wurden. Später kamen auch spezialisierte Seeleute zum Einsatz, so zum Beispiel Schiffszimmerleute oder Segelmacher. Auf Handelsschiffen waren zudem Kaufleute oder Schreiber Teil der Besatzung. Die Mannschaften von Seeräubern waren vermutlich doppelt so groß wie die der Handelsschiffe, um bei Entergefechten den entscheidenden Vorteil zu haben: Es dürfte sich im Schnitt um 30 bis 40 Männer gehandelt haben.[88]
So entstand eine Art „Rüstungsspirale“, denn die Überlegenheit der Vitalienbrüder im Bereich der Mannschaftsstärke hatte zur Folge, dass die Hanse auf ihren Friedeschiffen zu noch größeren Besatzungen griff. Für das Jahr 1368 ist eine Hamburger Kogge mit 20 Seeleuten und 60 Kriegern an Bord bestätigt.[89] Später wurden Kriegsschiffe mit bis zu 100 Mann eingesetzt. Hierbei ist deutlich ersichtlich, dass eben nicht die Art der Schiffe ausschlaggebend für den Erfolg eines Seegefechts war, sondern die Ausrüstung des jeweiligen Schiffes mit Blick auf Besatzung und Bewaffnung.
Bewaffnung
Für kriegerische Einsätze wurden die Schiffe umfangreich mit Armbrüsten bestückt. Hierzu waren feste Geschütze am Vorder- und Achterkastell der Koggen und Holke sowie in Mastkörben angebracht. Auch der Einsatz von Feuerwaffen ist überliefert, jedoch fehlte den damit abgefeuerten Geschossen der notwendige Drall, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten.[90] Die wesentlich zielgenaueren Armbrüste wurden effektiv vor Beginn des Enterkampfs eingesetzt, um möglichst viele Gegner schon im Vorfeld des eigentlichen Gefechts kampfunfähig zu machen. Im Enterkampf selbst kamen neben Dolchen und Keulen vor allem Schwerter und Beile zum Einsatz.
Im Batteriedeck aufgestellte, schwere Schiffsgeschütze wurden erst ab 1493 genutzt, als sich verschließbare Stückpforten durchzusetzen begannen.[91] Sie spielten also zur Zeit der Vitalienbrüder noch keine ausschlaggebende Rolle. Fest montierte Wurfmaschinen, sogenannte Bliden, konnten dagegen auch höhere Entfernungen zwischen den Schiffen überwinden.
Weitere Schiffstypen
Neben Koggen und Holken kamen auch kleinere Schiffe zum Einsatz, die zur Unterstützung den großen Seglern zur Seite gestellt wurden. Hier ist vor allem die einmastige Schnigge zu nennen, die aufgrund ihrer Wendigkeit und höheren Geschwindigkeit den Koggen an Manövrierfähigkeit überlegen war. Besonders bei Unternehmungen in flachen Gewässern oder bei Landungen kamen die Schiffe mit geringem Tiefgang zum Einsatz. Zum Enterkampf dagegen waren sie wegen ihrer niedrigen Bordwände nicht geeignet, weswegen sie häufig mit Armbrüsten bestückt zu kapernde Schiffe auf die Koggen und Holke der Vitalienser zutreiben sollten. Zu Kriegseinsätzen konnten Schniggen bis zu 55 Bewaffnete transportieren.[92]
Rezeption
Die gesellschaftliche Rezeption des Phänomens „Vitalienbrüder“ hat eine radikale Wandlung erfahren: Bedeutete ihr Name dem mittelalterlichen Zeitgenossen noch Unheil und Gefahr, hat im Laufe der Zeit eine positive Umdeutung ihrer Motive bis hin zur idealistischen Verklärung stattgefunden. Hierbei ist natürlich zuerst auf die Legende von Störtebeker hinzuweisen, der ein Symbol für Widerstand, Wagemut, Selbstbestimmtheit und Abenteuer geworden ist. Der Mythos lebt fort in einer unüberschaubaren Menge an historischen und Abenteuerromanen, an Comics, Filmen, Liedern und nicht zuletzt auch an den jährlich stattfindenden „Störtebeker-Festspielen“ auf der Insel Rügen.
Die Vitalienbrüder treten dabei zurück hinter Klaus Störtebeker, ebenso historisch bedeutendere Anführer des Bundes wie Gödeke Michels oder Magister Wigbold. Hier ist eine klare Trennlinie zwischen historischer Forschung einerseits und traditioneller Überlieferung andererseits zu ziehen: War Störtebeker, solange man zeitgenössischen Quellen folgt, nur einer unter vielen Hauptleuten der Vitalienser, so macht die Sage ihn zu dem Anführer und Repräsentanten.
Eine ähnliche Verschiebung ist übrigens auch auf der Seite der Piratenjäger zu beobachten: Hier verdrängte im Laufe der Zeit Simon von Utrecht die eigentlichen Anführer der Englandfahrer, Hermann Lange, Nikolaus Schoke und Hinrik Jenefeld.
Die Verklärung und Umdeutung der realen Ereignisse begann bereits bei den Chronisten des Mittelalters, beeinflusst von den Sagen und Legenden der Bevölkerung. Diese Tradition setzte sich fort: Im Jahr 1701 führte der Komponist Reinhard Keiser das erste Mal eine Oper mit dem Thema des Störtebeker-Mythos in Hamburg auf, 1783 ist am Hamburger Stadttheater ein Stück mit dem Namen Claus Storzenbecher dokumentiert.[93] Im 18. Jahrhundert entstanden eine weitere Oper, zwei Theaterstücke, fünf poetische und neun Prosawerke.[94]
Der Trend setzte sich ab 1900 fort: Bis einschließlich 1945 sind vier Balladen, ein Radiohörspiel, zehn Theaterstücke und 18 Romane und Erzählungen über Störtebeker und die Vitalienbrüder überliefert.[94] Auch die Nationalsozialisten instrumentalisierten den Mythos um Störtebeker. Er wurde in die Propaganda Hitlerdeutschlands eingeflochten als „nordischer Rebell“ mit dem Recht zur „Plünderung der Nachbarvölker“.
Auch unter marxistischer Interpretation, welche die nationalsozialistische Rezeption berichtigen wollte, scheint der Mythos in Willi Bredels Roman Die Vitalienbrüder[95] zu funktionieren: Die hansischen Patrizierfamilien wurden als herrschende Klasse stilisiert, der sich der proletarische Held Störtebeker mit seinen sozialistisch gesinnten Likedeelern entgegenstellte. Auch hier wurde die Lesart von Störtebeker als einem „Robin Hood der Meere“ implizit weiter konstruiert. Diese setzte sich fort in der Planung einer Theaterinszenierung des Zentralkomitees der DDR aus dem Jahre 1959 unter dem Titel Klaus Störtebeker. Henning zitiert den Epilog des Stückes wie folgt:
„Störtebeker – Göstemichel – / Wigbold, wat liggt an – / Sozialismus voraus – / Die Arbeiter / Herren im eigenen Haus.“[96]
Diese Aufführung legte den Grundstein für die heutigen „Störtebeker-Festspiele“ auf der Insel Rügen.
Ebenfalls in einem politischen Zusammenhang muss auch die „Enthauptung“ des Hamburger Simon-van-Utrecht-Denkmals an der Kersten-Miles-Brücke im Jahr 1985 betrachtet werden. Die zerstörte Statue wurde mit politischen Graffiti versehen. Diese forderten auf, Banden zu bilden, bescheinigten der Piraterie eine große Zukunft oder drohten „Wir kriegen alle Pfeffersäcke!“[97] in Referenz an das zeitgenössische Schimpfwort für die reichen Hansekaufleute. Die Aktion stand in engem Zusammenhang mit der Beteiligung Simons van Utrecht an der Festnahme und Enthauptung Gödeke Michels: „Nicht alle Köpfe rollen erst nach 500 Jahren!“
Im Mythos leben die Vitalienbrüder und ihr prominenter Anführer fort. Diese Legenden sind aber keinesfalls mit den historischen Gegebenheiten zu verwechseln. Sie sind nicht Zeugen der Geschichte selbst, sondern vielmehr ihrer historischen Rezeption und der Bedürfnisse der einzelnen Menschen zu ihrer jeweiligen Zeit: Die Legenden von Kaperfahrt und Vitaliensern werden zur Projektionsfläche für Fluchtpunkte aus dem Alltag und haben infolgedessen nur noch sehr wenig gemein mit der historischen Vorlage. Diese tritt in den Hintergrund und macht Platz für den Wunsch nach Freiheit und Abenteuer.[98]
Quellen
- Detmar-Chronik. In: Chronik des Franziskaner Lesemeisters Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken, I. Teil, hrsg. v. F.H. Grautoff, Hamburg 1829.
- Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage 1256–1430, Abt. I, Bde. 2–4, hrsg. v. Hansischer Geschichtsverein, Leipzig 1872–1877.
- Hansisches Urkundenbuch,. Bd. IV, hrsg. v. Karl Kunze, Halle a. d. Saale 1896.
- Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 1350–1470,. Bd. I und II, bearb. v. Karl Koppmann, Hamburg 1829 und 1873.
- Chronik des Reimar Kock, in: Chronik des Franziskaner Lesemeisters Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken, I. Teil, hrsg. v. F. H. Grautoff, Hamburg 1829.
- Rufus-Chronik. In: Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bd. 28, hrsg. v. Historische Commission der Königl. Academie der Wissenschaften, Leipzig 1902.
- Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Abt. I, Bd. 4, hrsg. v. Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Lübeck 1873.
- Voyages in eight Volumes, Bd. I, hrsg. v. Richard Hakluyt, London und New York 1907.
Literatur
- Matthias Blazek: Seeräuberei, Mord und Sühne – Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292–1949. ibidem, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8382-0457-4.
- Antje Sander: Schlupfwinkel, Lagerplätze und Märkte. Anmerkungen zur Topographie des Jadebusens um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 169–180.
- Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 153–168.
- Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co.: die Blütezeit der Seeräuber in Nord- und Ostsee. Verlag Die Hanse, Hamburg 2000, ISBN 3-434-52573-4.
- Dieter Zimmerling: Die Hanse – Handelsmacht im Zeichen der Kogge. 2. Auflage. Düsseldorf und Wien 1979, ISBN 3-8112-1006-8.
- Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts, 2 Bde., 3. Auflage. de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-017041-8.
- Fritz Teichmann: Die Stellung und Politik der hansischen Seestädte gegenüber den Vitalienbrüdern in den nordischen Thronwirren 1389–1400. Berlin 1931.
- Hartmut Roder: Klaus Störtebeker – Häuptling der Vitalienbrüder. In: ders. (Hrsg.): Piraten: die Herren der sieben Meere; [Katalogbuch zur Ausstellung „Piraten. Herren der Sieben Meere“]. Ed. Temmen, Bremen 2000, ISBN 3-86108-536-4, S. 36–43.
- Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. In: Wilfried Ehbrecht: Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 85–110.
- Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. In: Ralf Wiechmann (Hrsg.): Klaus Störtebeker: ein Mythos wird entschlüsselt. Fink, Paderborn/ München 2003, ISBN 3-7705-3837-4, S. 9–59.
- Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. Überarbeitete und gekürzte Fassung, in: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 57–84.
- Jörgen Bracker: Von Seeraub und Kaperfahrt im 14. Jahrhundert. In: ders. (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, ISBN 3-9805772-5-2, S. 6–35.
- Klaus J. Henning: Störtebeker lebt! Aspekte einer Legende. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, ISBN 3-9805772-5-2, S. 80–97.
- Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Stortebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-593-34525-0.
- Petra Bauersfeld: Die gesellschaftliche Bedeutung der Vitalienbrüder: Eine sozial- und kulturhistorische Betrachtung der Seeräuber um Klaus Störtebeker. In: Uwe Danker (Hrsg.): Demokratische Geschichte. Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag, o.O. 1998, S. 19–40.
- Philippe Dollinger: Die Hanse. 5. Auflage. Kröner, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-37105-7.
- Ralf Wiechmann, Eilin Einfeldt, Klaus Püschel: „… men scholde en ere hovede afhowen und negele se uppe den stok.“ Die Piratenschädel vom Grasbrook. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, ISBN 3-9805772-5-2, S. 52–79.
- Rudolf Holbach: Hanse und Seeraub. Wirtschaftliche Aspekte. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 131–152.
- Ulrich Aldermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Porta-Alba-Verlag, Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, S. 23–36.
- Walter Vogel: Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. Bd. 1. Berlin 1915.
- Josef Wanke: Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1395–1433). Oldenburg 1910 (Phil. Diss.)
Einzelnachweise
- ↑ Ad reysam dominorum supra Weseram contra Vitalienses: 230 Pf. 14 Sch. Vgl.: Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg, I. Bd. 1350–1400. 1869, S. 474.
- ↑ Ähnliche Organisationsformen sind drei Jahrhunderte später von den Seeräubern des karibischen Meeres überliefert.
- ↑ Sowohl von Mecklenburg und Dänemark, später auch Holland und den unterschiedlichen Häuptlingen Ostfrieslands
- ↑ Vgl. Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. Überarbeitete und gekürzte Fassung, in: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 57.
- ↑ vgl. Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 71 ff.
- ↑ Vgl. Reimar Kock, in: Chronik des Franziskaner Lesemeisters Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken. Hrsg. von F. H. Grautoff, I. Teil, Hamburg 1829, S. 497.
- ↑ Vgl. Petra Bauersfeld: Die gesellschaftliche Bedeutung der Vitalienbrüder: Eine sozial- und kulturhistorische Betrachtung der Seeräuber um Klaus Störtebeker. In: Uwe Danker (Hrsg.): Demokratische Geschichte. Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag, o. O. 1998, S. 22.
- ↑ Vgl. Hansisches Urkundenbuch, Bd. IV, Nr. 343–345, S. 141–145.
- ↑ Phillipe Dollinger: Die Hanse. Stuttgart 1998, S. 101.
- ↑ Hanserecesse I 3, Nr. 81, S. 70: „[…] de consensu et voluntate tocius communitatis regni Dacie illustrem Olavum filium sereni principis domini Haquini regis Norwegie in regem Danorum concorditer elegisse […].“
- ↑ Vgl. Hansisches Urkundenbuch, Bd. IV, Nr. 551, S. 226.
- ↑ Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co. Die Blütezeit der Seeräuber in Nord- und Ostsee. Hamburg 2000, S. 53.
- ↑ Vgl. Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 20.
- ↑ Vom zeitgenössischen „Vredenschepe“. Hierbei handelt es sich keinesfalls (wie der Name mutmaßen lässt) um Friedeschiffe im Wortsinne, sondern um zu Kriegsschiffen hochgerüstete Koggen, deren Aufgabe es war, die Ostsee zu befrieden, das heißt nachhaltig von Seeräubern zu befreien.
- ↑ Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1, 3. Auflage. Berlin 2001, S. 110.
- ↑ Vgl. Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co. Die Blütezeit der Seeräuber in Nord- und Ostsee. Hamburg 2000, S. 57.
- ↑ Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1, 3. Auflage. Berlin 2001, S. 111.
- ↑ Hanserecesse I 2, Nr. 308, S. 366.
- ↑ Hanserecesse I 2, Nr. 300, S. 353: „Und allen schaden van schepen, van koste, van luden und van vengnisse schalhe sulven allene utstan. […] Und hir vore scholen eme de stede geven 5000 mark Sundisch. […] Vortmer wat vromen he nympt van seeroveren, de schal sin wesen, yd en were, dat de seerover dem koepmanne dat ghenomen hadden, dat scholde men deme koepmanne wedder gheven […].“
- ↑ Detmar-Chronik. In: Chronik des Franziskaner Lesemeisters Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken. Hrsg. von F. H. Grautoff, I. Teil, Hamburg 1829, S. 351: „In demesulven iare toch hertoge iohan van mekelenborch, here to stargarde, over in Sweden to deme holme, sinen vedderen konink alberte van sweden to troste unde to helpe;“
- ↑ Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1, 3. Auflage. Berlin 2001, S. 119.
- ↑ zit. nach Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 38.
- ↑ Jörgen Bracker: Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. In: Ralf Wiechmann, Günter Bräuer, Klaus Püschel (Hrsg.): Klaus Störtebeker. Ein Mythos wird entschlüsselt. München 2003, S. 22.
- ↑ Reimar Kock, in: Chronik des Franziskaner Lesemeisters Detmar nach der Urschrift und mit Ergänzungen aus anderen Chroniken. Hrsg. von F.H. Grautoff, I. Teil, Hamburg 1829, S. 495. Originaltext: „Anno 1493 […] [hedden] de vramen Victallien Brodere de Sehe inne […], unde jederman Schaden deden, derhalven tho Lubeck alle Segelatie Stille lagh […].“
- ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 66.
- ↑ Detmar-Chronik zit. nach Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt am Main 1994, S. 52f.
- ↑ Die isländische Flatøannaler, zit. nach Puhle, S. 53. In der übrigen historischen Literatur wird die Leitung des Unternehmens Bartolomeus Voet zugeschrieben, z. B. Nordisk familiebok Bd. 32, Sp. 861.
- ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 54.
- ↑ Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1, 3. Auflage. Berlin 2001, S. 127.
- ↑ Voyages in eight Volumes, Bd. I, hrsg. von Richard Hakluyt, London und New York 1907, S. 146–157: „Item, in the yeere of our Lord 1394. one Goddekin Mighel, Clays Scheld, Storbiker and divers others of Wismer and Rostok […] tooke out of a ship of Elbing […].“ (S. 152), es folgt eine Liste von elf Vorfällen, die explizit Michels und Störtebeker zur Last gelegt werden, da jeder einzelne der Einträge mit der entsprechenden Jahreszahl sowie der Einleitung „the forenamed Godekins and Stertebeker“ beginnt. Die Dunkelziffer wird aber weit höher liegen.
- ↑ Ernst Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts. Bd. 1, 3. Auflage. Berlin 2001, S. 131 f.
- ↑ Dies zeigt, dass (zumindest zu diesem Zeitpunkt, das heißt nach ihrer Zerstreuung) nicht von einer homogenen oder geschlossen auftretenden Gruppe ausgegangen werden kann.
- ↑ Vgl. Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt am Main 1994, S. 93 und Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. In: Ralf Wiechmann: Klaus Störtebeker: ein Mythos wird entschlüsselt. Paderborn u. a. 2003, S. 9–59, hier: S. 24 sowie Hanserecesse I 4 Nr. 438, § 4, S. 416: „Dornoch czo was Swen Schur, der das land Godtlandt innehatte, und krygete mit der stad Wisbu etliche cziet, alze das konig Albrecht synen czon, herczog Eryk, mit synem wybe von Mekilburg czu schiffe obir sante mit veyl rittern und knechten, dy stad czu Wisbu czu retten, als das der selbige herczog voste lange krygete mit Swen Schur, bas alzo lange, bas ym Swan Schur das landt Gotlandt und alle dy slosse inantwertte, und wart domethe des konigis Albrechts man.“
- ↑ Fritz Teichmann: Die Stellung und Politik der hansischen Seestädte gegenüber den Vitalienbrüdern in den nordischen Thronwirren 1389–1400. Berlin 1931, S. 7.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 438, § 5, S. 416: „[…] und lis kundegen in alle landt by der zehe den vytalgenbrudern, do rouben welde umme dy helffte syner frouwen, der herzogynne, und ym, der sulde erhalt haben off den slossen czu Gotlandt, alzo Landeskrone und Sleyt.“
- ↑ Jörgen Bracker: Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. In: Ralf Wiechmann, Günter Bräuer, Klaus Püschel (Hrsg.): Klaus Störtebeker. Ein Mythos wird entschlüsselt. München 2003, S. 25.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 427, S. 407: „[…] dat erer gerne to worden were mit erer vedderken, hertogh Erikes wyf van Mekelborgh […].“
- ↑ Hancerecesse I 4, Nr. 438, § 9, S. 416: „Des zo wart der hochmeister czu rathe mit synen gebitigern und mit synen steten, das her dys meynte czu storen, und lys usrichten wol 84 schiff, cleyne und gros, […] und saczte dorin 4000 man czu harnisch, und gab yn methe in dy schiff 400 pherd […]. [D]o unser homeister dy schiff lis ussegeln, bas zu Gotlandt […].“
- ↑ Hancerecesse I 4, Nr. 437, S. 414.
- ↑ Phillipe Dollinger: Die Hanse. Stuttgart 1998, S. 114.
- ↑ a b Antje Sander: Schlupfwinkel, Lagerplätze und Märkte. Anmerkungen zur Topographie des Jadebusens um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 169.
- ↑ Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 95.
- ↑ Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co. Die Blütezeit der Seeräuber in Nord- und Ostsee. Hamburg 2000, S. 223f.
- ↑ Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 86.
- ↑ Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 87.
- ↑ Hartmut Roder: Klaus Störtebeker – Häuptling der Vitalienbrüder. In: ders. (Hrsg.): Piraten – Herren der Sieben Meere. Bremen 2000, S. 41.
- ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 111.
- ↑ Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 1350–1470, Bd. I, 1869, S. 474: „Ad reysam dominorum supra Weseram contra Vitalienses: 230 £ 14ß.“
- ↑ Beispielsweise 1395 nach dem Frieden von Skanör und Falsterbo (siehe oben), 1396 suchte eine Gruppe Vitalienbrüder Aufnahme bei Graf Konrad von Mecklenburg, wurde aber abgewiesen und fand schließlich bei Widzel tom Brok Zuflucht, vgl. Hanserecesse I 4, Nr. 359, S. 346: „[…] de zerovere legheren wolden to Oldenborg, […] dat se dar nicht geheget wurden […] Dar boven heft [Wytzolde] se to sik genomen, unde he is de jenene, de se untholt.“
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 453, S. 431f.
- ↑ Hanserecesse I 4, S. 432.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 457, S. 434.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 570, § 5, S. 522.
- ↑ Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Abt. I, Bd. 4, Nr. 692, S. 788: „[…] [I]k Keno […] bekenne unde betughe openbar in desem brefe, […] dat ick wil unde schal van my laten alle vitallienbroder, old unde jung, de ick bette desser tyd hebbe, vnde de ick an mynen sloten unde in mynen ghebheden geleidet hadde, so dat ze van my unde de minen scholet uttheen to lande unde nicht to watere van stunden an […].“
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 589, S. 534f.: „[…] Keene heft de vitalienbrudere van sych gelaten, […] etlike høvetlinge in Vreesland, alze Ede Wummekens unde de van Emede de vitalgenbroder wedder to sich genomen hebben, unde de greve van Oldenborch […].“ Mit Edo Wiemken und Hisko von Emden übrigens eben jene Häuptlinge, die keine zwei Jahre zuvor feierlich gelobt hatten, nie wieder mit den Seeräubern gemeinsame Sache zu machen!
- ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 106.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 591, S. 538–546.
- ↑ 9. Mai: Schloss Larrelt, 12. Mai: Schloss Loquard (am 14. Juni geschleift), zwischen 16. und 23. Mai: Turm von Marienfeld (Anfang Juni geschleift), Schloss Wittmund, Schloss Groothusen (14. Juni geschleift).
- ↑ Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Abt. I, Bd. 4, Nr. 699, S. 793: „Witlik sy allen den ghenen, de dessen bref seen edder horen lesen, dat wy houetlinge vnde menheyt des ghantsen landes to Ostvreslande, also dat beleghen is twysschen der Emese vnde der Wesere, vp dat wy schullen vnde willen nummermer to ewyghen tyden Vytalienbrodere edder andere rouere […] husede ofte heghedein vnsen landen ofte ghebede.“
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 658, S. 593.
- ↑ Hanserecesse I 4, Nr. 605, S. 552: „Aelbrecht etc doen cond allen luden, dat wii een voerwaerde gedadingt ende gemaect habben mit […] Johan Stortebeker […] van hore gemeenre vitaelgebroedere […].“
- ↑ Für die ausführliche Herleitung dieses Zeitraumes vgl. Puhle, S. 130.
- ↑ Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg, Bd. II, S. 2. Originaltext: „Ad reysam domini Hermanni Langhen et Nicolai Schoken, in Hilghelande, de anno preterito contra Vitalienses: summa 57 £.“
- ↑ Rufus-Chronik, in: Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bd. 28. Hrsg. v. Historische Commission der Königl. Academie der Wissenschaften, Leipzig 1902, S. 25.
- ↑ Übersetzung aus dem Mittelniederdeutschen, in: Christian Seebald: Libretti vom „Mittelalter“: Entdeckungen von Historie in der (nord)deutschen und europäischen Oper um 1700. Walter de Gruyter Verlag, 2009, S. 298, Fußnote 698
- ↑ Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. Überarbeitete und gekürzte Fassung, in: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 70.
- ↑ Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg, Bd. II, S. 2: „Ad reysam dominorum Nicolai Schoken et Hinrici Ienevelt, super Weseram contra Vitalienses 230 £ 14 ß.“
- ↑ Rufus-Chronik, S. 26.
- ↑ Übersetzung aus dem Mittelniederdeutschen nach Seebald, 2009, a.a.O.
- ↑ Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. Überarbeitete und gekürzte Fassung, in: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 68.
- ↑ Vgl. Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 143: 1402 Überfall eines Kampener Bürgers, 1405 Seeräuberei vor Emden, 1408: Vitalienbrüder erbeuten fünf Hanseschiffe etc.
- ↑ Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 85–109, hier: S. 108.
- ↑ Vgl. Rudolf Holbach: Hanse und Seeraub. Wirtschaftliche Aspekte. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 134.
- ↑ Detmar-Chronik, S. 50f.
- ↑ Vgl. Rudolf Holbach: Hanse und Seeraub. Wirtschaftliche Aspekte. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 131–151, hier: S. 135.
- ↑ Vgl. Rudolf Holbach: Hanse und Seeraub. Wirtschaftliche Aspekte. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 131–151, hier: S. 149.
- ↑ Rudolf Holbach: Hanse und Seeraub. Wirtschaftliche Aspekte. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 149.
- ↑ Ulrich Aldermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung. In: Wilfried Ehbrecht: Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 24.
- ↑ Beispielsweise die Kauffahrer der Hanse, denen höchstens eine „strukturelle“ Beteiligung unterstellt werden kann, da sie ja beide Seiten mit Waren belieferte.
- ↑ Ulrich Aldermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 23–36, hier: S. 33.
- ↑ Vgl. Ralf Wiechmann, Eilin Einfeldt, Klaus Püschel: „… men scholde en ere hovede afhowen und negele se uppe den stok.“ Die Piratenschädel vom Grasbrook. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, S. 55.
- ↑ Ulrich Aldermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 23–36, hier: S. 34.
- ↑ 1. Elbing, 2. Stralsund, 3. Danzig, 4. Bogenmacher von Paris, 5. New Shoreham.
- ↑ Das aufwendig restaurierte Schiff kann heute im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven besichtigt werden.
- ↑ Vgl. Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 155.
- ↑ Erst nach 1450 ging man dazu über, Rahsegel an drei Masten zu befestigen und so wesentliche Fortschritte in der Kontrolle über den Holk zu erlangen. Dies spielt jedoch mit Blick auf die Jahreszahl in diesem Zusammenhang keine Rolle.
- ↑ Vgl. Walter Vogel: Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. Bd. 1. Berlin 1915, S. 452.
- ↑ Vgl. Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 163.
- ↑ Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 163.
- ↑ Vgl. Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 158.
- ↑ Vgl. Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 159.
- ↑ Detlev Ellmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker – 600 Jahre nach seinem Tod. Trier 2005, S. 153–168, hier: S. 164.
- ↑ Vgl. Klaus J. Henning: Störtebeker lebt! Aspekte einer Legende. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, S. 87.
- ↑ a b Vgl. Klaus J. Henning: Störtebeker lebt! Aspekte einer Legende. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, S. 80–97, hier: S. 91.
- ↑ Willi Bredel: Die Vitalienbrüder: ein Störtebeker-Roman. Hinstorff, Rostock 1996.
- ↑ Klaus J. Henning: Störtebeker lebt! Aspekte einer Legende. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Gottes Freund – aller Welt Feind: von Seeraub und Konvoifahrt; Störtebeker und die Folgen. Museum für Hamburgische Geschichte, [Hamburg] 2001, S. 80–97, hier: S. 95.
- ↑ Vgl. Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder: Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. 2. Auflage. Frankfurt/Main 1994, S. 176f.
- ↑ Über Störtebeker als Paradebeispiel für die Romantisierung der Likedeeler in der Gegenwart vgl. Karin Lubowski: Held oder Halunke. In: Hamburger Abendblatt, 21. Oktober 2006. Der darin erwähnte NDR-Dokumentarfilm Der wahre Schatz des Störtebeker von Arne Lorenz befasst sich ebenfalls mit der Geschichte und der heutigen Rezeption der Vitalienbrüder.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 17.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Klaus Störtebeker
Klaus Störtebeker, auch Klaas Störtebecker, Claas Störtebeker oder Nikolaus Storzenbecher (* um 1360; † vermutlich am 21. Oktober 1401 in Hamburg), war ein Seeräuber und neben den berüchtigten Kapitänen Gödeke Michels, Hennig Wichmann, Klaus Scheld und Magister Wigbold einer der Anführer der auch als Likedeeler (Gleichteiler) bezeichneten Vitalienbrüder.
Um seine Person ranken sich zahlreiche Legenden, von denen die historische Persönlichkeit, die von der Forschung auch mit einem Nicolao (Nikolaus) Stortebeker und nach neuen Erkenntnissen mit einem aus Danzig stammenden Johann Störtebeker (der mindestens bis 1413 lebte) in Verbindung gebracht wird, erheblich abweicht.
Leben und Legende
Die genaue Herkunft von Störtebeker ist nicht bekannt. Vermutungen zufolge stammt er aus der Gegend von Rotenburg (Wümme)/Verden (Aller), anderen Meinungen zufolge aus Wismar. Im Liber proscriptorum, dem „Verfestungsbuch“ der Stadt Wismar, ist im Jahre 1380 ein Vorfall festgehalten, wonach zwei Wismarer Bürger aus der Stadt gewiesen wurden, weil sie einem anderen in einer Schlägerei verschiedene Knochenbrüche zugefügt hatten. Der Betroffene der Auseinandersetzung wird als „nicolao stortebeker“ bezeichnet. Es spricht einiges dafür, dass dieser Nikolaus Störtebeker später als Klaus Störtebeker in die Geschichte einging.
Angeblich hat sich der Freibeuterkapitän den Namen Störtebeker (aus dem Niederdeutschen von „Stürz den Becher“) wegen seiner Trinkfestigkeit als Spitznamen verdient. So soll er der Sage nach einen 4-Liter-Humpen (einen ellenhohen Becher) Wein oder Bier ohne abzusetzen in einem Zug leergetrunken haben.[1]
Ins öffentliche Bewusstsein trat Störtebeker nach der Vertreibung der Vitalienbrüder von der heute schwedischen Insel Gotland als Kapitän der Likedeeler. Dort hatten die Vitalienbrüder, die sich als Freibeuter selbstständig gemacht hatten, von 1394 bis 1398 Schutz hinter den Mauern der Stadt Visby auf der Insel gesucht. Ursprünglich unterstützten sie König Albrecht von Schweden im Kampf gegen die dänische Königin Margarethe I. und betrieben dazu auch Seeräuberei in Nord- und Ostsee. Den Übergriffen auf die Schiffe der Dänen und Lübecker, die auf dänischer Seite standen, folgten bald Überfälle auf andere Schiffe der Hanse. Hierfür hatten die Vitalienbrüder Kaperbriefe erhalten. Damit ausgestattet konnten sie die erbeuteten Waren in Wismar frei auf dem Markt verkaufen.
Schon seit 1396 hatte Störtebeker auch Unterstützung in Marienhafe, Ostfriesland, wo er eine Tochter des friesischen Häuptlings Keno ten Broke geheiratet haben soll. Zugleich soll ihm in der Kirche St. Marien Unterschlupf gewährt worden sein, weshalb der heute noch vorhandene Kirchturm auch „Störtebekerturm“ genannt wird. Diplomatischer Druck seitens der Hansestädte führte zum Verlust dieser Operationsbasis. Am 15. August 1400 beurkundete Herzog Albrecht I. von Bayern und Graf von Holland und Hennegau einen mit den Vitalienbrüdern geschlossenen Vertrag. Diesem zufolge nahm er 114 Vitalienbrüder auf und stellte sie unter seinen Schutz. Dabei werden acht Hauptleute namentlich genannt, darunter ein Johan Stortebeker. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich ein weiterer Anführer mit dem Namen Störtebeker in den Vordergrund gedrängt hat. Darum kann angenommen werden, dass Klaus Störtebeker nicht wie Gödeke Michels nach Norwegen geflohen ist, sondern sich weiterhin nahe der Nordsee aufgehalten hat.
Beim Versuch, den Seehandel mit England und Holland vor Piratenangriffen zu schützen, verstärkten die Hanse und insbesondere die Hansestadt Hamburg die Anstrengungen zur Verfolgung und Bekämpfung Störtebekers und Gödeke Michels. Störtebeker soll den überlegenen Hansekoggen mit seinen Schiffen aber immer wieder auf die hohe See entkommen sein.
Am 22. April 1401 wurde er von einer hamburgischen Flotte unter Simon von Utrecht vor Helgoland gestellt, in der Seeschlacht nach erbittertem Kampf gefangen genommen und auf der Bunten Kuh nach Hamburg gebracht. Angeblich soll dieser Erfolg erst durch die Hilfe eines Verräters ermöglicht worden sein, der unbemerkt flüssiges Blei in die Steueranlage goss und damit Störtebekers Schiff manövrierunfähig machte – alternativ wird dies mit der Zerstörung des Hauptmastes durch Geschosse der Bunten Kuh erklärt.
Klaus Störtebeker wurde am 21. Oktober 1401 mit 72 Gefährten, unter ihnen sein Steuermann Humbert Grobherz, auf dem Grasbrook vor Hamburgs Hafeneinfahrt durch den Scharfrichter Rosenfeld aus Buxtehude enthauptet. Der Legende nach soll Störtebeker vom Bürgermeister der Hansestadt Kersten Miles gestattet worden sein, dass all jene Männer überleben durften, an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeizugehen vermochte. An elf Männern schritt der Geköpfte vorbei, bevor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf (laut einigen Quellen ihm ein Bein stellte). Nach dem Sturz des Piraten brach der Bürgermeister allerdings sein gegebenes Versprechen, und alle 73 Seeräuber wurden enthauptet. Eine weitere Legende um seine Hinrichtung besagt, dass der Scharfrichter Rosenfeld alle Enthauptungen selbst und fehlerfrei durchgeführt hätte – bei immerhin 73 Enthauptungen am Stück eine ungewöhnliche Leistung. Als ihn ein Mitglied des anwesenden Rates darob lobte, soll er geantwortet haben, das sei noch gar nichts, er könne auf Wunsch auch noch den gesamten versammelten Rat abtun. Daraufhin wurde er selbst in Gewahrsam genommen und vom jüngsten Ratsmitglied enthauptet. Die Köpfe wurden zur Abschreckung längs der Elbe aufgespießt. Hinterlassenschaften Störtebekers, wie sein berühmter Trinkbecher, wurden beim Großen Hamburger Brand 1842 zerstört.
Die Sage will außerdem wissen, dass Störtebeker dem Senat, nachdem ihm das Todesurteil verkündet wurde, für Leben und Freiheit eine goldene Kette anbot, deren Länge um die ganze Stadt reichen sollte – was der Senat aber mit Entrüstung zurückwies. Als man den legendären Goldschatz der Likedeeler nicht finden konnte, wurde das Schiff an einen Schiffszimmermann verkauft. Als dieser die Säge ansetzte, um das Schiff zu zerlegen, traf er auf etwas Hartes: In den Masten verborgen war der Schatz, einer mit Gold, der andere mit Silber, und der dritte mit Kupfer angefüllt; und er ließ aus dem Gold eine Krone für den Turm der Hamburger St.-Katharinen-Kirche anfertigen.
Das bisherige Störtebekerbild wird ernüchtert durch neue Forschungsergebnisse, die 2007 in den Hansischen Geschichtsblättern publiziert und am 26. Dezember 2007 in der NDR-Fernsehdokumentation „Der wahre Schatz des Störtebeker“[2] einem breiten Publikum vorgestellt wurden.[3] Danach hieß Klaus Störtebeker in Wirklichkeit „Johann“ und war ein Kaufmann aus Danzig. Die These stützt sich unter anderem auf die Tatsache, dass in sämtlichen historischen Quellen stets von einem Kapitän namens „Johann“ Störtebeker die Rede ist, der Vorname „Klaus“ jedoch in keiner archivalischen Quelle erwähnt wird. Dieser Johann Störtebeker aus Danzig hat zudem nachweislich bis mindestens 1413 gelebt. Er war kein Pirat, sondern ein professioneller Fehdehelfer, also nicht kriminell. Sollten sich diese Erkenntnisse bestätigen, dann ist Störtebeker weder 1401 auf dem Hamburger Grasbrook hingerichtet worden, noch ist „Nicolao Störtebeker“ aus dem Wismarer Verfestungsbuch mit dem Kapitän Störtebeker identisch. Auch die Zuschreibung des berühmten Schädels aus dem Museum für Hamburgische Geschichte wird damit hinfällig – er gehörte damit einem namenlosen Hingerichteten des Mittelalters.
Die Namensgebung Klaus Störtebeker tauchte erstmals in Hermann Korners „Chronica novella“ auf und wurde von dort insbesondere durch Albert Krantz in seiner damals sehr populären Wandalia (1518) weiter verbreitet.
Rezeption
Das von Daniel Hopfer geschaffene und oftmals verwendete angebliche Porträt Störtebekers stellt in Wirklichkeit Kunz von der Rosen, den Schalknarren und Berater Kaiser Maximilians dar, der 100 Jahre nach Störtebeker lebte.
Der 1878 von Arbeitern auf dem Grasbrook gefundene und lange Zeit als sogenannter „Störtebeker-Schädel“ im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellte Schädel konnte bisher nicht zweifelsfrei Klaus Störtebeker zugeschrieben werden. Auch mit Hilfe kanadischer Forensik-Experten konnte das gut 600 Jahre alte Knochenmaterial genetisch nicht mehr entschlüsselt werden. Damit ist auch eine Zuordnung zu den etwa 200 lebenden Störtebekers in Norddeutschland nicht möglich.[4] Am 9. Januar 2010 wurde der Schädel aus dem Museum gestohlen[5] und im März 2011 von der Polizei sichergestellt.[6]
In Ralswiek auf Rügen werden jährlich auf einer Naturbühne die Störtebeker-Festspiele veranstaltet. Die Stralsunder Brauerei war zwischenzeitlich dabei ein Sponsor und nannte sich inzwischen in Störtebeker Braumanufaktur um. Auch im ostfriesischen Marienhafe wird alle drei Jahre auf dem Marktplatz ein plattdeutsches Störtebeker-Freilichtspiel aufgeführt. Die letzte Aufführung fand 2011 statt.
Störtebeker soll im Kellerverlies des Schlosses Gottesgabe (bei Schwerin) eingesessen haben, seinerzeit im Besitz der Familie seines Vitalienbruders Marquard von Preen.
In der Stubbenkammer auf Rügen soll Klaus Störtebeker der Legende nach einen unermesslichen Schatz versteckt haben. Die Störtebeker-Kuhle in der Nähe von Heringsdorf wird auch als Schatzversteck genannt, und die goldene Kette, mit der er sich in Hamburg freikaufen wollte, soll im Burggraben von Venz liegen. Eine ähnliche Sage verbindet sich mit dem zu Klanxbüll gehörenden Hof Bombüll, von dem aus angeblich ein Geheimgang durch den Deich hindurch zum Meer führte.
Vor dem Rathaus der Stadt Verden werden alljährlich vier Fässer Heringe und 530 Brote an die Bürger verteilt. Anlass ist die traditionelle „Störtebeker-Spende“, auch „Lätare-Spende“ genannt, da sie am Montag nach Lätare (drei Wochen vor Ostern) stattfindet.[7] Klaus Störtebeker und Gödeke Michels sollen im Verdener Dom sieben Fenster zur Abbüßung ihrer sieben Todsünden gestiftet haben. Das auf die Spende hinweisende angebliche Wappen Störtebekers ist allerdings das des Verdener Bischofs Kesselhut.[8]
2008 wurde der „Störtebeker SV“ (mit vollem Namen: HafenCity, Alt- und Neustadt Sport, Störtebeker Sportverein) gegründet. Es ist der erste Hamburger Sportverein, der die Anwohner der Hamburger Innenstadt anspricht. 2009 wurde der neue Sportplatz HafenCity eröffnet, wo auch das Störtebeker-Denkmal steht.
Verarbeitung in Musik und Medien
Der Barockkomponist Reinhard Keiser schrieb die zweiteilige Oper Störtebeker und Jödge Michels (1701), von der nur das Libretto erhalten ist.
Im angehenden 19. Jahrhundert kursierte in Norddeutschland ein Spottlied: „Vor vielen Jahren lebte, o Graus, hoch oben im Norden, der wilde Klaus […]“.[9]
Der DDR-Schriftsteller Kurt Barthel schrieb 1959 die dramatische Ballade Klaus Störtebeker, die in den Jahren 1959 bis 1961 und 1980 bis 1981 in Ralswiek auf Rügen im Rahmen der „Rügenfestspiele“ unter der Leitung von Hanns Anselm Perten und der Chorleitung von Günther Wolf mit jeweils ca. 2.000 Mitwirkenden aufgeführt wurde. Seit 1993 finden dort jährlich die Störtebeker-Festspiele statt.
Die Thematik um Klaus Störtebeker wurde bereits mehrfach verfilmt:
- Störtebeker. ein verschollener Stummfilm von 1919, in dem Ernst Wendt Regie geführt hatte.[10]
- Störtebeker. ein von der ARD produzierter und zu Ostern 2006 ausgestrahlter zweiteiliger Fernsehfilm.[11]
- Der wahre Schatz des Störtebeker. eine NDR-Dokumentation von Arne Lorenz, ausgestrahlt 2007.[12]
- 12 Meter ohne Kopf, ein Kinofilm aus dem Jahr 2009 unter der Regie von Sven Taddicken mit Ronald Zehrfeld als Störtebeker.
Musikalisch behandelten ihn unter anderen die Hamburger Punkband Slime mit dem Lied „Störtebeker“ auf ihrem Album „Alle gegen Alle“, die Folk-Punkband Across the Border auf ihrem Album Loyalty mit einer Coverversion des Slime-Lieds sowie die deutsche Heavy-Metal-Band Running Wild mit einem gleichnamigen Lied.
Die Rockband Transit schrieb 1982 die 45-minütige Rocksuite Störtebeker, welche 1997 auf CD erschienen ist.
In dem Lied Nordisch by Nature von der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot wird auch Bezug auf Störtebeker genommen: „Schon Störtebecker wusste, dass der Norden rockt und hat mit seinem Kahn hier gleich angedockt.“
Achim Reichel setzte Störtebecker mit dem Störtebeckerlied auf dem Album Klabautermann ein musikalisches Denkmal.
Auch das Spielmannsduo Pampatut verwendete die Legende um Klaus Störtebecker für das Lied „Die Seeräuber“ auf ihrem Album Pampatut gut.
Am Rande dient Störtebeker als Identifikationsfigur in der Linken, die sich positiv auf dessen Teilungsprinzip beruft. Rechtsextremisten haben ein Informationsportal nach Klaus Störtebeker benannt.
Die norddeutsche, plattdeutsche Landrock-Band „De Drangdüwels“ schrieben u. a. die Lieder Störtebeker und Gödecke Michel, welche auf ihrem Album Hard an Wind veröffentlicht worden sind. Im Lied Störtebeker wird unter anderem die Schlacht vor Helgoland mit der Bunten Kuh geschildert.
Der Autor Patrick Wirbeleit und der Comiczeichner Kim Schmidt brachten im Mai 2004 den Comicband „Störtebeker-Freunde und Feinde“ heraus. Der Band erzählt eine konstruierte Geschichte des jungen Piraten Störtebeker.
Nach Klaus Störtebeker benannte Schiffe
Zahlreiche Schiffe erhielten den Namen Störtebeker, u. a.:
- Das Versuchsboot Störtebeker. war als Minensuchboot M 66 im Jahre 1917 für die Kaiserliche Marine in Dienst gestellt worden. Es wurde ab 1937 von der Kriegsmarine als Versuchsboot unter dem Namen Störtebeker eingesetzt, im Oktober 1940 in M 566 umbenannt und ab Mitte 1944 als Führer- und Geleitschiff einer Minenräumflottille eingesetzt. In dieser Funktion diente es auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Deutschen Minenräumdienst. Das Boot wurde 1950 abgewrackt.
- Der 1917 für die Kaiserliche Marine gebaute Fischdampfer Störtebeker wurde 1918 zur U-Boot-Schule abkommandiert, 1919 aber an die private Fischerei-Industrie verkauft und als Johs. Thode in Dienst gestellt. Er strandete 1929 bei Kap Teriberka auf der Halbinsel Kola.
- Ausflugsschiff der W.D.R.(Wyker-Dampfschiffs-Reederei) seit 1969. Es wurde 2009 verkauft an die Rijf Shipping BV und 2011 weiter verkauft an Kapitän Jelle Bos. Das Schiff fährt immer noch unter dem Namen Störtebeker.
- Das ehemalige Motorschulboot (MSB) „Patriot“ der GST-Seesportschule Greifswald-Wieck, der späteren GST-Marineschule "August Lütgens", das dort von 1956 bis 1960 im Dienst war, erhielt nach Übernahme durch die Pionierorganisation Ernst Thälmann, Haus der Jungen Pioniere Stralsund, am 1. Mai 1961 den Namen "Klaus Störtebeker. Es diente den Jungen Matrosen in Stralsund fünfzehn Jahre als schwimmende Ausbildungsstätte und wurde 1977 abgewrackt.
- Das ehemalige Motorschulschiff (MSS) „Freundschaft“ (II) ex. „Fürstenberg“ der GST-Seesportschule, später GST-Marineschule „August Lütgens“ Greifswald-Wieck - dort von 1959 bis 1973 in Dienst und scherzhaft „Hochhaus“ genannt - kam danach ebenfalls nach Stralsund und wurde zum Pionierschiff umgebaut. Als neue „Klaus Störtebeker“ versah das Schiff unter der Flagge der Pionierorganisation seinen Dienst bis zur Wende in der DDR. Sein weiterer Verbleib ist nicht bekannt.
Literatur
Wissenschaftliche Literatur und Sachbücher
- Johannes Ruhr: Störtebeker. Der Weg eines Mythos. SKN Verlag, Norden 2011, ISBN 978-3-939870-92-0.
- Harm Bents u. a.: Störtebeker. Dichtung und Wahrheit. SKN Verlag, Norden 2003, ISBN 3-928327-69-0.
- Jörgen Bracker u. a. (Hrsg.): Gottes Freund – Aller Welt Feind. Wilhelm Zertani Verlag, Hamburg 2001, ISBN 3-9805772-5-2 (Ausstellungskatalog)
- Adolph Hofmeister: Störtebeker, Klaus. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 36, Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 459 f.
- Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebeker und die Seeräuber der Hansezeit. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-593-34525-0.
- Ralf Wiechmann u. a. (Hrsg.): Klaus Störtebeker? Ein Mythos wird entschlüsselt. Wilhelm Fink Verlag, München 2003, ISBN 3-7705-3837-4 online
- Dieter Zimmerling: Störtebeker & Co. Die Blütezeite der Seeräuber in Nord- und Ostsee. Verlag die Hanse, Hamburg 2001, ISBN 3-434-52615-3.
- Gregor Rohmann: Der Kaperfahrer Johann Stortebeker aus Danzig. Beobachtungen zur Geschichte der „Vitalienbrüder“. In: Hansische Geschichtsblätter. 125 (2007), ISBN 978-3-933701-28-2, S. 77–119.
- Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker. 600 Jahre nach seinem Tod. (Hansische Studien Bd. XV). Trier 2005, ISBN 3-933701-14-7, hierin:
- Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder – Söldner, Seeräuber? S. 15–22.
- Heinrich Schmidt: Das östliche Friesland um 1400. Territorialpolitische Strukturen und Bewegungen. S. 85–110.
- Detlev Elmers: Die Schiffe der Hanse und der Seeräuber um 1400. S. 153–168.
- Volker Henn: Das Störtebeker-Bild in der erzählenden Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. S. 273–290.
- Jens Freyler: Mit Störtebeker durch Hamburg. Ein ReiseGeister-Buch auf den Spuren des berühmten Freibeuters. Traveldiary Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-941796-06-5.
- Lutz Mohr: Das Leben, Lieben und Sterben des Freibeuterkapitäns Claus Störtebeker in ausgewählten pommerschen Sagen. In: GeschichtsBake. Hrsg. vom Verein für erlebbare Geschichte des Mare Balticum e. V. Stralsund, Jg. 1, Heft/2005, S. 10-20
- Maik Nolte, Gerhard Wiechmann: Söldner, Seeräuber, Serienhelden. Die Vitalienbrüder in der Geschichtswissenschaft und im „Groschenroman“ der Kaiserzeit. In: Schiff & Zeit/Panorama maritim. 71 (2010), S. 21–31.
- Stichwort: Störtebeker (M 66/M 566). In: Hans Hildebrand, Albert Röhr, Hans Otto Steinmetz: Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien - ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. sieben Bände in einem Band, 3. Auflage. Herrsching ca. 1984, Bd. 7, S. 113.
Belletristik
- Georg Engel: Claus Störtebecker. Roman in zwei Bänden. Dreizehnte Auflage. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart/ Berlin/ Leipzig 1920.
- Jörgen Bracker: Zeelander. Der Störtebeker Roman. Murmann Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-938017-42-2.
- Willi Bredel: Die Vitalienbrüder. Ein Störtebeker-Roman. Hinstorff Verlag, Rostock 1996, ISBN 3-356-00658-4.
- Thomas Einfeldt: Störtebekers Gold. Ein Roman aus der Hansezeit. Piper Verlag, München 2002, ISBN 3-492-26022-5.
- Thomas Einfeldt: Störtebekers Kinder. Ueberreuther 2001, ISBN 3-8000-2771-2.
- Gloria von Felseneck u.a.: Klaus Störtebeker. Kelter-Verlag, Hamburg 2005 ff. (Heftromanserie)
- Klaus Lingenauber: Störtebekers Beifang. Freibeuter wider Willen. (Convent-Comic). Convent-Verlag, Hamburg 2006, ISBN 3-86633-002-2.
- Berndt List: Das Gold von Gotland. Ein Störtebeker Roman. Kindler Verlag, Reinbek 2006, ISBN 3-463-40499-0.
- Wilhelm Lobsien: Klaus Störtebeker. Eine Erzählung aus der Zeit der Vitalienbrüder. Westholsteinische VA, Heide 1995, ISBN 3-8042-0675-1.
- Boy Lornsen: Gottes Freund und aller Welt Feind. Mit Klaus Störtebeker auf Kaperfahrt. Carlssen Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-551-35447-2.
- Gustav Schalk: Klaus Störtebeker. Ueberreuter-Verlag, Wien 2002, ISBN 3-8000-2876-X.
- Kurt Barthel: Klaus Störtebeker. (Dramatische Ballade), Leipzig 1959.
- Klabund:Störtebecker. In: Projekt Gutenberg-DE.
- Hans G. Stelling: Der Blut Richter. Ein Hanse Roman. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009, ISBN 978-3-423-40186-9.
- Georg Kranich: Störtebeker. Kleins Buch- und Kunstverlag, Lengerich (Westf) 1950.
- Karl F. Kohlenberg: Störtebeker. Langen- Müller bei F. A. Herbig, 1991, ISBN 3-7844-2325-6.
- Wilhelm Fischer: Störtebeker. Der grösste Seeräuber aller Zeiten. Band 1: Störtebekers Kampf und Aufstieg. Band 2: Sieg und Ende des grossen Seeräubers. W. Fischer Verlag, Göttingen 1954ff.
- Berndt List: Der Schatz des Atterdag. Roman. E-Book, Kindle Edition. ASIN: B00AIWQVZ. Überarbeitete Fassung des „Das Gold von Gotland“.
- Es erschienen auch Heftromanserien, die mit dem historischen Störtebeker nur Grundzüge gemein hatten:
- Klaus Störtebecker der gefürchtete Herrscher der Meere, 60 Hefte im Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst, Berlin 1908/09. Reprint in 54 Ausgaben Neues Verlagshaus für Volksliteratur, Berlin 1932/33.
- Klaus Störtebeker – Der kühnste Pirat aller Zeiten. 8 Hefte im Jupiter-Verlag, Darmstadt 1953.
- Klaus Störtebeker – Liebe und Abenteuer eines Freibeuters. 12 Hefte, Martin Kelter-Verlag, Hamburg 2005/2006.
Comics
- Schrecken der Meere. Klaus Störtebecker der große Seeräuber, Abenteuer der Weltgeschichte. Die interessante Jugendzeitschrift, Nr. 43 (Walter Lehning Verlag, Hannover) o.J. [ca. 1955]
- Harm Bengen: Störtebeker. Lappan Verlag, Oldenburg 2010 (Erstauflage 1993), ISBN 978-3-89982-309-7.
- Kim Schmidt, Patrick Wirbeleit (Text): Freunde und Feinde. Störtebeker 01, Carlsen Comics, Juni 2004, ISBN 3-551-77531-1.
Hörbuch
- Störtebeker – ein norddeutscher Pirat. 80 Min., Hörbuch-Verlag und Hörbuch-Produktion Dr. Dahms, Hamburg 2006, ISBN 3-9810307-4-5.
- Claus Störtebecker von Georg Engel Kostenloses Hörbuch bei LibriVox
- Klaus Störtebecker – Gottes Freund und aller Welt Feind, Hörspiel Europa Verlag aus dem Jahr 1969
- Offenbarung 23 - Folge 12 Der Piratenschatz, Hörspiel, Verlag Lübbe-Audio 2005-2010, ISBN 978-3785732199
Einzelnachweise
- ↑ Allerdings besteht Grund, diese Geschichte anzuzweifeln – in dem Wismarer Verfestungsbuch wird „Stortebeker“ selbstverständlich als Familienname aufgeführt, und als Familienname existiert er noch heute – es leben mehrere „Störtebekers“ mit verschiedener Schreibweise in Norddeutschland. So ist es unklar, ob der Nachname erst mit Klaus Störtebeker entstand, oder ob er ihn als Familienname geerbt hat.
- ↑ Karin Lubowski: Held oder Halunke?, Online-Artikel des Hamburger Abendblatts.
- ↑ Vgl. Rohmann, Gregor: Der Kaperfahrer Johann Stortebeker aus Danzig. Beobachtungen zur Geschichte der Vitalienbrüder. In: Hansische Geschichtsblätter 2007.
- ↑ Spiegel Online 31. Juli 2008: Das Piratengeheimnis bleibt ungelöst abgerufen am 14. Dezember 2009.
- ↑ Diebe stehlen angeblichen Störtebeker-Schädel. Spiegel Online, abgerufen am 19. Januar 2010.
- ↑ Polizei stellt gestohlenen Störtebeker-Schädel sicher. Hamburger Abendblatt, abgerufen am 17. März 2011.
- ↑ http://www.xxx Verteilung der Lätare-Spende 2008 auf der Website der Stadt Verden.
- ↑ Karl Ernst Hermann Krause: Konrad III., Bischof von Verden. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 630–632. Dort auf S. 630 unten: „Daß zu seiner Zeit die Seeräuber Störtebeker und Gödecke Michael in Verden gehaust und im Dome Fenster gestiftet hätten, ist eine Fabel. Das fragliche Störtebecker Wappen, sogenannte umgestürzte Becher, waren die Kesselhüte des Bischofs Nikolaus.“
- ↑ Neuwald, Alfred: Der wilde Klaus. Carlsen-Verlag, Hamburg 2004, ISBN 3-551-05747-8.
- ↑ Störtebeker (1919) in der Internet Movie Database (englisch)
- ↑ Störtebeker (2006) in der Internet Movie Database (englisch); Störtebecker, Internet-Seiten der ARD zum Film.
- ↑ Der wahre Schatz des Störtebeker in der Internet Movie Database (englisch)
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht .Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 24.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Claus Störtebeck und Michael Gädeke
156. Claus Störtebeck und Michel Gädeke.
Es sind schon über fünftehalb hundert Jahre vergangen, da hausete lange Zeit auf der Ostsee eine grausame Bande von Seeräubern, welche sich die Victualien- oder Vitalienbrüder nannten, weil sie nur von Raub und Beute lebten, oder auch Liekendeeler, weil man sagt, daß sie alle Beute zu gleichen Theilen unter sich vertheilt hätten. Die Anführer dieser Bande waren Claus Störtebeck und Michael Gädeke. Jener war aus der Stadt Barth in Pommern gebürtig. Der Letztere, der von den Leuten jetzt noch Gät-Michel genannt wird, soll von der Insel Rügen, oder wie Andere behaupten, aus dem Dorfe Michelsdorf auf dem Darß herstammen.
Diese Räuber trieben ihr Gewerbe auf der ganzen Ostsee; sie hatten eine Menge Niederlagen und geheime Schlupfwinkel, in die sie sich verkrochen, wenn sie einmal mit zu großer Macht verfolgt wurden. So bewohnten sie zu Zeiten die große Höhle unter dem Waschstein auf Rügen, die damals noch Niemand kannte; auch hatten sie ein festes Schloß auf dem Zingst, wo man am Prerower Strome noch jetzt die Trümmer einer Burg sieht, die von den Bewohnern das alte Schloß genannt werden. Dieses Schloß haben die Lübecker, die von den Räubern am meisten zu leiden hatten, im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts zerstört; sie sollen auf der Darßer Seite des Prerow- Stromes gelandet seyn und im Lager gestanden haben. Die Stelle heißt noch jetzt der Lübecker-Ort. Die Schätze der [195] Räuber sollen damals von den Lübeckern nicht gefunden seyn. Sie sollen vielmehr noch unter den Trümmern des alten Schlosses verborgen liegen, und man kann noch häufig des Nachts, wenn Vollmond ist, fremde Schatzgräber sehen, die mit allerlei Mitteln nach ihnen suchen.
Den Räubern selbst konnte man lange Zeit nicht ankommen; sie entkamen allen Verfolgungen glücklich. Das sollen sie den Gebeinen eines heiligen Märtyrers verdankt haben, die sie einmal aus einem Kloster an der Spanischen Küste gestohlen hatten, und die sie immer mit sich führten. Endlich aber, nachdem sie über dreißig Jahre ihr Unwesen getrieben, gelang es den Hamburgern, die eine große Seemacht zusammengebracht hatten, die ganze Bande nach einem überaus blutigen Seetreffen einzufangen. Zuerst bekamen sie den Claus Störtebeck mit 711 Gesellen, und darauf den Michel Gädeke mit noch 80. Die wurden allesammt zu Hamburg geköpft. Der Hamburgische Bürgermeister Simon von Uetrecht hatte ihnen das Todesurtheil gesprochen, und sie in ihren Prunkkleidern zum Richtplatze führen lassen. Aus der Beute, die man bei dieser Gelegenheit machte, ließen die Hamburger eine goldene Krone und einen großen übergoldeten Becher verfertigen. Die Krone hat lange den St. Nicolai-Thurm in Hamburg geziert; den Becher zeigt man allda noch.
Altes und Neues Rügen, S. 54. 55.
Der Darß und der Zingst, von A.v. Wehrs, S. 43-46.
Grümbke, Darstellung der Insel Rügen, I. S. 45-48.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren bzw. Versinonsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 24.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Gödeke Michels
Gödeke Michels († 1401 in Hamburg), auch Gottfried Michaelsen, war ein Seeräuber und einer der Anführer der Vitalienbrüder.
Leben
Zusammen mit Klaus Störtebeker, Hennig Wichmann, Klaus Scheld und Magister Wigbold, ebenfalls Anführer der Vitalienbrüder, machte der Schiffshauptmann Ende des 14. Jahrhunderts die Nord- und Ostsee unsicher. Sie besaßen schnelle Schiffe, die blitzartig die Koggen der Hanse aufbrachten und enterten. Dabei ging es ihnen in erster Linie darum, Beute zu machen, und nicht um den Kampf, sodass diejenigen, die sich nicht wehrten, meist „nur“ über Bord geworfen wurden.
Gödeke Michels wurde im Jahre 1401 kurz nach Klaus Störtebeker zusammen mit 79 Kumpanen auf dem Grasbrook vor der Hafeneinfahrt von Hamburg hingerichtet. In den Hamburgischen Chroniken in niedersächsischer Sprache heißt es:[1]
Anno 1401 wart to Hamborch Clawes Stortebeker vnd Godeke Mychel vor seerouer vpgehalet vnd myt eren gesellen vp dem Broke gekoppet.
Damals war Michels bekannter als Störtebeker. Sowohl Gödeke Michels als auch Störtebeker werden namentlich zuerst zu Beginn des Jahres 1394 erwähnt.[2]
Gödeke Michels soll – wie auch Klaus Störtebeker – in Ruschvitz auf der Halbinsel Jasmund auf Rügen als Bauernsohn aufgewachsen sein. Danach soll er als Knecht auf dem dortigen Gut gearbeitet haben. In Mecklenburg wird ein alter Burgwall des Gutes Schulenburg bei Sülz an der Recknitz als eine Burg von Störtebeker und Michels gezeigt.[3]
Literarische Bearbeitungen
Das Schicksal Gödeke Michels’ ist Thema der Ballade „Das Wiegenlied“ von Lulu von Strauß und Torney.
Darstellung im Film
Michels ist eine der Hauptfiguren in Sven Taddickens Spielfilm 12 Meter ohne Kopf, er wird von Matthias Schweighöfer verkörpert. Der Film behandelt das Leben von Klaus Störtebeker, Michels ist hier sein Freund.
Literatur
- Matthias Blazek: Seeräuberei, Mord und Sühne – Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292–1949. ibidem, Stuttgart 2012 ISBN 978-3-8382-0457-4
- Jörgen Bracker: Klaus Störtebeker – nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder. In: Wilfried Ehbrecht (Hrsg.): Störtebeker. 600 Jahre nach seinem Tod. Hansische Studien, Bd. 15, Porta-Alba-Verlag, Lübeck 2001 ISBN 3-933701-14-7
- Hilke Wilhelmsen (Hrsg.): In den Fängen der Hanse – Von den Kieler Burspraken. Hörspiel u. a. über das Leben Gödeke Michels und Störtebekers, basierend auf historischen Gegebenheiten, Kiel 2009
Einzelnachweise
- ↑ Hamburgische Chroniken in niedersächsischer Sprache, hrsg. v. Johann Martin Lappenberg, Perthes, Besser und Mauke, Hamburg 1861, S. 402. Ausführlich bei Blazek: Seeräuberei, 2012, S. 46.
- ↑ Herbold, Susanne: Gottes Freund und aller Welt Feind – Klaus Störtebeker im Roman und in der Geschichte, Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Germanistik – Neuere Deutsche Literatur, Akademische Schriftenreihe Bd. V195967, GRIN Verlag, München 2012, ISBN 978-3-656-21972-9, S. 9.
- ↑ Grässe, Johann Georg Theodor: „Claus Störtebeker und Gödeke Michels“, in: Sagenbuch des Preußischen Staats, 2. Bd., C. Flemming, Glogau 1868/71, S. 990.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 24.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Magister Wigbold
Bertram Wigbold (* 1365; † 1401 in Hamburg; auch Wygbold, Wycholt), allgemein Magister Wigbold oder auch „Magister der Sieben Künste“ genannt, war ein Seeräuber und einer der Anführer der Vitalienbrüder. Zusammen mit Klaus Störtebeker, Hennig Wichmann, Klaus Scheld und Gödeke Michels, ebenfalls Anführer der Vitalienbrüder, machte er Ende des 14. Jahrhunderts die Nord- und Ostsee unsicher.
Der Ausdruck Wigbold kommt von wig (= Streit) und bold (= tapfer).
Leben
Über das Leben des jungen Wigbold ist wenig bekannt. Er soll schon früh im Kloster aufgenommen und dort in den unterschiedlichsten Wissensbereichen unterrichtet worden sein. Dann soll er die Hochschule zu Rostock besucht haben, wo er später als Magister der Weltweisheit tätig gewesen sein soll.[1] Ludwig Bühnau schreibt hingegen, Wigbold habe (bei John Wyclif) in Oxford studiert.[2]
Er war keine besonders imposante Erscheinung und wird daher auch als „der listige Zwerg“ oder „das teuflische Gehirn“ beschrieben. Er soll einem bürgerlichen Gelehrten ähnlich gesehen haben, er sei lang und hager gewesen und habe ein dunkles Samtwams getragen.
Wigbold war nach der Darstellung in der Lübischen Chronik von Johannes Rufus (1406/30) ein gelehrter, geistlicher und weltlicher Meister („mester an den seven kunsten“, Magister der sieben [freien] Künste, das heißt, der sieben Buchgelehrsamkeiten).[3] Er soll in Verbindung zu dem englischen Radikalreformer John Wyclif gestanden haben.[4]
Er war angeblich nicht, wie Gödeke Michels oder Klaus Störtebeker, aktiv in die Kämpfe verwickelt und zog es vor, Verhandlungen zu führen, um somit wenige Verluste zu erleiden. Leonhard Wächter nennt Wigbold „Hauptmann Wigbold, einen rostockschen Magister Philosophiä ..., der seinen Stand auf dem Catheder gegen den auf dem Schiffskastell vertauscht hatte“.[5]
In der Literatur wird Wigbold den Hauptleuten der Likedeeler (Vitalienbrüder) zugerechnet (Unterfeldherr unter Michels) und gelegentlich als „Freund“ Störtebekers bezeichnet. Gödeke Michels und Wigbold und neben ihnen Wichmann und Störtebeker werden in der Lübischen Chronik zum Jahre 1395 als die Häuptlinge jener Seeräuber genannt, die sich nach der Befreiung König Albrechts von Schweden in den Städten Rostock und Wismar nicht mehr sicher fühlten und deshalb anderswo Zuflucht suchten.[6]
Die Nordener Autorin Gudrun Anne Dekker stellt fest: Möglicherweise waren es die Schieringer und Vitalienbrüder Junker Johann Sissingh(a) van Groningae und Wigbold (vermutlich Geschlecht von Ewsum aus Oert?). Letzterer war höchstwahrscheinlich als „Magister artium“ für die Erstellung der Gesetze der Groninger „Liekedeeler“ nach denen der Fratres Devoti verantwortlich.[7]
Die Vitalienbrüder oder (seit 1398) auch Likedeeler („Gleichteiler“; weil sie ihre Beute gerecht verteilten) machten lange die Nordsee unsicher, bis die Hanse zum Gegenschlag ausholte und die Gruppe um Störtebeker zerschlug. Michels und Wigbold entkamen zunächst nach Norwegen. Doch kurz nach dem Tod Störtebekers am 21. Oktober 1401 wurden auch Michels und Wigbold nebst etwa 200 Gefolgsleuten auf der Weser (und Jade) gefangengenommen und noch im gleichen Jahr in einer zweiten Hinrichtungswelle (insgesamt 80 Seeräuber) auf dem Grasbrook vor Hamburg hingerichtet.[8]
Störtebekers Hinrichtung und die seiner Gesellen Hennig Wichmann, Magister Wigbold und Gödeke Michels 1401 sind nur durch zwei Zeilen in einer alten Chronik belegt. Die kurze Hamburgische Chronik von 1457 berichtet nämlich: „Anno 1402 ward Wichmann unde Störtebeker afgehouwen altohand na Feliciani. Anno 1403 ward Wikbolt unde Goedeke Michael afgehouwen.“
Auf einem Flugblatt zum 300-jährigen Jubiläum der Gefangennahme, gedruckt bei Nicolaus Sauer, Hamburg 1701, heißt es (zu 1401):[9] „Im selbigen Jahr sind abermahl 80. See-Räuber aufgebracht / deren Hauptleute waren Gödecke Micheel und Gottfried Wichold / promovirter Magister Artium, sie wurden gleichfals auf dem Brocke enthauptet / und ihre Köpffe auf Pfähle / zu den vorigen gestecket.“
Im Historischen Taschenbuch von Friedrich von Raumer (1840) heißt es ergänzend: „Magister Wigbold hatte das Schicksal, alle seine Mitgesellen vor sich enthaupten zu sehen; er war der Letzte, den das Richtschwert traf.“[10]
Literatur
- Matthias Blazek: Seeräuberei, Mord und Sühne – Eine 700-jährige Geschichte der Todesstrafe in Hamburg 1292–1949. ibidem, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8382-0457-4.
- Thomas Einfeldt: Störtebekers Kinder. Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2002, ISBN 3-473-58200-X.
- Gustav Schalk: Klaus Störtebeker. Ueberreuter, Wien 2002, ISBN 3-8000-2876-X.
Einzelnachweise
- ↑ Jensen, Wilhelm: Osmund Werneking (Aus den Tagen der Hansa, Bd. 2), Berlin/Hamburg 2012, S. 19.
- ↑ Bühnau, Ludwig: Piraten und Korsaren der Weltgeschichte, Würzburg 1963, S. 93. In der Sekundärliteratur wird in diesem Zusammenhang behauptet, Wigbold sei später nach Oxford übergewechselt, wo er sich der Astronomie, der Erforschung algebraischer Gesetzmäßigkeiten, zugewandt habe. (Hansen, Konrad: Simons Bericht, Historischer Roman, 2010). Er habe die Lehren Wyclifs und John Balls, die eine maßgebliche Rolle spielten in dem großen Bauernaufstand, der 1381 England erschütterte, verbreitet. (Bernhard, Hans Joachim: Klaus Störtebeker in Ralswiek: Legende, Traum und Wirklichkeit, Rostock 1984, S. 59.)
- ↑ „Desser hovetmanne weren geheten Godeke Micheles vnde Wygbold, ein mester an den seven kunsten.“ Vgl. Hansische Geschichtsblätter, hrsg. vom Hansischen Geschichtsverein, Bd. 3, Leipzig 1881, S. 41. Chronik des Franciscaner Lesemeisters Detmar, nach der Urschrift, 2. Bd., Hamburg 1830, S. 463.
- ↑ Gaebel, Lotte: Herrscher, Helden, Heilige, Mittelalter-Mythen, Bd. 1, UVK, Fachverl. für Wiss. u. Studium, 1996, S. 462. Bei Carsten Misegaes, Chronik der freyen Hansestadt Bremen, Bd. 3, Bremen 1833, S. 81, wird der Titel Magister allerdings Michels zugesprochen: „Gödeke Michael, ein Edelmann und promovirter Magister der freyen Künste, welcher seinen Sitz in der Gegend von Verden hatte ...“
- ↑ Wurm, Christian Friedrich (Hrsg.): Leonhard Wächter's Historischer Nachlass, 1. Bd., Hamburg 1838, S. 154.
- ↑ Der sog. Rufus-Chronik zweiter Theil von 1395–1430, hrsg. v. Karl Koppmann, in: Die Chroniken der niedersächsischen Städte, Lübeck, 3. Bd., Leipzig 1902 (Die Chroniken der deutschen Städte, 28), S. 25–26.
- ↑ Dekker, Gudrun Anne: Ubbo Emmius: Leben, Umwelt, Nachlass und Gegenwart, Norderstedt 2010, S. 18. Dekker identifiziert Klaus Störtebeker im Ostfrieslandmagazin, 8/1991-1/1992 und 9/1993-1/1994, als „Junker Johann Sissingh(a)“ aus der Stadt Groningen. Vgl. ausf. Dekker, Gudrun Anne: Junker Johann Sissingh aus dem Groningerland = Klaus Störtebeker (Klaus Stürz-Den-Becher), Druckerei Eilts, Norden 1996.
- ↑ Über die Festnahme auf der Weser vgl. Wanke, Josef: Die Vitalienbrüder in Oldenburg (1395–1433), Königliche Universität Greifswald, 1910, S. 35.
- ↑ Der komplette Text steht bei Blazek (2012), S. 46.
- ↑ Raumer, Friedrich von (Hrsg.): Historisches Taschenbuch, Neue Folge, 1. Jahrg., Leipzig 1840, S. 103.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 24.05. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Peder Skram
Peder Skram (* zwischen 1491 und 1503 in Urup bei Horsens; † 11. Juli 1581 ebenda) war ein dänischer Admiral und Seeheld des 16. Jahrhunderts.
Peder Skram wurde auf dem Gut seiner Familie in Jütland geboren. Er war als Soldat 1518 in den Diensten von König Christian II. von Dänemark im Krieg gegen die Schweden erstmals im Einsatz und nahm 1520 an der Schlacht von Uppsala teil, wo er bereits mit einem Gut in Norwegen für seine Verdienste auf dänischer Seite ausgezeichnet wurde.
Während der Grafenfehde erlangte er als Admiral der Dänischen Flotte den Ruf eines Nationalhelden. Er kam im Auftrage Dänemarks den Schweden unter Gustav I. Wasa, der sich mit König Christian III. von Dänemark verbündet hatte, gegen die Flotte der wendischen Städte der Hanse unter Führung Lübecks zur Hilfe. Die Lübecker hatten sich als Verbündete von König Christian II. gegen Wasa gewandt, weil dieser die Lübecker als seine ursprünglichen Verbündeten in ihrer Erwartung auf schwedische Handelsprivilegien enttäuscht hatte. Peder Skram besiegte zunächst am 9. Juni 1535 mit einer aus 33 Schiffen bestehenden Flotte einen kleinen Hansischen Flottenverband bei der Insel Bornholm und anschließend in den Großteil der Lübecker Flotte bei der Schlacht von Svendborg im Svendborg Sund vor Fünen. Diese Seeschlacht war die eigentliche Entscheidungsschlacht der noch länger andauernden Grafenfehde mit der Christian III. den Sieg über die Hanse unter Lübecker Führung errang.
Im Dreikronenkrieg wurde Peder Skram durch König Friedrich II. von Dänemark noch einmal als Admiral und Oberkommandierender der dänischen Flotte reaktiviert. 1562 traf er bei Gotland auf die überlegene Flotte der Schweden unter deren Admiral Jakob Bagge. Zum Ende des Jahres wurde Skram allerdings durch den Admiral Herluf Trolle abgelöst.
Literatur
A. Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte, 1989, ISBN 3-7950-3203-2
Hermann Kirchhoff: Seemacht in der Ostsee II. Band: Ihre Einwirkung auf die Geschichte der Ostseeländer im 19. Jahrhundert. Nebst einem Anhang über die Vorgeschichte der Ostsee. Kiel 1908, S. 286 - 289 Digitalisat
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 06.06. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Peder Skram - En Version
Peder Skram (died 11 July 1581) was a Danish senator and naval hero, born between 1491 and 1503, at his father's estate at Urup near Horsens in Jutland.
He first saw service in the Swedish war of Christian II at the battle of Brännkyrka, 1518, and at the battle of Upsala two years later he saved the life of the Danish standard-bearer. For his services in this war he was rewarded with an estate in Norway, where he settled for a time with his young consort Elsebe Krabbe.
During the Count's Feud (Danish: Grevens fejde), Skram, whose reputation as a sailor was already established, was sent by the Danish government to assist Gustavus Vasa, then in alliance with Christian III against the partisans of Christian II, to organize the untried Swedish fleet; and Skram seems, for the point is still obscure, to have shared the chief command with the Swedish Admiral Mans Some. Skram greatly hampered the movements of the Hanseatic fleets who fought on the side of Christian II; captured a whole Lübeck squadron off Svendborg, and prevented the revictualling of Copenhagen by Lübeck. But the incurable suspicion of Gustavus I minimized the successes of the allied fleets throughout 1535. Skram's services were richly rewarded by Christian III, who knighted him at his coronation, made him a senator and endowed him with ample estates.
In 1555, feeling too infirm to go to sea, he resigned his post of admiral; but when the Scandinavian Seven Years' War broke out seven years later; and the new king, Frederick II, offered Skram the chief command, he agreed to go. With a large fleet he put to sea in August 1562 and compelled the Swedish admiral, after a successful engagement off the coast of Gotland, to take refuge behind the Skerries.
This, however, was his sole achievement, and he was superseded at the end of the year by Herluf Trolle. Skram now retired from active service, but was twice (1565–1568) unsuccessfully besieged by the Swedes in his castle of Laholm. His estates in Halland were also repeatedly ravaged by the enemy. Skram died; at an advanced age, at Urup on 11 July 1581.
Skram's audacity won for him the nickname of "Denmark's Dare-devil", and he contributed perhaps more than any other Dane of his day to destroy the Hanseatic dominion of the Baltic. His humanity was equally remarkable; he often imperilled his life by preventing his crews from plundering.
Further reading
- Axel Larsen, Dansk-Norske Heltehistorier (Copenhagen, 1893)
References
- Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Skram, Peder". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 06.06. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Peder Skram - DK Version
Peder Skram (født ca. 1503 – 11. juli 1581). "Danmarks vovehals". Rigsråd, admiral. Hans forældre var Christiern Skram og Anne Knudsdatter Reventlow. Gift med Elsebeth, der var datter af rigsmarsk Tyge Krabbe. I løbet af deres lange ægteskab fik Peder Skram og Elsebeth Krabbe i alt 18 børn; 7 sønner og 11 døtre. Tre af døtrene døde ved fødslen og kun én af sønnerne og syv af døtrene overlevede deres forældre. Alene i 1566 døde fire af deres sønner.
Deltog med Henrik Gøye i felttog i Sverige og frelste ved Uppsala Mogens Gyldenstierne. Da Christian 2. var fordrevet, var Peder Skram med ved belejringen af København i 1523.
I 1532 sejlede han med en lille flåde til Norge for at finde Christian 2.'s fem skibe. Han opbragte dem ved Tønsberg og undsatte Mogens Gyldenstierne på Akershus.
Hertug Christian sendte ham efter anmodning fra Gustav Vasa til Stockholm i 1535 for at kommandere den svenske flåde, der sammen med danske og preussiske skibe skulle bryde Lübecks overmagt. Blev leder af alle flådeafdelingerne, hjulpet af den svenske admiral Per Månsson.
Efter at have jaget modstanderens flåde på flugt ved Bornholm, fortsatte han til Lillebælt, hvor han ødelagde en del fjendtlige skibe og sikrede Johan Rantzaus overførsel af tropper til Sjælland efter sejren i Slaget ved Øksnebjerg.
Peder Skram indtog herefter Langeland og Korsør. Fra juli 1535 blokerede han med flåden København og Malmø. Han blev såret, men vendte tilbage til blokaden indtil overgivelsen 29. juli 1536.
Ved Christian 3.'s kroning 1537 blev han slået til ridder og i 1539 optaget i rigsrådet. Da Den Nordiske Syvårskrig i 1563 brød ud, havde han kommandoen over den danske flåde.
Lensmand på Laholm fra 1558 (afgiftslen) – han slog flere fjendtlige angreb tilbage i 1565 og 1568.
Selv ejede han herregården Urup og fik i 1536 Harritsborg len, som han samme år ombyttede med Helsingborg Len. Peder Skram skrives i 1548 til Helsingborg Len og Landskrone slot, og han lagde grundstenen til Landskrone slot i 1549.
Henvisning
- Briand de Crévecouer, E. (1950). Peder Skram. Danmarks Vovehals. Gyldendal.
Eksterne henvisninger
- Peder Skram på gravsted.dk
Se også
- Fregatten Peder Skram 1966 – 1988
- Panserfregat Peder Skram 1864 – 1885
- Kystforsvarsskibet Peder Skram 1908 – 1949
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 06.06. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Grafenfehde
Die dänische Grafenfehde (dänisch: Grevens fejde) war ein zwischen 1534 und 1536 andauernder Bürgerkrieg in Dänemark und hat seinen Namen von den Grafen Christoph von Oldenburg und Johann von Hoya.
Vorgeschichte
Zur Vorgeschichte der Grafenfehde gehört die Absetzung des dänischen Königs Christian II. 1523 durch seinen Onkel Friedrich I. Mit Lübecker Unterstützung war Christian II. 1532 endgültig besiegt und in Schloss Sonderburg gefangen gesetzt worden. Lübeck erhielt als Lohn weitreichende Privilegien in Dänemark.
Als 1533 Friedrich I. starb, konnte sich der dänische Reichsrat auf keinen Nachfolger einigen. Von Friedrichs ältestem Sohn, dem der Reformation zugeneigten Herzog Christian (später König Christian III.), befürchteten die katholischen Adeligen die Beschneidung ihrer Macht. Der jüngere Sohn Johann war zwar unter ihrem Einfluss aufgewachsen, doch noch nicht volljährig. Man verschob daher die Königswahl um ein Jahr. Lübeck unter seinem Bürgermeister Jürgen Wullenwever bot Herzog Christian, der bislang nur im Norden des Herzogtums Schleswig regierte, seine Unterstützung an, in der Hoffnung auf Verlängerung der Handelsvorteile. Der Herzog lehnte ab, um die Lande unter der dänischen Krone von der Handelsvormacht der Hanse zu befreien. In dieser Situation bat der Oldenburger Graf Christoph die Lübecker um Kriegshilfe zur Befreiung seines gefangenen Vetters Christian II. Auch der Graf von Hoya sowie die evangelischen Städte Kopenhagen und Malmö unter den Bürgermeistern Ambrosius Bogbinder und Jörgen Kock beteiligten sich an den Kämpfen gegen den noch katholischen dänischen Adel.
Dänemark ohne König in Bedrängnis
Im Frühjahr 1534 brach der Krieg aus. Ohne Kriegserklärung fiel der Lübecker Feldherr Marx Meyer in Holstein ein und verwüstete Trittau, Reinbek, Eutin und Segeberg sowie einige Herrenhäuser der Familie Rantzau. Zur selben Zeit gelang Graf Christoph schnell die Eroberung von Seeland und Fünen. So wurde die Herrschaft über den Sund errungen und Lübeck konnte den Sundzoll für sich beanspruchen. Gleichzeitig erhoben sich die jütischen Bauern unter Skipper Clement.
Angesichts des anscheinend mühelosen Sieges schlossen sich nun auch die Hansestädte Stralsund, Rostock und Wismar sowie die Dithmarscher Bauern und der Mecklenburger Herzog Albrecht VII. dem Bündnis gegen den dänischen König an. Um weitere Unterstützung zu gewinnen, bot Wullenwever die dänische Krone nicht nur dem oldenburgischen Grafen, sondern auch dem englischen König und dem Kurfürsten von Sachsen an. Dem mecklenburgische Herzog, der sich Hoffnungen auf Dänemark gemacht hatte, wurde die schwedische Krone versprochen, denn Wullenwever beabsichtigte nun auch den in seinen Augen undankbaren Gustav Vasa zu stürzen.
Das führte zu Streit und mangelnder Kooperation unter den Verbündeten. Auch schickten die Fürsten lange nicht genügend Truppen und besoldeten diese zudem so schlecht, dass die Kampfmoral nach den ersten Erfolgen sank.
Wende zugunsten Dänemarks
Erst in dieser bedrängten Lage - fast ganz Dänemark war in der Hand der Feinde - ernannte der Reichsrat am 10. August 1534 den Herzog zum König Christian III. - und büßte dafür tatsächlich einen Großteil seines Einflusses ein. Damit wendete sich das Blatt: Nachdem der Frieden von Stockelsdorf im November 1534 den Krieg in Holstein beendet hatte, erstarkten die nun unter einem König vereinten Dänen gegenüber den untereinander zerstrittenen Angreifern. Unterstützung erhielt Christian III. durch Gustav Vasa und seinen Schwager, den preußischen Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach.
Nach der Niederschlagung des Bauernaufstandes und Graf Christophs Niederlage auf Fünen gegen Johann Rantzau unterlag die Lübecker Flotte im Juni 1535 in den Seeschlachten bei Bornholm und bei Svendborg schließlich gegen eine vereinte dänisch-schwedisch-preußische Flotte unter dem dänischen Admiral Peder Skram.
Im Juli kapitulierte Lübeck. Durch die Niederlage Lübecks wurde die Hanse politisch entscheidend geschwächt. Wullenwever, der im August 1535 in Lübeck abgesetzt worden war, versuchte den Krieg auf eigene Faust fortzuführen. Im November 1535 wurde er südlich von Hamburg festgenommen, als er versuchte, Unterstützungstruppen für das belagerte Kopenhagen zu werben, und 1537 hingerichtet. Marx Meyer hielt bis zum Mai 1536 in der belagerte Festung Varberg aus.
Die Grafenfehde selbst endete erst am 6. August 1536 mit der Kapitulation Kopenhagens nach über einjähriger Belagerung.
Literatur
- Friedrich von Alten: Graf Christoff von Oldenburg und die Grafenfehde (1534-1536). Perthes-Besser & Mauke, Hamburg 1853 (Digitalisat).
- Matthias Asche, Anton Schindling: Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Aschendorff Verlag, 2002, ISBN 3-402-02983-9.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 06.06. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|
|
Wenden
Wenden (auch Winden, lateinisch Venedi) bezeichnet diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania Slavica) bewohnten, heute meist als Elbslawen bezeichnet. Sie dürfen nicht mit den „Windischen“ (Slowenen) im Alpenraum verwechselt werden, die zu den Südslawen gehören und deren deutsches Ethnonym auf dieselbe Wortwurzel wie „Wenden“ zurückgeht.
Wortherkunft
Das Ethnonym „Wenden“ ist in verschiedenen Varianten seit dem 6. Jahrhundert in der schriftlichen Überlieferung nachweisbar. Verwendet wurde es zuerst als unpräziser Sammelbegriff für verschiedene Gruppen von Menschen, heute als Slawen bezeichnet, und geht auf eine germanische Fremdbezeichnung zurück.
Im Lateinischen ist die Bezeichnung weiterhin Vandalia bzw. Vandalorum (Wendenland) geblieben.
Im östlichen Germanien, wo einst Wandalen wohnten, kamen mit der Völkerwanderung und den Anstürmen aus Asien späterhin verschiedene Volksgruppen, die dann zusammengefasst Wenden genannt wurden. Der polnische Chronist Vinzenz Kadlubek ging noch einen Schritt weiter und erfand die Wanda (Sage), um dem neu geschaffenen Herzogtum der Polanen eine weit zurückreichende Geschichte zu beschaffen. Kadlubeks vielfach wiederholte und als wahr ausgelegte Geschichte setzte Polen mit Wandalen gleich und nannte den Fluss, an dem seine „Wanda“ und ihr Volk lebte, „Wandalus“ (Weichsel).
Der Slawist Aleksander Brückner stellte folgendes über Mag. Vincenz Kadlubek und dessen Sagenerfindungen fest: „Nur ein einziger von allen, die sich je mit polnischer Urgeschichte beschäftigt haben, hat das Richtige eingesehen, der Lemberger Erzbischof Gregor von Sanok im XV. Jahrh. (…) (er hat) die Angabe des Mag. Vincentius zurückgewiesen (…) Gregor erkannte richtig, dass allein die falsche Gleichung Poloni = Vandali den Mag. Vincentius zur Ansetzung seiner Vanda verführt hatte und wies sie folgerichtig ab; alle seine Nachfolger sind weniger vorsichtig gewesen und haben nur Irrthümer auf Irrthümer gehäuft. Da die Polen keinerlei Tradition aufweisen konnten, hat Mag. Vincentius die Legenden erfunden.“[1]
Das Wort Wenden wird auch in Zusammenhang mit dem lateinischen (und altgriechischen) Namen Venetae gebracht, mit dem zur Zeitenwende und in der römischen Kaiserzeit drei verschiedene Völker bezeichnet wurden: Die keltischen Veneter lebten zur Zeit Caesars nördlich der Loiremündung in Gallien. Die Veneter der östlichen Alpen und nördlichen Adria haben kurze schriftliche Zeugnisse zurückgelassen und werden unsicher als italisch oder illyrisch eingeordnet. Die dritten Venetae oder Venedae waren im römischen Reich nur vom Hörensagen bekannt. Den Autoren Plinius, Tacitus, Ptolemaios und im frühesten Mittelalter Jordanes zufolge lebten sie im Baltikum oder anderweitig östlich der Weichsel. Nach der differenziertesten Darstellung des Ptolemäus dürften sie Balten gewesen sein. Als slawisch kommen nach seiner Beschreibung eher die Sulones und die Stavani infrage, deren Gebiet sich weit bis zu den Alauni (Alanen) erstreckte.[2]
Aus den überlieferten Aufzeichnungen frühmittelalterlicher Autoren wird allgemein geschlossen, das aus der Antike überkommene Wort sei mit dem Erscheinen der Slawen von den Germanen auf ihre neuen unbekannten slawischen Nachbarn übertragen worden, ähnlich wie welsch, Welsche oder Wallische, das etymologisch auf einen keltischen Stamm der Volcae zurückgeht und dann auf die Romanen (Schweiz, Italien), in Britannien auf die keltischen Cymrer (Kambrier) in Wales angewandt wurde.
Das finnische Wort für Russland ist „Venäjä“, das für Russen „Venäläiset“, die schwedischen Wörter sind „Ryssland“ bzw. „Ryss“. Die finnischen Wörter „Ruotsi“ und „Ruotsalaiset“ bezeichnen hingegen das Land und das Volk der Schweden – eine Erinnerung an den skandinavischen Ursprung der einst im Gebiet des heutigen Russland siedelnden Waräger und ein möglicher Hinweis auf eine von antiken Vorbildern unabhängige Bezeichnung für Slawen mit dem Wortstamm „ven…“.
Die Bezeichnung Wenden findet sich in diesem Sinne mehrfach:
- Die Veneter an der mittleren Weichsel wurden Jordanes zufolge um 350 von den Ostgoten unterworfen.
- Die im bairischen bzw. oberdeutschen Sprachraum übliche Version „Windisch“ wurde ursprünglich für slawische Nachbarn sowohl nördlich als auch südlich der Alpen gebraucht. Später bezeichnete „Wendisch“ bzw. „Wenden“ nur noch die Elbslawen, während „Windisch“ die Bezeichnung für die slowenische Sprache wurde.
- Die Baiuwaren bezeichneten vor allem einen zu den Alpenslawen als Teil der Südslawen gerechneten Stamm als Windische. In Verbindung mit der zeitgenössischen Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi könnte dies eine sekundäre Übertragung des ursprünglich auf die antiken Alpenbewohner bezogenen Namens sein. Die Eigenbezeichnung dieser Slawen war Karantanen. 631 wird in der Fredegar-Chronik Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner gehören zu den Vorfahren der heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen.
- „Windisch“ ist allerdings auch Namensbestandteil mehrerer einstmals slawisch besiedelter Orte nördlich der Donau, etwa Windischeschenbach im Norden der Oberpfalz, der Weiler Windisch Bockenfeld westlich von Rothenburg ob der Tauber und Windischbuch beim nordbadischen Boxberg.
Zur Gleichsetzung der Bezeichnungen Wenden und Vandalen siehe hier: → Vandalen
„Wendisch“ und „Windisch“
„Windisch“ ist die traditionelle deutsche Bezeichnung für die slowenische Sprache. Seit dem Zerfall der Donaumonarchie wurde diese Bezeichnung aus politischen Gründen auf die Slowenischsprachigen in der Republik Österreich eingegrenzt und dem Slowenischen in Jugoslawien bzw. der Republik Slowenien gegenübergestellt. So ist im heutigen Österreich „Windische“ eine verbreitete Bezeichnung für die im Grenzgebiet lebenden Kärntner sowie die Eigenbezeichnung derjenigen, die diese Sprache (Mundart) verwenden, aber nicht als Slowenen gelten wollen.
„Wendisch“ (elbslawisch) und „Sorbisch“
Die deutsche Eigenbezeichnung der alteingesessenen Slawen in der (brandenburgischen) Niederlausitz ist Gegenstand von Auseinandersetzungen. Während vor allem in der DDR die einheitliche Bezeichnung Sorben für die Slawen der Nieder- und Oberlausitz verwendet wurde, verstehen sich viele Niederlausitzer als Wenden in Abgrenzung zu den Sorben in der (sächsischen) Oberlausitz. In diesem Sinne wird auch die slawische Sprache in der Niederlausitz als Wendisch oder Niedersorbisch bezeichnet, wovon sich das (Ober-)Sorbische in der Oberlausitz unterscheidet. Mittlerweile tritt nur die Bezeichnung Sorbisch als kulturelle Einheit und anerkannte Minderheit in der gesamten Lausitz heraus.
Geschichte
Seit dem späten 6. Jahrhundert und im 7. Jahrhundert wanderten Slawen in die oben genannten Gebiete der Germania Slavica ein. Dabei wurden in der Zeit um 600 und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts zunächst die Gebiete entlang der Elbe und unteren Saale aufgesiedelt. Ab dem Ende des 7. Jahrhunderts und verstärkt im 8. Jahrhundert erfolgte die Besiedlung der nördlich davon liegenden Regionen bis zur Ostsee. Zu einer Herausbildung von „Stämmen“ und „Stammesverbänden“ (Ethnogenese) kam es erst infolge der Landnahme in den neu erschlossenen Siedlungsräumen. Einen Höhepunkt der westslawischen Entwicklungsgeschichte stellt die frühe „Staatsbildung“ der Abodriten im Raum des heutigen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburgs im 11. Jahrhundert dar. Die Slawen kämpften gegen Dänen und Deutsche um die Vorherrschaft im südlichen Ostseeraum (etwa im Wendenkreuzzug) und unterlagen schließlich. Auch auf den dänischen Inseln Lolland und Falster gab es slawische Siedlungen.
Im Laufe der mittelalterlichen Ostkolonisation ab dem 11. Jahrhundert, verstärkt aber erst im 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert, kam es zu einer Verschmelzung der Elbslawen mit den neu zugewanderten deutschen Siedlern und zur Herausbildung sogenannter „deutscher Neustämme“ der Brandenburger, Mecklenburger, Pommern, Schlesier und Ostpreußen (Die Ostpreußen sind jedoch nicht aus Deutschen und Wenden, sondern aus Deutschen, baltischen Pruzzen, Litauern und polnischen Masowiern entstanden). Die westslawischen Sprachen und Dialekte im Heiligen Römischen Reich wurden in einem jahrhundertelangen Prozess der Germanisierung – nicht selten durch Restriktionen (Gebrauchsverbote) – zurückgedrängt. Im 15. Jahrhundert wurde der Gebrauch der wendischen Sprache auf den Gerichten in Anhalt untersagt. Sie wurde jedoch im Alltag weiter verwendet, und noch Martin Luther schimpfte über „wendisch sprechende“ Bauern in der Gegend von Wittenberg. In einigen Gebieten wie im niedersächsischen Wendland (siehe auch Drawehn) oder in der brandenburgisch-sächsischen Lausitz konnten die Slawen ihre kulturelle Eigenständigkeit und ihre Sprachen bis weit ins 18. Jahrhundert beziehungsweise bis heute bewahren.
„Schwebendes Volkstum“ nach 1945
Ein recht widersprüchliches Schicksal erlebten die von der polnischen Regierung als „autochthone Slawen“ betrachteten Bevölkerungsteile der deutschen Ostgebiete nach 1945 (im südlichen Ostpreußen, Ostpommern und in Oberschlesien). Teilweise waren sie 1945 mit den anderen Bewohnern vor der Roten Armee in den Westen geflüchtet oder wurden unmittelbar nach Kriegsende als Deutsche vertrieben und gingen dann in der neuen Heimat in der deutschen Bevölkerung auf. Nach einer kurzen Übergangszeit hinderten die polnischen Behörden jedoch als Slawen betrachtete Bevölkerungsteile am Verlassen der Heimat und zwangen sie zu einer s.g. „Verifikation“ (weryfikacja)[3] als ethnische Polen. Sie sind nach 1945 teilweise im polnischen Volk aufgegangen (Masuren, Schlesier), haben zu ihrer eigenen Identität gefunden (Kaschuben in den ostpommerschen Landkreisen Bütow und Lauenburg) oder aber definieren sich nunmehr – sich der Polonisierung widersetzend – als deutsche Minderheit, mitunter auch einfach als „Schlesier“. Die Wissenschaft hatte diesen Zustand der nichteindeutigen Volkszugehörigkeit früher „schwebendes Volkstum“ genannt:[4][5][6][7] Diese Menschen waren der Abstammung nach eher Slawen, bedienten sich aber nur noch teilweise der slawischen Sprache (oft nur als „Haussprache“), fühlten sich aber eher als Deutsche. Nach 1945, als die deutschen Provinzen östlich der Oder an Polen fielen, sollten ihre Nachfahren zunächst „polonisiert“ (als eigentliche Slawen ins polnische Volk integriert) werden. Da sie sich dem aber widersetzten, weil sie sich inzwischen längst als Deutsche fühlten, ließ man sie schließlich in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen.[8]
Geschichtsschreibung
Geschichtliches über die Wenden ist bereits von zeitgenössischen Chronisten aufgeschrieben worden, insbesondere von Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Helmold von Bosau und Saxo Grammaticus, allerdings nicht unter langfristiger Perspektive. Im 15. Jahrhundert waren die Wenden in die im Rahmen der deutschen Ostsiedlung gebildeten Neustämme, an deren hochmittelalterlichem Landesausbau sie teilnahmen, zwischen Elbe und Oder, Ostsee und Fläming nahezu restlos integriert. Den ersten großen Rückblick auf die insoweit abgeschlossene Geschichte der Wenden gab 1519 der Hamburger Gelehrte Albert Krantz. Der Kurztitel “Wandalia“ seiner “Beschreibung Wendischer Geschicht“ zeigt, dass er im Rückgriff auf antike römische Schriftsteller die Wenden irrigerweise für die Nachkommen der Vandalen (nicht der Veneter) hielt, also eines ostgermanischen Stammes; allerdings war diese falsche Gleichsetzung bereits im Mittelalter gängig gewesen. Der auch in Lübeck tätig gewesene Staatsmann Krantz begann sein Werk mit den Worten:
„In diesem Strich deß Wendischen Lands Seewärts, an den die Wenden (welche die unserigen auch Sclauen heissen) vor Jahren und jetzt die Sachsen bewohnen, haben ehemals schöne herrliche Städte gelegen, deren Macht so groß gewesen, daß sie auch den gewaltigen Königen von Dennemarck offtmals zu schaffen gegeben, die nun theils gantz umbgekehret, theils aber wie sie außgemergelt zu geringen Flecken und Vorwercken seyn gemacht worden. Gleichwol seyn unter Regierung der Sachsen, an deren stadt andere, so Gott lob jetzt in vollem Reichthumb und Macht stehen, erbawet, die sich auch deß alten Nahmens dieser Länder nicht schämen und daher noch heutiges Tages die Wendischen Städt heissen. Umb deren willen bin ich desto williger gewesen, diese Wendische Historien zu schreiben. Unnd will nunmehr hinfort anzeigen, was diese Nation vor vndenklichen Jahren für Thaten außgerichtet, was für Fürsten darinn erzogen und geboren vnnd was noch jetzunder für schöne Städte in dieser gegend an der See vorhanden.“
– Albert Krantz Wandalia
Im „V. Capitel“ fährt er fort:
„Nach dem die Sachsen diese Wendische länder unter sich vnnd in die eusserste Dienstbarkeit gebracht, ist dieser Nahme dermassen verächtlich, daß, wenn sie erzürnen, einen der Leibeigen vnd ihnen stets vnter den Füssen ligen muß, anderst nicht denn einen Sclauen schelten. Wenn wir aber vnser Vorfahren Geschichte vnd Thaten vns recht zu gemüht führen vnd erwegen, werden wir vns nicht für ein Laster, sondern für eine Ehre zu ziehen, daß wir von solchen Leuten hergeboren.“
– Albert Krantz Wandalia
Krantz bezieht sich immer wieder auf die bekanntesten Chronisten Adam, Thietmar, Helmold und Saxo, wobei er vor allem das Rühmliche hervorhebt, zum Beispiel die von Adam geschilderte Pracht von Vineta. Das Heidentum der Slawen erwähnt er zwar auch, aber ohne die bei den Chronisten übliche Abscheu, denn für Krantz sind die Wenden ja ursprünglich ein Stamm der Germanen gewesen, die ebenso heidnisch waren. In ihrem Kampf gegen das Reich unterscheiden sich für ihn die Wenden nicht von den Dänen. Krantz behandelt alle slawischen Völker Europas, aber im Mittelpunkt seines Interesses steht das Land der Obotriten, auf dem das „Wendische Quartier“ der Hanse entstand. Auch auf die Mark Brandenburg geht er ein („Die Marck Brandenburg ist der vornembsten theile einer mit von den Wendischen landen“), zunächst auf den markgräflichen Besitz auf dem Westufer der Elbe:
„Vnd will ich erachten, daß zu den zeiten der dreyer Ottonum die Sachsen nach außtreibung der Wenden diese Länder albereit innegehabt. Denn auch Keiser Heinrich, Ottonis des grossen Vater, hat die eroberte Stadt Brandenburg zu einer Sächsischen Colonien gemachet vnnd dahin einen Marggraffen verordnet, dessen Nachkömmlinge einen herrlichen Tittel von ihm auff sich gestammet. […] Wie nun die Sachsen wiederumb sich gesterckt [nach dem Slawenaufstand 983], haben sie durch beider Herren Hertzogen Heinrich und Marggraf Albrechten macht den mehrer theil der Wenden erschlagen vnnd die vbrigen vertrieben.“
– Albert Krantz Wandalia
Die märkischen Geschichtsschreiber Johann Christoph Bekmann (1641–1717) und Jacob Paul von Gundling (1673–1731) haben in ihren Geschichtswerken „Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg“ beziehungsweise „Leben und Thaten des Herrn Albrechten des Ersten, Markgrafen zur Brandenburg“ ausdrücklich Bezug genommen auf den „berühmten Skribenten Crantzius“, haben aber dessen Sicht auf die Wenden nichts qualitativ Neues hinzugefügt. Alle drei kannten die für die Entstehung der Mark Brandenburg wichtigste Quelle (Heinrich von Antwerpen, etwa 1150 bis 1230) nur in Bruchstücken ohne Kenntnis der Zusammenhänge und des Autors.
Dies war auch der Kenntnisstand Fontanes, als er 1873 im Band „Havelland“ seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ das Kapitel schrieb: „Die Wenden und die Kolonisation der Mark durch die Zisterzienser.“ Wie auch Bekmann und Gundling übernahm er von Krantz die Stichworte „Ermordung und Vertreibung der Wenden durch die Sachsen“ und „Kolonie“ („Ostkolonisation“). Ohne die Quelle Heinrich von Antwerpen (und die heutigen Forschungsergebnisse) war ihnen nicht oder nicht ausreichend bewusst, dass Albrechts Zeitgenossen Pribislaw-Heinrich von Brandenburg und Jaxa von Köpenick bereits seit Geburt Christen waren, wie nahezu alle slawischen Fürsten dieser Zeit. Auch war ihnen der bereits zu Beginn seiner Regierungszeit von Pribislaw mit Albrecht dem Bären abgeschlossene Erbvertrag über seine Nachfolge im Hevellerland unbekannt. Die beiden klassischen Topoi der Geschichtsschreibung über die Wenden in der Mark Brandenburg, nämlich „blutiger Kampf“ und „Christianisierung“ haben daher nicht die Bedeutung, die die heutige Populärliteratur ihnen noch immer beimisst. Der Erbvertrag mit Pribislaw und das Christentum von Jaxa werden zwar inzwischen korrekt berichtet, ohne aber das Gesamtbild der Wenden als kampfwütige Heiden ohne Kultur (Fontane: „Unkultur“[9]) zu korrigieren. Dies ist um so erstaunlicher, als der Hamburger Staatsmann Krantz, der am Anfang der Geschichtsschreibung über die Wenden stand, es sich als Ehre anrechnete, von den Wenden abzustammen.
Siedlungsformen
Typisch für die Siedlungsform der Wenden sind Rundlingsdörfer. Die im Mittelalter während der Binnenkolonisation entstandene Dorfform weist eine hufeisenförmige Anordnung der Bauernhäuser und Grundstücke auf. Der Verbreitungsraum des Rundlings erstreckt sich streifenförmig zwischen der Ostsee und dem Erzgebirge in der damaligen Kontaktzone zwischen Deutschen und Slawen. Am besten erhalten haben sich Rundlingsdörfer in der wirtschaftsschwachen Region des hannoverschen Wendlands. Die slawischen Siedlungsformen vor den Rundlingen sind bisher nicht ausreichend archäologisch erforscht.[10]
Religion und Kultur der Elbslawen
Bis in das 11. und 12. Jahrhundert hinein waren die nördlichen Elbslawen von nichtchristlichen Kulten dominiert. Während zunächst Heilige Haine und Gewässer als Kultorte verehrt wurden, bildeten sich im 10. und 11. Jahrhundert allmählich ein Priestertum und Kultstätten heraus, die oft auch überregionale Bedeutung hatten. Beispiele sind hier die Tempelburgen in Kap Arkona (Rügen) und Rethra. Wichtige slawische Gottheiten waren Radegast und Triglaw. Die Götter der Götterwelt anderer slawischer Völker existierten auch hier, jedoch bildeten sich stärker als anderswo Stammesgottheiten heraus. Oftmals veränderten alte Götter ihre Bedeutung.
Die Slawen im Elbe-Saale-Gebiet und in der Lausitz gerieten schon früher unter den Einfluss der christlichen Kirche. 968 wurde das Erzbistum Magdeburg mit den Suffraganen Zeitz, Merseburg und Meißen eingerichtet und die Christianisierung weiter vorangetrieben.
Sprachen und Dialekte der Elbslawen
Jahrhundertelang war das Deutsche Reich östlich von Elbe und Saale zweisprachig. Neben den deutschen Dialekten wurden noch lange Zeit westslawische Sprachen und Dialekte gesprochen. Im 15. Jahrhundert starb der Dialekt der Ranen auf der Insel Rügen aus, erst im 18. Jahrhundert der polabische der Drevanen/Drevänopolaben im Hannoverschen Wendland. Der protestantische Teil der Kaschuben, die Slowinzen, die in Hinterpommern lebten, verloren ihr kaschubisches Idiom etwa um 1900. Die kaschubische Sprache wird allerdings noch heute weiter östlich im ehemaligen Westpreußen und der jetzigen polnischen Woiwodschaft Pommern gesprochen. Neben dem Kaschubischen ist die sorbische Sprache der Lausitzer Sorben die einzig noch verbliebene Sprache der Wenden. Die Zahl der Sorbischsprecher schätzt man heute auf 20.000 bis 30.000 Menschen, um 1900 noch etwa 150.000. Kaschubisch wird heute von 50.000 Menschen als Alltagssprache benutzt.
Elbslawische Stämme und Stammesverbände
In Quellen aus dem ostfränkisch-Deutschen Reich werden eine große Zahl von Stämmen und Stammesverbänden, insbesondere seit dem 8. Jahrhundert, genannt. Die größten Verbände waren die der Abodriten, Wilzen und Sorben (von Nord nach Süd). Jedoch bleibt häufig unklar, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Es dürfte sich nicht, wie im 19. und 20. Jahrhundert zumeist angenommen, um festgefügte, homogene und scharf umrissene Gruppierungen gehandelt haben. Vielmehr ist von recht mobilen Gruppierungen auszugehen, die in ihrer Zusammensetzung und Abgrenzung relativ flexibel waren.
In der Beschreibung des so genannten Bayerischen Geographen (Geographus Bavarus) aus der Mitte des 9. Jahrhunderts mit späteren Überarbeitungen und Zusätzen werden die zu dieser Zeit bekannten Stämme und die Zahl der ihnen zugehörigen civitates – Siedlungskammern mit einer zentralen Burganlage und zugehörigen Siedlungen und kleinere Befestigungen – genannt (Völkertafel von St. Emmeram).
- Abodriten/Obodriten mit mehreren Teilstämmen; zwischen Kieler Förde und mittlerer Warnow
- Obodriten im engeren Sinne von der Wismarer Bucht bis südlich des Schweriner Sees, Hauptburgen Dobin, Mecklenburg, Schwerin)
- Wagrier in Ostholstein, Hauptburg: Starigard/Oldenburg in Holstein
- Polaben zwischen Trave und Elbe, Lübeck
- Warnower an der oberen Warnow und Mildenitz
- Linonen an der Elbe um Lenzen (Lunzini)
- Wilzen' (seit dem Ende des 10. Jahrhundert auch Liutizen, Lutizen) mit vier Teilstämmen:
- Kessiner an der unteren Warnow
- Zirzipanen zwischen Recknitz, Trebel und Peene
- Tollenser östlich und südlich der Peene am Tollensesee
- Redarier südlich und östlich des Tollensesees und an der oberen Havel
- Retschanen im Raum Templin-Lychen und nördliche Oberhavel
- Rujane/Ranen auf Rügen
- Ukranen an der Uecker
- Mürizer an der Müritz
- Dosane an der Dosse
- Zamzizi im Ruppiner Gebiet
- Recanen an der oberen Havel
- Drevanen im Hannoverschen Wendland
- Bethenzer (auch Bethelici oder Belczem) im Raum Goldberg (Mecklenburg)/Plau[11]
- Smeldinger an der Elde
- Morizani (nördlich der Saalemündung an der Elbe) mit 11 civitates
- Brizanen bei Havelberg
- Heveller/Stodoranen im mittleren Havelgebiet und Havelland mit 8 civitates
- Sprewanen an der unteren Dahme und Spree
- Sorben im Elb-Saale-Gebiet mit mehreren Teilstämmen wie Colodici und Siusili beziehungsweise Kleinregionen (pagi) wie Chutici und Plisni (um Altenburg), Neletici (um Wurzen und um Torgau), Quesici/Quezizi (um Eilenburg), die aber erst im 10. Jahrhundert in den Quellen erscheinen. Das Gebiet der Sorben umfasste laut dem Bayrischen Geographen etwa 50 civitates.
In den mittelalterlichen Quellen werden deutlich von den Sorben geschieden die
- Daleminzier/Glomaci an der Elbe und in der Lommatzscher Pflege
- Nisanen um Dresden
- Milzener in der Oberlausitz rund um Bautzen
- Besunzanen um Görlitz
- Lusitzi in der Niederlausitz
Böhmen und Oberpfalz
In der Oberpfalz ist der Name „Windisch“ nicht nur als Familienname anzutreffen, sondern ist auch Bestandteil von Ortsnamen wie Windischeschenbach und Windischbergerdorf. Während der Völkerwanderung waren heimatsuchende „Windische“ bis nach Slowenien (Windischgrätz), Böhmen (Windisch Kamnitz) und in die Oberpfalz gekommen und hatten spärlich besiedeltes Gebiet angetroffen. Bei ihnen wird die Problematik der Mehrdeutigkeit der Bezeichnung „Wenden“ besonders deutlich, weil sie weder zu den Elbslawen im engeren Sinne noch zu den Nordwestslawen im weiteren Sinne zu rechnen sind.
Ortsnamen
Folgende Orte und Ortsteile[12] führen das Wort Wenden und Wendisch, aber auch Windisch im Namen und nehmen – wenigstens teilweise – damit auf einen wendischen Ursprung Bezug. Nicht in jedem Falle ist bei diesen Ortsnamen sicher davon auszugehen, dass die Orte wendische Siedlungen waren. Einige liegen dafür allerdings zu sehr im deutschen Kerngebiet westlich der Elbe; ihre Ortsnamen dürften sich daher vom prähistorischen Bachnamen wend ableiten.[13] Mit dem Zusatz wendisch kann auch eine Richtung beschrieben worden sein.
Literatur
- Sebastian Brather: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. In: Herbert Jankuhn, Heinrich Beck u. a. (Hrsg.): Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände. 2. Auflage. 30, Walter de Gruyter Inc., Berlin, New York NY 2001, ISBN 3-11-017061-2.
- Christian Lübke: Slaven zwischen Elbe/Saale und Oder. Wenden – Polaben – Elbslaven? Beobachtungen zur Namenwahl. In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Nr. 41, 1991, S. 17–43.
- Christian Lübke: Die Deutschen und das europäische Mittelalter. Das östliche Europa. 1. Auflage. 2, Siedler Verlag, München 2004, ISBN 3-88680-760-6.
- Madlena Norberg: Sammelband zur sorbischen/wendischen Kultur und Identität. Sind die sorbische/wendische Sprache und Identität noch zu retten?. In: Potsdamer Beiträge zur Sorabistik. Nr. 8, Universitäts-Verlag, Potsdam 2008, ISBN 978-3-940793-35-5 (PDF vom Opus- und Archivierungsdienst des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg, http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2147/pdf/pbs08_I_bericht01.pdf, abgerufen am 28. Februar 2010).
- Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. Theiss, Stuttgart 2000, ISBN 3-8062-1545-6.
- Felix Biermann, Thomas Kersting (Hrsg.): Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4. bis 7. April 2005. Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Langenweißbach 2007.
- Felix Biermann u. a. (Hrsg.): Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007. Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Langenweißbach 2009.
- Roland Steinacher: Wenden, Slawen, Vandalen. Eine frühmittelalterliche pseudologische Gleichsetzung und ihr Nachleben bis ins 18. Jahrhundert. In: W. Pohl (Hrsg.): Auf der Suche nach den Ursprüngen. Von der Bedeutung des frühen Mittelalters. Wien 2004, S. 329–353. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 8)
- Jerzy Okulicz: Einige Aspekte der Ethnogenese der Balten und Slawen im Lichte archäologischer und sprachwissenschaftlicher Forschungen. Quaestiones medii aevi, Bd. 3, 1986, S. 7–34.
- Julius Pokorny: Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Francke, Bern/ München 1959.
- Michał Parczewski: Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen. Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Wien 1993. (Veröffentlichungen der österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte; Bd. 17)
- Andrej Pleterski: Model etnogeneze Slovanov na osnovi nekaterih novejših raziskav / A model of an Ethnogenesis of Slavs based on Some Recent Research. In: Zgodovinski časopis. (= „Historische Zeitschrift“) 49, Nr. 4, 1995, ISSN 0350-5774, S. 537–556. (Englisch Zusammenfassung: (COBISS))
- Alexander M. Schenker: The Dawn of Slavic: an Introduction to Slavic Philology. Yale University Press, New Haven 1996, ISBN 0-300-05846-2.
Frühe Werke
- Albert Krantz: Wandalia. Des Fürtrefflichen Hochgelahrten Herrn Albert Crantzii Wandalia. Oder: Beschreibung Wendischer Geschicht: Darinnen der Wenden eigentlicher Vrspuung mancherley Völcker vnd vielfaltige Verwandlungen … Daraus was sol wol in … Königreichen … Wendischer vnd anderer Nationen in Dennemarcken/ Schweden/ Polen/ Vngarn/ Böhemen/ Oesterreich/ Mährern/ Schlesien/ Brandenburg/ Preussen/ Reussen/ Lieffland/ Pommern/ Mecklenburg/ Holstein. Junge, Lübeck 1636.
- Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Die Wenden in der Mark. III, 1873.
Einzelnachweise
- ↑ A. Brückner, Archiv für slavische Philologie, V. Jagic, Berlin 1901, S. 224–230.
- ↑ Andrej Pleterski (Inštitut za arheologijo, Ljubljana): Modell der Ethnogenese der Slawen auf der Grundlage einiger neuerer Forschungen
- ↑ Jan Misztal: Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim 1945-1950. Opole 1984
- ↑ Robert A. Beck: Schwebendes Volkstum im Gesinnungswandel: Eine sozial-psychologische Untersuchung. In: Schriftenreihe der Stadt der Auslandsdeutschen. Nr. 1, W. Kohlhammer, Stuttgart 1938 (books.google.com).
- ↑ Walter Kuhn: „Schwebendes Volkstum“ und künftige Landgestaltung in Südost-Oberschlesien. In: Neues Bauerntum. Nr. 33, 1941, S. 26–30 (books.google.com).
- ↑ Theodor Veiter: Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderheiten in Österreich. Mit einer ethnosoziologischen Grundlegung und einem Anhang (Materialien). Braumüller, Wien 1970, S. 83, 291, 292 (books.google.com).
- ↑ Verband schlesischer Bauern: Schlesien und die deutsche Minderheit
- ↑ Stanisław Senft, Oppeln: Nationale Verifikation und Repolonisierung in Schlesien 1945-1950. Aus dem Ausstellungskatalog: „Wach auf mein Herz und denke!“ - Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin-Brandenburg. Hrsg.: Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch - Berlin / Stowarzyszenie Instytut Śląskie - Opole. Berlin/Oppeln 1995, ISBN 3-87466-248-9, ISBN 83-85716-36-X.
- ↑ Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 2, Berlin/Weimar 1994, S. 41.
- ↑ Hardt, Matthias: Das „slawische Dorf“ und seine kolonisationszeitliche Umformung nach schriftlichen und historisch-geographischen Quellen. In: Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 17/1999, S. 269–291.
- ↑ Fred Ruchhöft, Vom slawischen Stammesgebiet zur deutschen Vogtei; die Entwicklung der Territorien in Ostholstein, Lauenburg, Mecklenburg und Vorpommern im Mittelalter. (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum, Band 4), Rahmen/Westf. 2008 ISBN 978-3-89646-464-4; ders., Die Entwicklung der Kulturlandschaft im Raum Plau-Goldberg im Mittelalter. (Rostocker Studien zur Regionalgeschichte 5), Rostock 2001
- ↑ J. Leupold: Orte mit „Wendisch“ im Namen. In: Wendisch Evern-Informationen. Abgerufen am 28. Februar 2010.
- ↑ Hans Bahlow: Deutschlands geographische Namenwelt : etymologisches Lexikon der Fluss- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunf. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985, ISBN 978-3-518-37721-5, S. 529.
|
|
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden. Der obige Ergänzungsartikel wurde am 06.06. 2013 aus dem Internet abgerufen.
|
|