 |
 |
|
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie dem zu. Weitere Infos zu Cookies und deren Deaktivierung finden Sie hier
|
 |
 |
|
Titelregister zu:
|
|
 |
|
Titelregister zu:
|
|
 |
 |
|
Eckdaten zu Jaromar II.
* vor 1220; † 1260 (erdolcht durch eine rächende Frau auf einem Feldzug auf Seeland)
Bestattungsort unbekannt (Vermutungen tendieren auf: Klöster auf Rügen oder in Neuenkamp)
Erwähnung in Dokumenten:
- 08.11. 1231 erste namentliche Erwähnung
- 28.09. 1246 Erwähnung als Mitregent seines Vaters
- April 1249 Erwähnung als Fürst
1248 Heirat mit Euphemia von Pommerellen
Regierender Fürst von Rügen 1249 bis 1260
|
 |
 |
|
Alexander von Soltwedel
Alexander von Soltwedel (* wohl vor 1240; † ca. 1291) war Ratsherr der Hansestadt Lübeck.
Soltwedels Lebensdaten sind unklar und nicht belegt. Er gehörte wohl einer aus Salzwedel stammenden Familie an und wurde Ratsherr in Lübeck. Es steht jedoch fest, dass er kurz vor 1256 gewählt worden sein muß und dass er um das Jahr 1291 verstorben ist. Fehling gibt als Amtszeit 1250-1291 an. Im Rat trat er nach der urkundlichen Überlieferung trotz seiner langen Amtsdauer nicht hervor. 1257 vertrat er die Stadt gegen Ansprüche der Markgrafen Johannes und Otto von Brandenburg, denen Lübeck von König Wilhelm zu Lehen gegeben worden war.
Seine Bedeutung heute erlangte er durch die Lübecker Chronisten. Hermann Korner, aber auch Heinrich Rehbein, machten ihn zum Urheber einer List, mittels welcher Lübeck sich am 1. Mai 1226 von der Herrschaft der Dänen befreite, und zum Anführer der Lübecker in der Schlacht bei Bornhöved (1227). Der Lübecker Staatsarchivar Carl Friedrich Wehrmann verwies dies in der ADB unter Berufung auf Wilhelm Brehmer in den Bereich der Sage:
„Die dänische Besatzung zog aus Lübeck ab, nachdem König Waldemar’s Truppen unter Führung des Grafen Albert von Orlamünde von den verbündeten Fürsten 1225 bei Mölln geschlagen waren, und von Alexander S. war damals überhaupt noch nicht die Rede. Auch die Nachricht Detmar’s, daß er 1249 eine lübeckische Flotte gegen Stralsund geführt habe, ist unglaubwürdig.“
So liegt denn seine Bedeutung für die Stadt in einer der von Ernst Deecke Mitte des 19. Jahrhunderts zusammengestellten Lübschen Sagen begründet.
Literatur
Wilhelm Brehmer: Der Rathsherr Alexander von Soltwedel in Sage und Geschichte. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte 4 (1876), S. 194 ff. (Digitalisat in den USA)
Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie, Lübeck 1925, Nr. 177.
Carl Friedrich Wehrmann: Soltwedel, Alexander von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 34. Duncker & Humblot, Leipzig 1892, S. 589.
Ergänzungsartikel auf wikipedia:
Soltwedel: Alexander v. S. gehörte einer aus Salzwedel stammenden und nach diesem Orte benannten Familie an und war Mitglied des Lübeckischen Raths. Obwohl weder das Jahr seiner Erwählung noch das seines Todes sich mit Sicherheit bestimmen läßt, so steht doch fest, daß er nur kurz vor 1256 gewählt sein kann und um daß Jahr 1291 gestorben ist. Ungeachtet seiner demnach langjährigen Amtsführung gehörte er nicht zu den angesehenen und einflußreichen Mitgliedern des Raths. Er war nicht Bürgermeister, auch nicht Kämmereiherr. Nur in den letzten Jahren wird sein Name mehrfach erwähnt und nur einmal, 1257, erscheint er als selbständiger Vertreter des Raths, indem er Namens desselben gegen die Ansprüche der Markgrafen Johannes und Otto von Brandenburg, denen die Stadt vom deutschen König Wilhelm zu Lehen gegeben war, Protest erhob. Spätere Chronikenschreiber, zuerst Korner, dann hauptsächlich Rehbein, haben ihn zum Urheber einer List gemacht, durch welche Lübeck sich am 1. Mai 1226 von der Herrschaft der Dänen befreite, und zum Anführer der Lübecker in der Schlacht bei Bornhövd 1227. Aber die neuere Geschichtsforschung hat diese Angaben in das Gebiet der Sage verwiesen. Die dänische Besatzung zog aus Lübeck ab, nachdem König Waldemar’s Truppen unter Führung des Grafen Albert von Orlamünde von den Verbündeten Fürsten 1225 bei Mölln geschlagen waren, und von Alexander S. war damals überhaupt noch nicht die Rede. Auch die Nachricht Detmar’s, daß er 1249 eine lübeckische Flotte gegen Stralsund geführt habe, ist unglaubwürdig.
Brehmer, Der Rathsherr Alexander von Soltwedel in Sage und Geschichte, in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte IV, 194 fg.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
25. Alexander von Soltwedel.
Im Jahre 1226, als die Lübecker inne wurden, daß die Lande gern der Dänen los sein wollten, suchten sie weisen Rath, wie sie wieder zum Kaiser, ihrem rechten Herrn, und zum deutschen Reiche kämen. Aber der König von Dänemark war auf seiner Hut: er überfiel mit einem großen Heer die Veste Rendsburg, und zog an die Ditmarsen; jedoch er verlor seiner Leute viel, so daß er mit nicht gar starker Zahl nach Lübeck kam, um nach altem Gebrauch Ostern zu feiern. Die Freude jedoch war nicht groß, denn ein Land nach dem andern sagte ihm ab; nur die Stadt, die er erst vor wenigen Jahren mit steinernen Mauern und Thürmen gestärkt, hielt er fest. Da nun der Himmel hoch und der Kaiser weit war, den andern Fürsten aber nicht zu trauen stand, so mußten die Bürger von Lübeck auf gute Gelegenheit denken, sich selbst durch kluge Anschläge zu befrein.
Nun stand in der Mühlenstraße ein Haus, eine zeitlang die alte Sonne geheißen, in welchem ein kluger und tapferer Mann, Alexander Soltwedel, – in seiner Jugend ein Kleinschmieds-Gesell – wohnte, dessen Bruder Johannes im Rathsstuhl saß. Wenn dieser nun über Muthwill und Gewalt der Dänen klagte, sagte jener oft: „säße ich im Rath, ich wollte wohl, wenn sonst keiner, die beschwerliche [41] Last abwerfen.“ Dies sagte er so oft, bis Ein Rath ihn beschickte und um seine Absicht fragen ließ. Da bekräftigte er seine Rede und bedang sich zugleich, da sein Plan nur durch List ins Werk gesetzt werden könne, daß man deßhalb kein Aergerniß an ihm nehmen möge. Man vertraute ihm und bewog seinen Bruder, ihm den Rathsstuhl zu räumen. Da sah man nun gar bald und verwunderte sich deß, wie der schlichte Mann sich schleunig veränderte. Er befliß sich nicht allein der königlichen Räthe, sondern auch des Königs Gnade und Freundschaft zu gewinnen, und war bei ihnen oftmals fröhlich und guter Dinge; wie sie bei ihm. An ihren Hochzeiten, Gelagen, Jagden und Stechspielen, selbst bei ihrer Kurzweil wußte er sich so wohl zu erzeigen, daß er bei jedermänniglich einen guten Namen gewann. Nur den Bürgern gefiel sein Gebühren nicht: er suche, raunten sie sich ins Ohr, nur seinen Nutzen und Ruhm darin; sichtlich verschwende er der Stadt Güter; er habe, trugen andere zu, Bestallung vom König, die Stadt in weitere Dienstbarkeit zu bringen. Als man ihm bedenklich nachsah, rief er die Vornehmsten und die Gemeine zu sich und entdeckte ihnen was er wolle. Deß waren sie wohl zufrieden und warteten ihrer Zeit. Nun kam der Tag, da nach altem Brauch der Maigraf mit Jubel und Lust den Mai aus dem Walde holte. Des Abends zog man auf das Burgfeld, wo der Papagoyenbaum stand; da waren die kostbarsten [42] Zelte und Paulune gemacht, es wurde bei Fackellicht bankettirt und getrunken, gespielt und getanzt, und seltsame Mummen von wilden Männern und Frauen gingen dazwischen hin und her. Nach Mitternacht riefen vom Schwerin (Lauerholz) her die Hörner, daß man die Maien und den Maibaum hole, um vor Sonnenschein die Häuser und Kirchen zu zieren. Da sind der ganze Rath und die Vornehmsten der Bürger neben dem König und seinen Räthen in den Wald hinabgeritten; auch des Raths und der Stadt Diener, ihnen zu sonderlichen Ehren aufs köstlichste gekleidet und geputzt. Etliche aber und andere junge Gesellen gingen im Mummenschanz mit Jungfernkleidern angethan und scheinbar gemacht auf die Burg, wo man sie gar lustig empfing; doch als sie an das Schloß kamen, zogen sie ihre fertigen Wehren hervor und warfen die Wächter nieder. Da nun der König wieder aus dem Walde kömmt mit Blumen und Kränzen gar schön geziert, und die Freude am besten ist: da sieht man aus der Burg der Stadt Lübeck Fähnlein fliegen. Deß sind die Dänen heftig erschrocken und auf ihre Pferde gefallen und in Hast von dannen gen Travemünde geritten. Der König aber hat zum Herrn Alexander gesagt, daß er bald wieder kommen wollte. Darauf ihm dieser geantwortet: daß er wohl kommen möchte wann er wollte; es solle ihm begegnet werden.
Danach sandten die Lübischen zum Kaiser und boten [43] ihm ihre Stadt an und sagten ihm: wie sein Großvater vor Zeiten sie mit Heerschilden belagert und unter das Reich gebracht, ihr auch viele und große Freiheiten gegeben hätte. Da nun Kaiser Friedrich ihre Treue sah, und daß sie ihm aus gutem und freiem Willen ihre Stadt so anboten, nahm er sie gütlich an und samt ihren Einwohnern unter seinen und des Reiches Schutz, darunter sie vor Zeiten gewesen waren; und sprach sie frei von allen Gelöbnissen und Verträgen, die sie mit dem Könige gemacht hätten; und bestätigte ihre Freiheiten mit seinem kaiserlichen Ingesiegel, und gab ihnen mildigllch viele neue dazu. Da aber der König von Dänemarken dies alles mit sonderlichen Schmerzen betrachtete, ward er gar zurnig und forderte die Lübischen aus, einen Streit mit ihm zu halten, und bestimmte daneben die Zeit auf S. Marien-Magdalenen-Tag, auf welchen Tag er es also begehrte. Er sammelte ein mächtig großes Volk zu hauf aus seinen Reichen; dazu kam er auch mit seinen Schiffen. Und zog an die Ditmarsen, dieselben zwang er mit solchem Befehl, daß sie sich rüsten und gefaßt machen sollten, mit ihm zu streiten wider die Lübschen. Diese guten Leute gelobten es dem Könige zwar wohl zu thun, aber doch wider ihren Willen, in Betrachtung, daß sie dänischen Regiments ohn das überdrüssig genug. Und da der König mit Heeresmacht also heranzog, säumte Herzog Otto zu Sachsen, der zugleich zu Braunschweig und Lüneburg ein Herzog [44] und Hinrici Leonis Sohn war, auch nicht; sondern kam seinem Vetter mit einem wohlgerüsteten Kriegsvolk zu Hülfe, und zogen beide zu Felde bei Bornhövde, welches dazumal das Swentiner Feld genannt ward. Inzwischen sind die von Lübeck auch aufgewesen, wappneten sich und riefen zu Hülfe Gerhard den Erzbischof zu Bremen, Albert Herzogen zu Sachsen, Adolf Grafen zu Holstein, Hinrich Grafen zu Schwerin, der unlängst von dem Könige verjaget worden, und Burewin Herrn zu Wenden und Meklenburg. Diese Fürsten und Herren samt denen von Lübeck in einer stattlichen Versammlung, wie sie vernahmen, daß der König mit den Seinen auf der Heide läge, kamen sie ihm daselbst entgegen. Kriegshauptmann ist gewesen Herr Alexander von Soltwedel, Bürgermeister von Lübeck, neben Adolf dem Grafen zu Holstein, der von der Stadt Lübeck dazu erbeten worden; insonderheit kam ihnen auch zu Hülfe der edle Graf Hinrich zu Schwerin. Wie nun die Ditmarsen die herrliche und schöne Versammlung der Lübischen mit so vielen staffierten und zierlichen Bannieren daher ziehen sahn, da wurden sie eingedenk und kam ihnen auf die Stunde zu Gemüth, daß die Lübischen niemals im geringsten wider sie gehandelt, und daß sie ihnen in künftigen Zeiten oftmals dienen und der Noth wohl könnten zu Steuer und Hülfe kommen; und fielen deswegen vom Könige ab und mischten sich unter die Lübischen, welches denn dem dänischen Haufen [45] kein geringer Schade war. Und sie huben an mit einander zu streiten auf S. Marien-Magdalenen-Tag, also daß der König mit seinem Volke in die Flucht geschlagen ward, und ein Auge samt der Schlacht verlor, und gar genau und kümmerlich genug mit seinem Sohn und etlichen wenigen davon kam. Herzog Otto, der zwar gar nicht übel, sondern ganz ritterlich gestritten, ward gefangen. Dieß alles ist geschehen mit sonderlicher Hülfe Gottes und der heiligen Frauen S. Marien-Magdalenen, weil der König wohl zehen Mann gegen einen brachte. Darum ist der Oberste, Herr Alexander, ehe er mit seinem Kriegsvolk an die Schlacht getreten, mit den Seinigen auf die Knie gefallen und hat dies Gelübde gethan: Da Gott der Allmächtige durch das Verdienst der heiligen Frauen S. Marien-Magdalenen auf diesen Tag in solcher großen und äußersten Noth seine Hülfe gäbe und seine Gnade verleihen möchte, daß sie siegen und das Feld behalten würden: so wollten sie an Stelle der Burg ein Kloster der Predigermönche zu seiner, seiner allerseligsten Mutter Marien, und der heiligen Frauen Marien-Magdalenen Ehre errichten. Als es nun von beiden Seiten zum Fechten und Schlagen kam, begunnte die Sonne den Lübeckern recht entgegen zu scheinen, daß ihnen der Glanz in die Augen stach, davor sie die Feinde nicht sehen konnten. O Wunder! da ward die heilige Frau Maria-Magdalena sichtlich gesehen, daß sie ihren Mantel vor [46] der Sonne ausstreckte und die scheinenden Strahlen den Dänen zubog, also daß die Lübischen wie in einem Schatten stunden. Da nun alles vollendet, zogen sie mit ihrem Haufen und vielen vornehmen Gefangenen nach der Stadt, lobeten, preiseten und danketen Gott dem Allmächtigen und der heiligen Frauen S. Marien-Magdalenen, die solche schöne und herrliche Victorie verliehen, und theilten die Beute unter das Kriegsvolk aus. Den gefangenen Herzog Otto hat man gegeben an Albert den Herzog zu Sachsen mit ihm zu thun was er wollte; den andern Fürsten aber theilte man andere vornehme Herren zu, jedem nach seiner Würde und was er Gutes verdient hätte. Dann sind sie mit gesamter Hand nach dem Schloß gelaufen, haben dasselbe erstlich geplündert, danach heruntergerissen und abgebrochen bis auf den Grund und alles der Erden gleich gemacht; und alsbald auf die wüste Stätte ein herrliches Kloster Prediger-Ordens zu bauen angefangen, wie sie gelobt. Und haben danach gen Bremen und Magdeburg geschickt, von dorther neue Brüder Prediger-Ordens zu holen; die haben sie eingesetzt Gott zu dienen ewiglich. Zu ewigem Gedächtniß aber solches Sieges gaben sie alle Jahr an diesem Tage den Armen Almosen in der Kirche zu S. Marien, und die Brüder auch in ihrem Reventer ein Faß Biers.
[47] Des dänischen Königs Reiterfahne hängt noch heutigen Tages zum Siegeszeichen und uralten Gedächtniß in der Marienkirche, nah am Chor unter dem Gewölbe zwischen zwei Pfeilern. gestorben.
Herrn Alexander hätte es nach dem Siege wohl frei gestanden, für seine großen Dienste eine ehrliche Gabe von der Stadt zu begehren. Aber er suchte mehr die Wohlfahrt seiner Lands- und Hausleute, denn sein eignes Beste, und erbat sich nur schlechthin, daß die Märker hie zu Lübeck zollfrei sein möchten; welches ihnen auch gern bewilligt bis auf den heutigen Tag.
Herr Alexander liegt zu S. Marien im Chor an der Norderseite begraben an dem Orte, wo die große Messingtafel steht. Sein Name ist auf dem Stein zu lesen neben seinem Wappen, welches 3 Kronen und einen halben schwarzen Adler führt, da er vom Kaiser zum Ritter gemacht ist. Er ist 1291 gestorben.
Bemerkungen
[389] Zum Theil noch mündlich. Das Geschichtliche s. in m. Geschichte der Stadt Lübeck, I. S. 223 ff. S. 40 Z. 10 l. freilich s. jedoch. S. 46 Reventer – Refectorium.
Anmerkungen von Wikisource
Bei Alexander von Soltwedel vermischt die Lübsche Sage die historische Person des Ratsherrn Alexander von Soltwedel, der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrunderts nachgewiesen ist, mit der Schlacht bei Bornhöved (1227).
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren, bzw. Versionsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.
|
 |
 |
|
Rostocker Landfrieden
Der Rostocker Landfrieden war ein am 13. Juni 1283 in Rostock geschlossener Vertrag zur Land- und Seebefriedung sowie zum Schutz der Zoll- und anderer Freiheiten. Auf zehn Jahre verpflichteten sich die Vertragspartner zum Verzicht auf Gewalt zur Durchsetzung eigener Rechtsansprüche. Dieser Vertrag war Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg von Wismar und anderen Hafenstädten an der Ostsee.
Beteiligte Parteien waren die Hansestädte Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin und Anklam sowie die Herzöge von Sachsen und Pommern, die Fürsten von Rügen, die Herren von Schwerin und Dannenberg sowie die Ritterschaft von Rostock.
Literatur
Wolf-Dieter Mohrmann: Der Landfriede im Ostseeraum während des späten Mittelalters, 1972, ISBN 3784740022
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Stalhof
Der Stalhof bezeichnete seit 1475 ein umfriedetes Gelände am Nordufer der Themse, auf dem die Hansekaufleute in London ihre Niederlassungen hatten. 1853 wurde das Gelände von den Hansestädten Lübeck, Bremen und Hamburg verkauft. Der Stiliard (Steelyard) wurde von der Cousin Lane im Westen, der Thames Street im Norden und der Allhallows Lane im Osten umgrenzt. Auf dem Grundstück wurde 1866 der Bahnhof Cannon Street eröffnet.
Guildhall
Seit dem frühen 11. Jahrhundert sind rheinische Kaufleute in London nachzuweisen, die hauptsächlich mit Wein handelten. 1175 erlangten einige Kölner Kaufleute durch Heinrich II Handelsprivilegien bzw. Schutzbriefe und begründeten eine gemeinsame Niederlassung an der Themse. Dieses Gebäude, die Guildhall, übersetzt Gilde- bzw. Zunfthaus, diente den zusammengeschlossenen Kaufleuten als Versammlungsort, Lager und gelegentlich auch für Wohnzwecke.

↑ Hermann Wedigh, 29 Jahre, später Kölner Ratsherr, Kaufmann im Stalhof 1532
Um 1238 und 1260 wurden von Heinrich III. die Privilegien der Kaufleute bestätigt, sie galten nunmehr für alle deutschen Hansekaufleute in London. Die Haupthandelsgüter der deutschen Kaufleute wandelten sich, anstelle des Wein traten vor allem Getreide und Tuche, die nach England importiert wurden.
Stalhof
Aufgrund von Handelsfragen kam es 1470 zu einem Krieg zwischen England und der Hanse, der mit dem Frieden von Utrecht (1474) beendet wurde. Nach diesem Friedensschluss wurde den Kaufleuten das an die Guildhall angrenzende Gelände vom englischen König übertragen. Dieses Gelände wurde mit einer starken Mauer umgeben und Steelyard bzw. Stalhof genannt. Auf dem Gelände befand sich ein eigener Kran, eigene Wirtschafts- und Wohngebäude, sowie ein Garten. Seit dem Widerruf der Handelsprivilegien 1552 durch König Edvard VI. hatte sich der Kölner Heinrich Sudermann, ab 1556 bis 1591 Syndikus der Hanse, auch bei den Nachfolgerinnen Edwards um Stabilisierung und Rettung des Stalhofs für die Hanse diplomatisch bemüht. Als Ende des 16. Jahrhunderts die Auseinandersetzungen um die Tuchexporte zunahmen und England mit dem deutschen Kaiser im Krieg lag, verfügte Königin Elisabeth am 13. Januar 1598 mit Wirkung zum 24. Januar die Ausweisung der hansischen Kaufleute aus England, deren Handelsprivilegien sie aufhob, sowie die Schließung und Beschlagnahmung des Stalhofs[1]. Anlass war die am selben Tag wirksam werdende Ausweisung der englischen Merchant Adventurers aus Stade. 1606 wurde der Stalhof den früheren hansischen Eigentümern zurückgegeben, die Privilegien dagegen nicht erneuert. In den folgenden Jahren hatte er wirtschaftlich kaum noch eine Bedeutung. Während des großen Brandes von London im Jahre 1666 wurden die meisten Gebäude zerstört und nur auf Kosten der Städte Bremen, Hamburg und Lübeck wieder aufgebaut. Diese nutzten das Gebäude teilweise für eigene Zwecke und ließen den Stalhof vom Stalhofmeister verwalten. Zeitweilig hatten diese drei Städte in London auch einen eigenen gemeinsamen diplomatischen Geschäftsträger, zumeist als Generalkonsul und Ministerresidenten wie den Schotten Patrick Colquhoun († 1820). Letzter Stalhofmeister in London war der hanseatische Ministerresident James Colquhoun († 1855). Zwei Jahre vor dessen Tod verkauften die Rechtsnachfolger der Hanse Lübeck, Bremen und Hamburg das Gelände im Jahre 1853 endgültig.

↑ Georg Giese, 34 Jahre aus Danzig, Kaufmann im Stalhof 1532
An der Spitze des Stalhofs stand der von den Kaufleuten am Neujahrstag gewählte Ältermann, sowie zwei Beisitzer. Der Ältermann repräsentierte den Stalhof nach außen, sorgte für die Durchsetzung der Regelungen im Inneren und war Gerichtsherr. Die Kontorstatuten des Stalhofs forderten, dass je einer dieser gewählten Männer eine der folgenden Regionen, genannt Drittel, repräsentieren sollte. Das erste Drittel bezeichnet Köln und weitere linksrheinische Städte. Das zweite Drittel umfasste die rechtsrheinischen, westfälischen, sächsischen und wendischen Städte. Aus Gotland, Livland oder den preußischen Städten Danzig und Elbing mussten Kaufleute stammen, die das letzte Drittel repräsentieren sollten. Da die Kölner Kaufleute immer in der Mehrheit im Stalhof waren, stellten sie meist den Ältermann. Der Stalhof finanzierte sich hauptsächlich aus einer „Schoß“ genannten Abgabe, die alle Hansekaufleute entrichten mussten, die England bereisten.
Der Stalhof war den anderen hansischen Niederlassungen in England wie denen in Boston oder King’s Lynn übergeordnet. Die in Lynn noch erhaltenen Speichergebäude der hansischen Faktorei geben eine Vorstellung, wie der Stalhof in etwa ausgesehen haben könnte. Ein Eindruck über Selbstdarstellung der hansischen Kaufleute im Stalhof vermitteln die von Hans Holbein dem Jüngeren gemalten Portraits. Neben den sieben namentlich zuordenbaren Portraits hansischer Kaufleute von Hans Holbein gibt es detaillierte Beschreibungen des Stalhofs durch den Londoner Stadtbiographen John Stow.
Namenstheorien
Über die Entstehung des Namens herrscht keine Einigkeit. Nach einer These leitet er sich ab von mittelhochdeutsch und althochdeutsch stal, niederländisch stal, englisch stall, schwedisch stall, was ursprünglich Stelle, Stand, Standort bedeutete. Die neuere Forschung vermutet, dass das niederdeutsche Verb stalen, was soviel heißt wie auszeichnen bzw. verplomben, dahinter steht. So sind bei archäologischen Grabungen viele Blei- bzw. Wachsplomben gefunden worden, die der Verzollung von Tuch bzw. als Herkunftssiegel gedient haben könnten. Seit dem 14. Jahrhundert sind auch viele tuchverarbeitende Berufe in der Nähe des Stalhofs nachzuweisen.
Literatur
- Wolfgang Rosen/Lars Wirtler (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln Bd. I. Köln 1999, S.148: Schutz für die Kölner Kaufleute in England: Die erste Erwähnung der Gildehalle ("Stalhof") in London 1176
- Die Hanse Lebenswirklichkeit und Mythos. Ausstellungskatalog Band 1. Hamburg 1989
- Nils Jörn: “With money and bloode”. Der Londoner Stalhof im Spannungsfeld der englisch-hansischen Beziehungen im 15. und 16. Jahrhundert. (= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte; N.F., Band 50). Köln, Weimar, Wien 2000. ISBN 3-412-08800-5
- Theodor Gustav Werner: Der Stalhof der deutschen Hanse in London in wirtschafts- und kunsthistorischen Bildwerken. In: Scripta Mercaturae 1/1973, ISSN 0036-973X
- Theodor Gustav Werner: Der Stalhof der deutschen Hanse in London in wirtschafts- und kunsthistorischen Bildwerken. Eine Fortsetzung. In: Scripta Mercaturae Heft 1/2 1974, Seite 137–204
- Theodor Gustav Werner: Anhang zur Geschichte des Handels und Verkehrs auf dem Stalhof von der zweiten Hälfte des 16. Jhs. bis zum 18. Jahrhundert. In: Scripta Mercaturae 1/1975, Seite 91–105
Einzelnachweise
↑ Verfügung vom 13. Januar 1598 im Wortlaut (englisch)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Knecht
Ein Knecht (westgermanisch noch für Jungkerl, Kämpe, später Knappe) ist ein Arbeiter in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Es handelt sich in Deutschland um einen aussterbenden Beruf. Früher gab es im Haushalt den Hausknecht, in Gewerben den Holzknecht, und den Mühlenknecht (Mühlknappen), sowie partiell in weiteren Handwerken. Im Militär kannte man den Edelknecht, Waffenknecht und Landsknecht. Im Mittelalter gab es den Henkersknecht, der die Todesstrafe vollstreckte.
Die weibliche Entsprechung des Knechts ist die Magd.
Bedeutungswandel
Der Ausdruck Knecht sank seit der Völkerwanderungszeit in der allgemeinen Achtung, Knecht konnte damit zum beleidigenden Schimpfwort werden. Als knechtisch wurde - absprechend - oft eine unterwürfige, auch zugleich rohe und feige Haltung bezeichnet.
Militärgeschichtlich steht der Begriff Knecht als (neutraler) Gegensatz zum Ritter (so gibt es z.B. den spezifischen knechtischen Harnisch). Der Begriff hielt sich bis ins 16. Jahrhundert in der Bedeutung Knecht = Soldat zu Fuß (Fußknecht oder Waffenknecht) im Gegensatz zum Reisigen = Soldat zu Pferde. Einen Bedeutungswandel erfuhr zu Beginn der Neuzeit das Wort Knecht, mit der Einführung der „Landsknechte“, die Söldner (Soldknechte) waren.
Sozialwissenschaftlich
Das gegenseitige soziale Aufeinander-angewiesen-Sein von Herrn und Knecht wird bereits in der Aufklärung kritisch analysiert (siehe Knechtschaft), findet sich als zentrales Motiv in Hegels Philosophie, siehe Herrschaft und Knechtschaft, und wird über diese weitervermittelt an den Marxismus, dort schließlich zum Klassenkampf zugespitzt („Lohnknechtschaft“).
Soziologisches Material findet sich zumal in der Agrarsoziologie.
Biblisch
Die Bibel (Luther-Übersetzung) benutzt den Begriff in verschiedener Bedeutung. Zum einen steht er als Synonym für den Unfreien (Sklaven), aber auch den ergebenen Diener. Die zugrundeliegende hebräische Wurzel עבד bedeutet "dienen" aber auch einfach "arbeiten". Das alte Testament enthält spezielle Regelungen über die humane Behandlung von Sklaven, z.B. im Bundesbuch (Ex 21ff), die Rücksicht darauf nehmen, dass Israel nach seinem Selbstverständnis ein Volk befreiter Sklaven ist (vgl. auch die Ausführung zum 3. Gebot in Dtn 5,15). Hiob wird als treuer Knecht Gottes genannt, was ihn als besonders fromm und rechtschaffen beschreiben soll. Jesaja prophezeit einen „leidenden Gottesknecht“, der in der christlichen Rezeption herkömmlich mit Jesus identifiziert wurde (vgl. Lk 24,26). Im Neuen Testament werden die römischen Legionäre als Kriegsknechte bezeichnet. Im theologischen Gebrauch findet die griechische Übersetzung von hebr. עבד, δούλος reiche Verwendung, vor allem als Bezeichnung der Gläubigen, etwa als Selbstbezeichnung des Apostels Paulus in seinen Briefen.
Der Knecht in Mythologie und Literatur
- Knecht Ruprecht
- Uli der Knecht (Jeremias Gotthelf)
- Herr Puntila und sein Knecht Matti (Bertolt Brecht)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Landsknecht
Als Landsknecht bezeichnet man den zu Fuß kämpfenden, zumeist deutschen Söldner des späten 15. und des 16. Jahrhunderts, dessen primäre Waffe nach Schweizer Vorbild die Pike war. Obwohl Landsknechte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ursprünglich als kaiserlich-habsburgische Söldner angeworben wurden, kämpften sie unter den verschiedensten europäischen Fürsten. Sie galten aufgrund ihrer fortschrittlichen und disziplinierten Kampfweise als besonders schlagkräftig, hatten aber immer auch den Ruf von Plünderern, die nach ausgebliebenen Soldzahlungen ganze Landstriche verheeren konnten. Als Initiator der Landsknechtheere gilt Kaiser Maximilian I., der auch als „Vater der Landsknechte“ bekannt ist.
Etymologie
Die Bezeichnung Landsknecht ist urkundlich erstmals in den eidgenössischen Abschieden des Jahres 1486 belegt[1], ihre Bedeutung wird als bewusste Abgrenzung zu den aus dem Gebirge – und nicht vom flachen Land – stammenden Schweizer Pikenieren vermutet. Als „Lantknecht“ bezeichnete man schon im 15. Jahrhundert einen Gendarm oder Gerichtsboten, der auch kriegerische Tätigkeiten übernahm. Bereits um 1500 setzte sich die irreführende Bezeichnung Lanzknecht durch, welche auf die eigentlich als Langspieße einzustufenden Piken der Söldner anspielte. „Knecht“ weist wahrscheinlich auf die Verpflichtung des Söldners gegenüber Reich und Kaiser hin. Das aus dem deutschen Heer im Ersten und Zweiten Weltkrieg stammende Wort „Landser“ leitet sich direkt von Landsknecht ab. Im heutigen Sprachgebrauch wird Landsknecht gelegentlich als Synonym für „Söldner“ verwendet.
Ursprung der Söldnerheere
Das Militärwesen des Spätmittelalters basierte auf zwei Säulen:
- Dem eisengepanzerten Ritter, der als Vasall seines Lehnsherrn getreu seinem Lehenseid in den Kampf zog, begleitet von reisigen Kriegsknechten des eigenen Gefolges.
- Anderseits das Volksaufgebot zur allgemeinen Landesverteidigung durch die wehrpflichtigen Männer, das insbesondere die Bürger der Städte zur Verteidigung ihrer Mauern verpflichtete.
Neben diesen feudalistisch geprägten Kriegern warben Landesherren und insbesondere die erstarkenden Städte in zunehmenden Maß auch besoldete Fußsoldaten für einzelne Feldzüge an und stellten damit das Kriegsmonopol des Ritterstandes in Frage. So traten im 12. Jahrhundert die Brabanzonen im heutigen Belgien auf, die für Sold und Beute kämpften, im Hundertjährigen Krieg gefolgt von den Armagnaken aus Frankreich und den Söldnerhaufen unter Führung der italienischen Condottieri, die als Unternehmer die Kriegsgeschäfte der norditalienischen Stadtstaaten erledigten. Diese Söldnerhaufen boten kein einheitliches Bild: Neben militärisch ausgebildeten Berufskriegern wie Sarazenen und Genueser Armbrustschützen strömten Bauernkrieger und Vagabunden zu den Werbern.
Inzwischen war auch militärisch durch mehrere Schlachten deutlich geworden, dass eine mit Stangenwaffen ausgestattete, diszipliniert kämpfende Infanterie einer aus Rittern bestehenden, eigenständig agierenden, schweren Reiterei durchaus standhalten konnte. Beispiele dafür sind die Hussiten, die sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, gestützt auf Wagenburg und Feuerwaffen, in mehreren Schlachten als militärisch unbezwingbar erwiesen hatten und die schweizer Eidgenossen, die 1315 in der Schlacht am Morgarten und 1386 in der Schlacht bei Sempach die habsburgischen Österreicher vernichtend schlugen und 1477 in der Schlacht von Nancy den entscheidenden Sieg über Karl den Kühnen von Burgund erstritten.
Hussiten, die mit ihren Feldgeschützen aus befestigten Wagenburgen heraus kämpften, und Schweizer, die in mehreren Tausend Mann starken Gewalthaufen aus Hellebardieren und Pikenieren fochten, inspirierten das Reisläufertum des ausgehenden 15. Jahrhunderts und wurden zum damit Vorläufer des Landsknechtswesens.[2]
Entstehung der Landsknechte
Nach dem Tode Karls bei Nancy fielen die burgundischen Territorien erbrechtlich an den Habsburger Maximilian, den Sohn des damaligen Kaisers Friedrich III., der seine Ansprüche jedoch militärisch gegen König Ludwig XI. von Frankreich durchsetzen musste. Er griff dazu auf flämische Aufgebote zurück, in deren Reihen sogar Adlige wie Graf Engelbert von Nassau und der Graf von Remont aus dem Haus Savoyen eintraten. In der Schlacht bei Guinegate konnte Maximilian zwar den Großteil seiner neu gewonnenen Gebiete behaupten, darunter die Niederlande, Luxemburg und die Freigrafschaft Burgund; um weiteren französischen Angriffen begegnen zu können und um Druck auf die mächtigen Territorialstaaten Bayern und Böhmen auszuüben, benötigte jedoch der Habsburger weiterhin ein eigenes schlagkräftiges Heer, ohne auf Vasallen noch auf Aufgebote zurückgreifen zu können, zumal Kaiser und Reich durch den Krieg mit den Türken in Ungarn gebunden waren. Maximilian war dadurch gezwungen, eigenständig die Anwerbung von Kriegsknechten anzustrengen. 1487, nur wenige Monate nach seiner Krönung zum deutschen König, hatte Maximilian Söldner angeworben (erstmals taucht nun der Begriff des Landsknechts auf), wobei er
„das Fussvolk nach Art der römischen Legionen in Haufen, Regimenter, teilte, dieselben mit langen Stangsspiessen oder Piquen versehen lassen und sie in diesem Gewehr dermassen abgerichtet, dass sie es allen anderen Nationen zuvorthaten, dannenhero von dieser Zeit an kein Krieg in Europa ohne die Teutschen Lanzknechte geführet worden und kein kriegsführender Potentat derselben entbehren wollen“ – Reallexikon der deutschen Altertümer, 1885
Diese frummen Knechte wurden in Brügge unter dem Kommando von Graf Eitelfritz von Hohenzollern[3] sowie schweizerischer Hauptleute[4] ausgebildet und leisteten ab 1490 den Gefolgschaftseid auf Maximilian, der diese als Kriegsorden nach dem Vorbild der bestehenden Ritterorden begründen wollte.
Blütezeit der Landsknechte
Als Ende des 15. Jahrhunderts der Konflikt zwischen dem Schwäbischen Bund und der Schweizerischen Eidgenossenschaft eskalierte, erfolgte erneut der Einsatz von Landsknechten im bewaffneten Konflikt. In dem so genannten Schwabenkrieg kämpften Maximilians Truppen auf Seiten des Schwäbischen Bundes, der 1488 als Gegengewicht zu den Expansionsbestrebungen der bayerischen Wittelsbacher gegründet worden war. Die kaiserlichen und schwäbischen Aufgebote mussten im Kampf gegen die Schweizer schwere Niederlagen hinnehmen, die mit dem Frieden von Basel 1499 ihre faktische Unabhängigkeit vom Reich erlangten. Der Schwabenkrieg begründete trotz ihrer nahen Verwandtschaft den irrationalen Hass zwischen deutschen Landsknechten und schweizerischen Reisläufern.
Am Schwabenkrieg hatte auf schwäbischer Seite auch Georg von Frundsberg teilgenommen, der noch im selben Jahr in kaiserlichen Diensten gegen die in das Herzogtum Mailand eingefallenen Franzosen kämpfte. Frundsberg half Maximilian bei der Aufstellung und Ausbildung der Landsknechtheere, wobei er die im Schwabenkrieg gesammelten Erfahrungen mit den Schweizer Söldnerhaufen auswertete und deren Taktiken weiterentwickelte. Frundsberg sollte zum bedeutendsten Landsknechtführer werden, dessen Truppen in den Italienischen Kriegen mehrere wichtige Siege gegen Franzosen und auch Schweizer erkämpfen konnten. Sein Tod im Jahre 1528 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Landsknechte.
Landsknechte kämpften unter anderem in den Italienischen Kriegen, im Landshuter Erbfolgekrieg, im Bauernkrieg und im Schmalkaldischen Krieg. Ihre militärischen Erfolge führten dazu, dass nicht nur der Kaiser und die Reichsfürsten, sondern auch ausländische Herrscher Landsknechte anwarben, insbesondere die französischen Könige. Das Leben der Landsknechte war von hohem Selbstwertgefühl geprägt; sie sahen sich selbst als eine Art weltlicher Kriegerorden und setzten ihre Forderungen selbstbewusst auch gegenüber ihrem Dienstherren durch, der auf ihren Gehorsam in der Schlacht angewiesen war.
Die fanatische Feindschaft zwischen reichsdeutschen Landsknechten und eidgenössischen Reisläufern entartete während der Italienkriege bis zum sogenannten „schlechten Krieg“, in dem im Gegensatz zum „guten Krieg“ keine Gefangenen gemacht und der unterlegene oder verwundete Gegner gnadenlos niedergemacht wurde. Mit der gleichen Erbarmungslosigkeit begegneten die Landsknechte ihren Landsleuten der „Schwarzen Legion“, die im Sold des französischen Königs auf gegnerischer Seite gegen das Reich kämpften und damit gegen Kaiser Maximilians Befehl verstießen, der alle deutschen Landsknechte aus Frankreich zurückbeordert hatte.
Niedergang der Landsknechte
Maximilian I. und sein Nachfolger Karl V. hatten stets mit finanziellen Problemen zu kämpfen, unzuverlässige Besoldung und daraus folgende mangelhafte Disziplin der Landsknechtsheere waren die Folge. Mangelte es den Kriegsherren am nötigen Geld, so sicherten die Landsknechte sich ihren Lebensunterhalt gewaltsam, und nach ihrer Entlassung rotteten die bald mittellosen Landsknechte sich als Gardenknechte (vergarten: versammeln, vergattern; garteten, auf der Gart) zusammen und zogen auf der Suche nach neuer Anstellung bettelnd und plündernd durchs Land.[5]
Notgedrungen ließen sich zahlreiche Landsknechte auch von fremden Mächten abwerben, welche allmählich ihre Kampfweise erlernten und übernahmen. Bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten sich in großen Teilen Europas militärische Standards herausgebildet; zwischen den Formationen, der Bewaffnung, den Truppengattungen und der Organisation der europäischen Heere bestanden keine nennenswerten Unterschiede mehr, womit auch die herausragende Stellung der Landsknechte wegfiel. Dies zeigte sich nicht nur an der Tatsache, dass die gepuffte und geschlitzte Kleidung außer Mode kam, sondern auch an der Verdrängung der Bezeichnung Landsknecht durch Kaiserlicher Fußknecht.
Die Anwerbung und Organisation von Söldnerheeren folgte im deutschen Raum bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts der Vorgehensweise aus der Landsknechtzeit. Das Söldnertum spielte zwar im Dreißigjährigen Krieg noch einmal eine entscheidende Rolle, jedoch waren zu diesem Zeitpunkt bereits Kämpfer aus weiten Teilen Europas beteiligt, so dass Landsknechte (im engeren Sinn als deutschsprachige Söldner) nicht mehr dominierten. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde das gesamte Söldnertum weitgehend durch Stehende Heere verdrängt.
Organisation des Landsknechtheeres
Anwerbung
Die meisten Landsknechte stammten aus Baden, dem Elsass, Tirol und Württemberg, aber auch aus dem Rheinland und Norddeutschland. Die Rekrutierung von Männern aus einem gemeinsamen Gebiet sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Moral steigern.
Anwerbung und Musterung wurden nach schweizerischem Vorbild durchgeführt. Ein als kriegserfahren und befähigt bekannter militärischer Führer wurde vom Kaiser, einem Fürsten oder einer Stadt (Kriegsherr) durch den so genannten Bestallungsbrief (auch Patent genannt) mit der Aufstellung eines Landsknechtregiments beauftragt. Nachdem der Kriegsherr die nötigen finanziellen Mittel beschafft hatte, stellte er als Obrist des Regiments den Offiziersstab zusammen, stattete seine Offiziere mit Werbepatenten aus und schickte sie dann mit Trommlern aus, die auf den Marktplätzen potentielle Rekruten herbeitrommelten.
Hatten sich die Rekruten eingeschrieben, mussten sie sich zur Musterung begeben, die auf dem im Bestallungsbrief festgelegten Musterplatz durchgeführt wurde. Dort angekommen, wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich gegenüber standen. Am Ende der beiden Gruppen wurde mit zwei Hellebarden und einer Pike ein Durchgang errichtet, den jeder „Bewerbsmann“ durchschreiten musste, wobei ein Kriegskommissär oder der Obrist selbst als Musterherr dessen körperliche Verfassung und seine Bewaffnung prüfte. Nach der Befragung der Angeworbenen wurden dann Name, Herkunft, Alter und Stand vom Regimentsschreiber in die Musterrolle eingetragen. Bereits kriegserfahrene Bewerber[6], konnten mehr Sold fordern. Da ein Landsknecht selbst für seine Ausrüstung aufkommen musste, verkauften Marketender auf den Sammelplätzen überteuerte Waffen und Rüstungen. Die für die Musterung zuständigen Offiziere versuchten oftmals, den Obristen zu übervorteilen. So zählten sie manche Rekruten doppelt oder stuften unerfahrene und schlecht ausgerüstete Männer als schwerbewaffnete Veteranen ein, um vom Obristen eine höhere Summe für die Besoldung des Regiments zu erschwindeln. Die Differenz zur tatsächlichen Summe behielten sie für sich selbst.
Die Rekrutierung erfolgte für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Nach der Musterung wurde den Landsknechten ihr erster Monatssold ausgezahlt und das Regiment in Fähnlein von etwa 400-500 Mann unterteilt, darunter im Idealfall mindestens 100 kampferfahrene Landsknechte, die den doppelten Sold erhielten und deshalb als Doppelsöldner bezeichnet wurden. Das gesamte Regiment musste sich in einem Kreis um den Obristen sammeln, der den im Bestallungsbrief enthaltenen Artikelbrief verlas. Der Artikelbrief umfasste die Rechte und vor allem die Pflichten der Landsknechte und wurde alle sechs Monate von Neuem verlesen. Nach der Verlesung der Kriegsartikel mussten alle Landsknechte auf Weisung des Schultheiß einen Eid auf den Kaiser oder den Obristen schwören und geloben, sich gemäß der im Artikelbrief festgelegten Feldordnung zu verhalten. Die zu Fähnrichen bestimmten Landsknechte mussten zudem schwören, die ihnen anvertraute Fahne unter keinen Umständen im Gefecht zu verlieren. Die Aufstellung des Regiments wurde durch die Unterteilung in Fähnlein (ab zirka 1600 als Kompanien bezeichnet) und Rotten abgeschlossen.
Die Organisation der Landsknechte unter Maximilian I. bildete die Grundlage des späteren Heerwesens und wurde von anderen Heeresführern übernommen. Das von einem Obristen geführte Landsknechtregiment kam auf eine Stärke von 4.000 Mann, doch wurde diese Zahl nur selten erreicht. Ein Obrist, der mehrere Regimenter kommandierte, hatte den Rang eines Obersten Feldhauptmannes oder General-Obristen inne und wurde dabei von Kriegsräten unterstützt. Ihm stand zur Befehlsübermittlung ein Herold im Offiziersrang zur Seite. Bei Abwesenheit des Obristen vertrat ihn der (Obrist-)Locotenens (der spätere Oberstleutnant), meist ein besonders erfahrener Hauptmann und selbst Führer eines Fähnleins.
im Regiment
Der Obrist verfügte neben Feldarzt, Dolmetscher, Schreiber, Trommler, Pfeifer und als Leibwache und Diener festangestellten Trabanten über einen „Staat“ (Stab) aus spezialisierten Amtsträgern seines Vertrauens (später auch Offiziere, lat. Officium=Amt, Dienst):
- Der Pfennigmeister (später Zahlmeister), verwaltete die Kriegskasse, nahm Kontributionen ein und zahlte den Sold aus. Die Besoldung der Landsknechtheere basierte zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf dem Faktor Vier, da einfache Landsknechte vier Gulden (in Norddeutschland Taler) in Silber ausgezahlt bekamen und damit deutlich mehr Lohn erhielten als ein Groß- oder Vollknecht[7]. Hakenschützen erhielten einen Gulden Zulage. Acht Gulden erhielten die Doppelsöldner sowie die Gemeinwebel, Gerichtswebel, Fouriere, Feldschere, Trabanten, Spielleute und Kapläne, zwölf Gulden die Schreiber, 16 Gulden die Feldwebel und Locotenenten der Fähnlein, 20 Gulden die Fähnriche, 40 Gulden die Hauptleute und 400 Gulden der Obrist. Abgerechnet wurde monatlich, außerdem stand den Knechten das Recht zu, nach jeder bestandenen Schlacht unabhängig vom Kalender einen neuen Soldmonat zu verlangen. Bemessen an Lebenshaltungskosten von ein bis zwei Gulden war der Sold damit recht hoch. Eine regelmäßige und angemessene Besoldung stellte aber oft nicht den Regelfall dar, was Meutereien und ungeordnete Plünderungen nach sich zog, zumal die Aussicht auf Beute für den einzelnen Knecht ein wesentlicher Antriebsfaktor war.
- Um Recht und Ordnung sowie die Einhaltung des Artikelbriefs überwachen zu lassen, erhielt das Regiment einen Schultheiß als Richter und Justizbeamten im Hauptmannsrang. Der Schultheiß leitete das Feldgericht, unterstützt 12 Schöffen aus dem Regiment, seinem Schreiber und seinem Gerichtswebel, einem Doppelsöldner, der die Gerichtsakten führte, die Gebühren eintrieb, Verhandlungen vorbereitete und als Gerichtsdiener fungierte. Der Schultheiß und seine Gehilfen übernahmen für die Landsknechte gegen Sporteln auch notarielle Beurkundungen und Aufbewahrung von Wertgegenständen.[8]
- Unter der Leitung des Quartiermeisters wurde das Lager aufgeschlagen. Er verloste die Lagerplätze an die einzelnen Fähnlein. Nach Möglichkeit wählte man vorteilhafte Plätze, wo sich Wasser, Feuerholz und Fourage fanden, und die wenigstens teilweise durch einen Fluss, Morast oder durch unwegsames Gelände geschützt wurden. Die Befehlshaber wohnten in Zelten, die Knechte in der Regel in Hütten, die sie auf einem Holzgerüst mit einem Belag von Stroh, Reisig oder Grassoden errichteten. Zwischen den Zelten und Hütten gab es für den Verkehr Straßen und für jedes Fähnlein einen besonderen Sammelplatz, den Lärmplatz. Der Quartiermeister verwaltete auch Waffen und Rüstzeug sowie Pferde und verkaufte diese den Landsknechten, die für ihre Ausrüstung selbst aufkommen mussten; außerdem kümmerte er sich mit dem Proviantmeister und den Fourieren der Fähnlein um die Versorgung mit Lebensmitteln (Profandt) oder Futter (Fourage).
- Im Lager als Ordnungshüter und Strafverfolger gefürchtet war der Profoss oder Provost, denn Ordnung und Disziplin waren stets durch Geld- und Beutegier, Saufgelage, Glücksspiel und Rauflust bis zum bewaffneten Zweikampf, dem „Balgen“, gefährdet. Der Profoss war durch einen besonderen Personenfrieden vor Racheakten geschützt. Er überwachte neben seiner Funktion als „Staatsanwalt“ und Ankläger bei Militärvergehen auch den Markt im Lager der Landsknechte und war Organisator und Leiter der Lagerfeuerwehr. Seine Steckenknechte überwachten und verhafteten verdächtige Landsknechte, sorgten aber auch mit den Trossweibern für die Latrinenreinigung. Der aus dem Kreis der Steckenknechte bestimmte Stockmeister verwahrte die Gefangenen. Im Gefolge des Provost befand sich –- mit blutrotem Mantel, roter Feder am Barett und Galgenstrick am Gürtel –- der Scharfrichter, Freimann oder Nachrichter, der mit seinem Richtschwert und dem Strick Todesurteile und Leibestrafen vollstreckte, aber auch für die Abfallentsorgung und die Abdeckerei zuständig war. Der Provost führte auch die Aufsicht über Markt und Marketender; er hatte die Preisfestsetzung vorzunehmen, die ins Lager gebrachten Waren zu prüfen und zu begutachten und dabei sowohl die Interessen der Knechte als auch die der Händler zu berücksichtigen. Von seinem Schätzamt flossen ihm auch Gebühren zu, etwa von jedem Fass Wein ein bestimmtes Quantum, von jedem Stück Vieh, das geschlachtet wurde, die Zunge oder ein Standgeld von den Marketendern und Garköchen.
- Dem Profoss unterstand der Tross- oder Hurenwebel, der als aufsichtsführender Organisator des umfangreichen Trosses, der aus Marketendern, Kleinhandwerkern, Köchen, Bäckern, Trossbuben, Prostituierten, aber auch den Kindern und Frauen der Landsknechte bestand, für den Lebensunterhalt des Regiments sorgte. Mitglieder des Trosses, der immer wieder zwielichtiges Gesindel anzog, konnten zudem zu Schanzarbeiten und anderen Hilfsarbeiten herangezogen werden. Hier hatte der Hurenwebel die Aufsicht. Diese wichtige Funktion war für viele Landsknechte die einzige militärische Aufstiegsmöglichkeit. Der Hurenwebel besaß einen eigenen Locotenens als Stellvertreter und wurde zudem vom Rumormeister unterstützt, oft einem älteren, nicht mehr waffentauglichen Landsknecht, dessen Aufgabe meist im Auseinandertreiben von streitendem Trossvolk bestand und der bei Zusammenrottungen, Plünderungen und Desertionsversuchen eingriff. Dabei verwendete er einen Knüppel, mit dem er nachts auch auf die Zapfen der Fässer schlug (zeremoniell entstand daraus der Zapfenstreich), um den Ausschank zu beenden und damit Nachtruhe zu befehlen. Nach dem Aufziehen der Nachtwache durften Wein und Bier nicht mehr ausgeschenkt werden. Mitunter führte der umfangreiche und nur schwer zu führende Tross eines Landsknechtsheeres auch eine eigene Fahne mit sich, die von einem eigenen Fahnenträger, dem Rennfähnrich, getragen wurde.
Mit dem Anwachsen der Landsknechtsheere kamen weitere Ämter hinzu:
- Um unkontrolliertes Rauben, Brennen und Morden zu vermeiden, sollten Zerstörung und Plünderung nur auf ausdrücklichen Befehl des Obristen erfolgen. Bei Bedarf ernannte dieser daher einen Beutmeister, der für die mehr oder weniger gerechte Verteilung der Beute zu sorgen hatte. Galt es nach Vorgabe des Obristen gezielt Gebäude und Ortschaften niederzubrennen oder einzureißen, so bestimmte der Obrist den Brandmeister, der mit seinen Brandknechten gegen feindliche Ortschaften vorging.
- Der bei größeren Kriegshaufen (ab 5.000 Mann) eingesetzte Wachtmeister sorgte für Bewachung, Sicherung und Befestigung des Lagers.
- Auf je etwa zehn Landsknechte musste ein Wagen gerechnet werden. Für diesen beträchtlichen Fuhrpark, aber auch das Rangieren und Manövrieren der Wagen zur Wagenburg war der Wagenmeister zuständig.
im Fähnlein
Der Hauptmann oder Kapitän war der Führer eines Fähnleins. Als Vorbild kämpften die Hauptleute gewöhnlich in den vorderen Reihen neben den Doppelsöldnern mit Schwert, Streitaxt oder Hellebarde. Häufig wurden sie auch von ranggleichen Gegnern zum Duell gefordert.[9]. Der Hauptmann hatte seinen eigenen „Staat“.
- Dazu zählte zunächst sein Locotenens (lat. „Locumtenens“ = Platzhaltender, verdeutscht auch Leutinger genannt; heute: Leutnant);
- eine wichtige Aufgabe hatte der Fähnrich, der zusammen mit dem „Spiel“, d.h. Trommler und Pfeifer, beim Sammeln, Marschieren oder im Gefecht das Zentrum des Fähnleins markierte und optische Marsch- und Bewegungszeichen gab, woraus sich später die Funktion des Tambourmajors ableitete. Dazu hatte jedes Fähnlein zwei „Spiele“ aus jeweils Trommler und Feldpfeifer zu halten, wobei die Trommler auch als Parlamentäre für Verhandlungen mit dem Feind ausgesandt werden konnten. Trommler und Pfeifer gaben im Lager das Zeichen für Wecken, Alarm und Sammeln, zur Vergatterung der Wachen und zum Zapfenstreich, und sie spielten Landsknechtslieder auf dem Marsch, mitunter aus allen Fähnlein zur Regimentsmusik zusammengefasst, und sorgten so - auch wenn der Gleichschritt noch unbekannt war - für die Marschordnung.
- Im Fähnlein waren zudem ein Feldscher als Sanitäter und Wundarzt für das körperliche und
- ein Feldkaplan als Geistlicher für das seelische Heil der Landsknechte zuständig.
- Ein besonders erfahrener Landsknecht wurde vom Obristen zum Feldwebel bestimmt; seine Aufgabe war es, die Landsknechte zu drillen und im Formationskampf zu unterweisen; außerdem kümmerte er sich um Diensteinteilungen und die Organisation des Innendienstes.
- Dabei wurde er von meist zwei Gemeinwebeln unterstützt. Die Gemeinwebel wurden ebenso wie
- der „Führer“ (später auch Guide genannt) zur Wegeerkundung und Aufklärung,
- der Fourier zur Quartiererkundung und
- bei Bedarf auch die Ambesanten (von franz. ambassade) oder Ambrosaten als Vertrauensleute von den Landsknechten monatlich neu gewählt. Diese Unterführer übernahmen auch die gerechte Verteilung von Quartieren und Proviant, das Austeilen von Munition und die Einteilung von Wachdiensten.
- Die unterste Führungsebene bildeten die Rottmeister, erfahrene Doppelsöldner vergleichbar den späteren Unteroffizieren, die von ihren jeweils etwa zehn Mann oder sechs Doppelsöldnern starken Rotten gewählt wurden.
Rechtsordnung
Feldwebel und Vertrauensleute wie Gemeinwebel, Führer oder Ambrosaten suchten, Streitigkeiten intern zu schlichten. Als besonderes Privileg durften die Landsknechte ihr eigenes Gerichtswesen organisieren. Gegenüber dem Profoss als Militärpolizist und Ankläger wirkten Führer, Gemeinwebel und Ambrosaten als Fürsprecher vor Gericht und Beschwerdeführer. Die Ambrosaten, auch als „Ringfertige“ bezeichnet, vertraten die Interessen der Landsknechtsgemeinschaft vor den Offizieren, dem Obristen und im „Ring“, der Tagungsstätte, den die Vollversammlung bildete, um Entscheidungen im Namen der Gemein zu treffen. Zu den besonderen Strafen, die über einen Landsknecht verhängt werden konnten, gehörte das Lanzen- oder Spießgericht, auch „Recht der langen Spieße“ oder „Recht vor dem gemeinen Mann“ genannt, die Urform des Spießrutenlaufs; bei besonders unehrenhaften oder besonders schweren Straftaten konnte es von der Landsknechtsgemeinde als Selbstjustiz gemeinschaftlich eingefordert werden.
Neben dem Spießgericht galt auch das Schultheißenrecht. Bei schweren Verstöße gegen die im Artikelbrief niedergelegten Pflichten traten unter Leitung des Schultheiß zwölf Geschworene aus der Gemeinschaft zum Malefizgericht zusammen und tagten im „Ring“, der öffentlichen Vollversammlung des Kriegshaufens. Bei der „Vergatterung“ (Versammlung) im „Ring“ herrschte strenge Disziplin, es durfte weder geflucht noch ungefragt gesprochen werden. Die Vertreter der Streitparteien und der Provost als Anklagevertreter trugen ihr Anliegen vor. Ein Beklagter konnte bis zu dreimal um Vertagung bitten, um Zeugen oder Beweise zu beschaffen, spätestens bei der vierten Sitzung aber mussten die Geschworenen urteilen.
Gefechtseinsatz
Bewaffnung
Stangenwaffen
Die Hauptwaffe der Landsknechte war der Langspiess, ab 1560 als Pike bezeichnet, eine bis zu sechs Meter lange Stangenwaffe mit knapp 30 cm langer Spitze. Manche Spiesser, Spiessgesellen, Spiess- oder auch Spitzbuben banden einen Fuchsschwanz als Glücksbringer an ihre Pike. Die mit einer Länge von etwa zwei Metern deutlich kürzere Hellebarde wurde von den Unterführern und Doppelsöldnern getragen. Der Feldwebel (im späteren Militärjargon als „Spieß“ etabliert) und die Gemeinwebel richteten mit ihr die Reihen aus und stellten so die Geschlossenheit der Formation sicher. Als Varianten der Hellebarde kamen auch Glefen und Partisanen, anfangs auch der Schefflin, ein Wurfspieß, zum Einsatz.
Schwerter
Zu den Schwertern der Landsknechte zählte als „Kurzwehr“ der Katzbalger, mit kurzem Griff, S-förmiger Parierstange und stumpf zulaufender Klinge oder die langmesserartige Bauernwehr, die als Stichwaffe benutzt wurde. Die gewaltigen Biehänder oder Biedenhander, bei geflammter Klinge Flamberge genannt, die länger als 1,60 Meter sein konnten, besaßen eine sehr lange und breite Klinge, die gerade oder geflammt sein konnte, einen sehr langen Griff mit langen, an den Enden gebogenen Parierstangen und zumeist Faustbügeln, mit denen geübte Fechter spezielle Manöver ausüben konnten. Die so ausgestatteten Doppelsöldner mussten auch ein Schreiben eines Meisters des Langschwertes vorzeigen, in dem bezeugt wurde, dass sie dieses Schwert beherrschen. Später dienten sie eher nur repräsentativen Zwecken, da die langen Schwerter äußerst unhandlich waren.
Handfeuerwaffen
Im Gegensatz zu den Schweizern setzten die Landsknechte bereits früh auf die Verwendung von Handfeuerwaffen, nachdem die Armbrust 1507 durch Verordnung Kaiser Maximilians offiziell aus dem Gebrauch genommen wurde - obwohl diese schnell gespannt war, lautlos den Bolzen verschoss, keinen Pulverdampf verursachte, auch bei schlechtem Wetter einsetzbar war und eine verheerende Wirkung sogar gegen gepanzerte Reiter erzielen konnte. Ein Teil der Doppelsöldner war stattdessen mit Hakenbüchsen (Arkebusen) oder Musketen bewaffnet, bei denen es sich um Luntenschlossgewehre handelte, deren Kugeln eine Reichweite von etwa 400 Schritt hatten und auf kurze Entfernung ebenfalls Harnische oder Brustpanzer durchschlagen konnten. Allerdings setzten der schwere Rückstoß, der gefährliche Umgang mit dem Zündpulver und die zielgenaue Handhabung, die nur aufgelegt auf einer Stützgabel möglich war, Geschick, Kraft und Übung voraus. Die Gabel war so leicht, dass der Schütze sie neben der Büchse tragen konnte, und ließ sich beim Anschlagen leicht nach allen Seiten drehen. Während des Ladens hielt sie der Schütze an einer ledernen, über den linken Arm gestreiften Schleife. Zielen und Treffen war außer auf kürzeste Distanz jedoch eher Zufall. Da die Kugel Spiel haben musste, um die Arkebuse mühelos laden zukönnen, schlotterte das Geschoss beim Abfeuern im Lauf und verließ das Rohr in unkalkulierbarer Richtung. Das Laden war umständlich und der Umgang mit dem unhandlichen und 20 kg schweren Waffen mühsam und zeitaufwendig. Der Hakenschütze trug ein über die linke Schulter und quer über die Brust gehängtes Bandelier, an dem die Pulverflasche mit etwa einen Pfund Schwarzpulver für 40-50 Treibladungen sowie zapfenartige Zündkrautflaschen mit den einzelnen Pulverladungen hingen. Hinzu kam die mit den 80 g schweren, 30 mm dicken Bleikugeln gefüllte Ledertasche. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts übernahmen manche Landsknechte auch Radschlosspistolen.
Rüstung
Nur ein Teil der Landsknechte war durch einen Harnisch geschützt. Manche Pikeniere und Hellebardiere trugen Kettenhemd, Brigantine, Kürass beziehungsweise Korazin oder Brustpanzer, mitunter mit Beintaschen zum Schutz der Oberschenkel. Dabei wurde aus Kostengründen mitunter auf die Rückenplatte verzichtet. Der Preis eines Pikenierharnischs betrug üblicherweise zwölf Gulden, was dem Sold für drei Monate entsprach. Rege Verbreitung fand der Bischofskragen aus Kettengeflecht, der den Hals- und Schulterbereich bedeckte. Manche Landsknechte trugen eine stählerne Hirnhaube oder einen Eisenhut, bis sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts als „Kopfbedeckung nach Burgunder Art“ die Sturmhaube und der Morion durchsetzten.
Die Hauptleute schützten sich meist durch einen nahezu vollständigen Harnisch, da sie in den vordersten Reihen der Formation kämpfen mussten und sich im Gegensatz zu den einfachen Landsknechten einen derartigen Körperschutz leisten konnten. Die Obristen legten bei der Wahl ihrer Rüstung großen Wert auf Repräsentation. Zu einem qualitativ hochwertigen Feldharnisch erwarben manche einen Rossharnisch für ihr Pferd.
Artillerie
Die „Arckeley“ oder Artillerie eines Landsknechtheeres hatte eine rechtliche und organisatorische Sonderstellung inne.
Büchsenmeister oder Stückmeister dienten fest angestellt als Kriegsingenieure und Artillerieoffiziere. Unter ihrer Leitung arbeiteten Feuerwerker, Glockengießer, Schmiede, Pulvermacher, Zimmerleute und andere Handwerker. Kommandiert wurde sie von dem Obersten Zeugmeister, der bei der Plünderung einer eroberten Stadt ein Anrecht auf sämtliche intakten Geschütze und sonstige Waffen der besiegten Gegner hatte. Ein Drittel dieser Beute musste jedoch dem Obristen übergeben werden. Für den Transport der Geschütze war der Geschirrmeister zuständig, während der Zeugwart über die Munition und den eigenen Tross der Artillerie wachte.
Die Artilleristen verfügten über ein eigenes Rechtswesen und konnten nicht vom Provost belangt werden. Gelang es gar einem Landsknecht, der eines Verbrechens beschuldigt war, auf der Flucht vor dem Provost ein Geschütz zu berühren, konnte er sich für eine bestimmte Zeit in Sicherheit wähnen. Der Provost durfte ihn unter diesen Umständen innerhalb der darauf folgenden 72 Stunden nicht festnehmen, doch durfte sich der Landsknecht nicht mehr als 24 Schritte von dem Geschütz entfernen. Grund dieser aufschiebenden Wirkung gegen die Festnahme war, dass der Verfolgte durch Berühren des Geschützes zu verstehen gab, dass er Landsknecht der Artillerie sei, die innerhalb des Heeres über einen eigenen Tross verfügte und deren Landsknechte nicht vom Provost belangt werden konnten. Da Geschütze in der Regel nicht längere Zeit unbeaufsichtigt blieben, konnte der Verfolgte damit rechnen, dass innerhalb von 72 Stunden ein Angehöriger der Artillerie auf seinen Fall aufmerksam wurde. Der Artillerie war es auf diese Weise möglich, die Identität des vermeintlichen Artilleristen festzustellen und, falls es sich tatsächlich um einen Artilleristen handelte, ihn der eigenen Befehlsgewalt zwecks Aufklärung zuzuführen. Verstieß der Provost gegen dieses Gesetz, durfte der Kommandant der Artillerie aus Protest sämtliche Geschütze abziehen lassen.
Die Besoldung der Stückknechte war höher als die der restlichen Landsknechte, da sie an Plünderungen nicht teilnehmen durften. So erhielt ein Schneller, der die Geschütze nachladen musste, sechs Gulden monatlich, womit sein Sold 50 % höher war als der eines einfachen Landsknechts. Auch bei der Essensausgabe wurden die Artilleristen stets bevorzugt behandelt.
Die Geschütze hatten oft klangvolle Namen, wie „Faule Magd“, „Chriemhilde“, „Spinnerin“, „Tolle Grete“ oder die „große Pumhardt“, welche heute im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ausgestellt ist. Es herrschte große Typen- und Begriffsvielfalt, für die Geschütze der Landsknechtheere versuchte Maximilian I. daher, einheitliche Bezeichnungen und Kategorien festzulegen.
Für den direkten Schuss im Flachfeuer (Rohrerhöhung bis 45°) dienten „Büchsen“ oder „Stücke“. Es gab die Scharfmetze, ein 70-pfündiges Belagerungsgeschütz, dessen Rohr von 16 und dessen Lafette von sechs Pferden gezogen wurde, sowie die Quarte, ein 40-Pfünder, von zwölf, beziehungsweise sechs Pferden gezogen. Es folgten die Feldgeschütze wie die 20-pfündige Notschlange, die 11-pfündige Feldschlange oder Serpent, die 8-pfündige Halbschlange, das 6-pfündige Falkonett. Daneben existierten Hauptbüchse, Notbüchse oder Nachtigall, Basiliske, Kartaune (das heißt eigentliche Quartane === Viertelsbüchse), Singerin, Falkaune, Ronterde, Pommer, Sau, Wagen-, Bock-, Not-, Zentner- und Riegelbüchse und das Ribauldequin oder Orgelgeschütz. Hinzu kam die ortsfest auf stabilen Holzbalken aufgebockte Bombarde zur Zerstörung von Festungswerken im direkten Schuss, oft hinter einem hochklappbaren Schirm aus stabilen Holzbalken, und die aus den Hussitenkriegen zur Verteidigung der Wagenburg übernommenen Tarasnitzen (Terrabüchsen) und Haufnitzen. Für das Steilfeuer (Rohrerhöhung >45°) gegen Festungen oder bei Belagerungen wurden Feuertöpfe oder Mörser, Böller, Roller und Wurfkessel verwendet, wobei zum Teil sogar pulvergefüllte Hohlkugeln als Sprengeschosse verschossen wurden.
Taktik
Die Formation der Landsknechtregimenter orientierte sich zunächst stark an den annähernd quadratischen Gewalt- oder Gevierthaufen der Schweizer, die über 5.000 Mann umfassen konnten. Das Zentrum der 18 Mann tiefen und breiten gevierten Ordnung oder des Gevierthaufens bestand aus den Hellebardieren und Pikenieren, wobei in den ersten und letzten Reihen die erfahrensten und besser gepanzerten Doppelsöldner postiert wurden. Diejenigen, die in den letzten Reihen standen, sollten ihre Vordermänner antreiben und fliehende Kameraden rücksichtslos umbringen. So ergab sich die Kampfkraft aus der Wucht der dichtgedrängten Spießträger, deren Stoßkraft durch den Druck der hinteren Glieder gesteigert wurde.
In jener Zeit, die weder militärisches Exerzieren noch feste Marschordnungen kannte, bildete Georg von Frundsberg seine Landsknechtshaufen gezielt aus: das Teilen in Vorhut, Hauptmacht und Nachhut, das Ansetzen der Spieße zum Stoß, das Bereitstellen der Schützen zum Feuerüberfall oder das Ausmachen von Schwachpunkten in der Kampfaufstellung des Feindes.
Zu Beginn des Gefechts traten die Arkebusiere vor und schossen Lücken in die gegnerischen Formationen. In den Ladepausen und im Nahkampf traten die Arkebusiere in das Geviert zurück und wurden von den Pikenieren geschützt. Nun drang der „Verlorene Haufen“ –- etwa 1/5 bis 1/10 der Gesamtstärke des Regiments focht unter der roten Blutfahne –- auf den Gegner vor. Freiwillige, verurteilte Straftäter und ausgeloste Landsknechte, oft nur mit Katzbalger und Zweihändern ausgerüstet, sollten als Todeskommando in besonders kritischen Gefechtssituationen, als Vorausabteilung beim Angriff oder als Nachhut beim Rückzug, die Kampfformation des Gegners im ersten Zusammenprall erschüttern.
Dann folgte die Hauptstreitmacht, der „Helle Haufen“. Vorn kämpfte der Hauptmann, als linker und rechter Flügelmann hielten die beiden Gemeinwebel zusammen mit dem Feldwebel die Ordnung in der bis zu sechs Glieder tief „geschichteten“ Formation aus zahlreichen Pikenieren, in deren Mitte sich eine Anzahl von Hellebardieren sowie einer kleinen Elite von Zweihandschwertkämpfern, seltener Rondartschieren oder Tartschenieren mit Kurzspieß und rundem Schild, verbarg, um nach dem ersten Zusammenprall tiefe Breschen in die feindlichen Linien zu schlagen. Beim Zusammenprall der gegnerischen Gewalthaufen entstand ein gewaltiges Drängen, Hauen und Stechen: mitunter stürzte auf einer oder beiden Seiten das erste Glied zu Boden, das zweite und dritte Glied drangen nach, auch die hinteren Glieder drückten und drängten. Mann an Mann fest aneinandergepresst, fast ohne die Waffe gebrauchen zu können, verkeilten sich die vordersten Glieder; da diese gut gerüstet waren, zerbrachen beim ersten Anprall zum Teil die Spieße, wurden in die Luft abgedrängt oder glitten trotz der eingeritzten Kerben rückwärts den Knechten durch die Hand.
Das Fähnlein, der taktische Gefechtsverband für den Gewalthaufen, umfasste im Idealfall 300 Pikeniere und 100 Doppelsöldner, darunter 50 Arkebusiere und 50 Hellebardiere, doch verschob sich das zahlenmäßige Gewicht im Laufe der Zeit zugunsten der Arkebusiere. Da die Linien mit etwas Abstand hintereinander aufgestellt waren, sollte der Haufen auch dann noch standhalten können, wenn die vordersten Reihen der Pikeniere bereits durchbrochen waren. Im Zentrum der Schlachtordnung schwenkte der Fähnrich hoch über dem Haupt die Fahne, das für Freund und Feind sichtbare Feldzeichen, welches im sich nun ergebenden dramatischen Schlachtgetümmel den buntgemischten Landsknechthaufen zusammenhalten musste. An seiner Seite marschierte das Spiel: Der Trommler oder Trummetschlager mit der hohen hölzernen, kalbfellbespannten Holzpauke am Bandelier, vor der Brust die Trommelstöcke eingesteckt, wenn er nicht gerade den fünfschlägigen Marschtakt schlug, daneben schritt der Feldpfeifer, der mit seiner sechslöchrigen, zylindrisch gebohrten Querpfeife gemeinsam mit dem Trommler den Schlachtenlärm zu übertönen und die Befehlssignale weiterzugeben hatte.
Auf offenem Feld eingesetzt war die Artillerie unbeweglich, schwerfällig und damit verwundbar, und ihr Feuer mit massiven Kugeln gegen bewegliche Ziele zeigte nur bedingt Wirkung. Die Fertigkeit des Richtens war nur gering entwickelt, die Kugeln gingen zu hoch; die Gewalthaufen der Infanterie legten sich hin, wenn sie im Geschützfeuer zu halten hatten, oder versuchten es zu unterlaufen, so dass das Geschütz oft zu nicht mehr als einem Schuss kam.
Zum Transport eines Geschützes brauchte man noch bis zu zehn Pferde. Als Kaiser Maximilian im Jahre 1507 ins Feld rückte, soll nur die Hälfte seiner Artillerie bespannt gewesen sein, so dass die Gespanne nach dem in Stellung bringen der ersten Hälfte wieder umkehren und die zweite Hälfte der Geschütze vorbringen mussten.
Der Gefechtswert der Artillerie war daher in längeren Stellungsgefechten und Belagerungen deutlich höher. Hierbei wurden für die Artillerie Notbollwerke oder Bastionen angelegt, gegen Gewehrfeuer und als Splitterschutz dienten Schanzkörbe und Palisadenzäune. Die Feldbefestigungen wurden oft durch Schanzbauern oder Trossleute angelegt.
Drohte die Umzingelung des Gevierthaufens durch gegnerische Truppen, bildeten die Landsknechte den kreisförmigen „Igel“, auch „Rädlein“ genannt. Dabei zogen sich die Arkebusiere hinter die Pikeniere zurück, die mit aufgestützter Waffe den Angriff abwarteten. Als fester Stützpunkt, Verteidigungsstellung und Zufluchtsort diente zudem nach hussitischem Vorbild die Wagenburg.
Die Landsknechtführer perfektionierten die Kampftaktik nach dem Vorbild des spanischen Feldherren Gonzalo Fernándo de Córdoba. Dieser hatte bereits 1495 2.000 Landsknechte von Maximilian I. zur Verfügung gestellt bekommen, um mit ihrer Hilfe die spanische Infanterie zu reformieren. Tatsächlich erlangte die spanische Infanterie innerhalb weniger Jahre einen herausragenden Ruf. Zu den Reformen von Córdoba zählte die Entwicklung der so genannten Tercio-Formation. Dabei wurde der Gevierthaufen verkleinert, so dass er sich besser manövrieren ließ. Zum Schutz der Flanken und zur Erhöhung der Feuerkraft postierten sich an den Ecken des Gevierthaufens Arkebusiere. Die so entstandenen Tercios verteilten sich schachbrettartig auf dem Schlachtfeld, um sich gegenseitig Feuerschutz geben zu können. Bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein kämpften die Fußsoldaten der meisten europäischen Armeen in der Tercio-Formation, die auch als „Spanisches Viereck“ bekannt war.
Lebensumstände
Gesellschaftliche Herkunft und Stellung
Bei den Landsknechten handelte es sich oft um einfache Handwerker und Gesellen, Kleinkriminelle und Bauernsöhne, die sich von dem relativ hohen Sold und etwaigen Plünderungen eine finanzielle Alternative erhofften, aber auch um junge Adelssöhne, die von der Erbfolge ausgeschlossen waren. Einfache Landsknechte lebten jedoch im Regelfall am Rande der Armut, da sie ihre Ausrüstung und Nahrung zu überhöhten Preisen verkauft bekamen. Zudem waren sie unter Zivilisten Außenseiter, denen man bestenfalls Misstrauen entgegenbrachte. Sollten ursprünglich nur ausdrücklich unbescholtene und ehrliche Männer geworben werden, stellte man später jedes Gesindel ein; Landsknechte galten daher zunehmend als Sinnbild der Unmoral und Gotteslästerlichkeit. In deutschen Kreuzigungsgemälden des 16. Jahrhunderts war es üblich, die römischen Soldaten als Landsknechte darzustellen. Sebastian Franck beschreibt sie in seiner Chronica des gantzen Teutschen lands entsprechend:
„Es ist durch die bank hindurch alweg und alzeit ein böss unnütz volk, nit wenige dann münch und pfaffen. Ist es im krieg, so ist under tausend kaum einer an seinem sold begnuegig, sunder stechen, hawen, gotslestern, huoren, spielen, morden, brennen, rauben, witwen und weisen machen, ist ir gemein handwerk und höchste kurzweil.“
In Friedenszeiten waren die Landsknechte verachtet und galten nur wenig mehr als Landstreicher. Auch außerhalb des Krieges benahmen sie sich nach eigenen Moralvorstellungen und nahmen sich etliche Freiheiten heraus. Waren die Landsknechte nach dem Ende eines Feldzuges oder Krieges von ihren militärischen Pflichten entbunden, so sahen sie sich gezwungen, zu „garten“, also bettelnd oder plündernd durch das Land zu ziehen. Kriegversehrten blieb nur ein Leben als Bettler übrig. Das Problem der umherziehenden Söldnerbanden, unter denen vor allem die bäuerliche Bevölkerung zu leiden hatte, konnte bis weit in das 17. Jahrhundert hinein nicht gelöst werden. Entsprechend schreibt Sebastian Franck weiter:
„Kummen sie denn nach dem kreg mit dem bluotgeld und schweiss der armen heim, so machen sie ander leut mit inen werklos, spacieren müessig in der statt creuzweiss umb mit jedermann ärgernus, und sind niemand nicht nutz denn den würten und stellen sich, als sei inen geboten, sie sollen eilends wider verderben. Die andern, denen die beut nicht geraten ist, laufen daussen auf der gart um, das zuo Teutsch bettlen heisst, des sich ein frommer heid, will geschweigen ein christ, in sein herz hinein schämt.“
Philipp Herzog von Kleve warnte:
„Von gemeynen knechten […] waiß ich nichts besseres, wann das ain Jeder herr sich vor Inen, alls vil Jm mueglich, huete, wann er aber sy uß unvermeidlicher notturft haben muss, alßdann betzal er sy wol, gebrauch sy nach der hant, und straff die verbrechen ubel.“
Neben die soziale Randstellung der Landsknechte trat ihre äußerst geringe Lebenserwartung. Bereits eine leichte Verletzung im Kampf konnte eine Wundinfektion zur Folge haben, die zum Tod des Betroffenen führte. Eine nennenswerte medizinische Versorgung oder gar Lazarette existierten nicht. Hinzu kamen Seuchen, die vor allem bei längeren Belagerungen zahlreiche Menschen dahinrafften. Auch Geschlechtskrankheiten waren äußerst verbreitet. Eine zeitgenössische Redensart wies nicht zu Unrecht darauf hin, daß man nur selten alte Landsknechte sieht.
Hans Sachs dichtete „Wilder Leute hab ich nie gesehen. / Ihre Kleider aus den wildesten Sitten, / Zerflammt, zerhauen und zerschnitten. / Einsteils ihr Schenkel blecken (entblößen) täten, / Die andern groß weit Hosen hätten, / Die ihnen bis auf die Füß herabhingen, / Wie die gehosten Tauber gingen. / Ihr Angesicht schrammet und knebelbartet, / Auf das allerwildest geartet; / In summa: wüst aller Gestalt, / Wie man vor Jahren die Teufel malt.“[10]
Landsknechtmode
Landsknechte drückten somit ihre Verwegenheit durch extravagantes, provozierendes Erscheinungsbild aus. Ihre äußerst bunte Bekleidung bestand aus gepufften und geschlitzten Hemden und Hosen, zu denen sie eine Bundhaube bzw. schräg darüber ein breitkrempiges mit Federn und Wollbüschen bunt geschmücktes Barett aufsetzten. An den Füßen trugen sie die nach ihrer Form benannten Kuhmaulschuhe. Da es keine Uniformen gab, unterschieden sich die Knechte im Kampf an einem Band bestimmter Farbe, das quer über der Brust getragen wurde. Um sich von Zivilpersonen zu unterscheiden galt das Reisig als Erkennungszeichen des bewaffneten Haufens. Die kaiserlichen Truppen Österreichs trugen ein Tannenzweiglein als Reisig weit bis nach dem Dreißigjährigen Krieg. Noch im Ersten Weltkrieg war das Tannenzweiglein Symbol des österreichischen Militärs, die ungarischen Grenztruppen trugen es noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.[11]
Typisch waren auch das vor der Brust verschnürte Lederwams und bunt gefärbte Socken. Der Ursprung der geschlitzten Mode ist unklar; so wird vermutet, dass die enge Kleidung des späten 15. Jahrhunderts im Kampf äußerst hinderlich war. Die Landsknechte schlitzten sie deshalb auf, banden sich Stofffetzen um die Ärmel und ließen die dicken Unterstoffe herauspludern. Beliebt war auch zweifarbig geteilte Kleidung, nach italienischer Mode „mi-parti“ genannt. Die auffällige gepuffte und geschlitzte Kleidung der Landsknechte, die eine imponierende Wirkung erzielen sollte, wurde in adeligen Kreisen als Anmaßung betrachtet. Auf Initiative Maximilians I. billigte ihnen der 1503 tagende Reichstag zu Augsburg jedoch das Recht zu, sich nach eigenem Gutdünken zu kleiden. Die Bekleidung war absolut uneinheitlich, lediglich die Offiziere waren meist durch eine bunte Schärpe erkennbar. Gelegentlich schnitten sich die „Spießer“ oder „Spießgesellen“ ihr Beinkleid dicht über dem linken Knie ab, um die Pike besser handhaben zu können und den Stolz auf ihren Stand kund zu tun. Der Hosenlatz der meisten Landsknechte suggerierte ein besonders großes Geschlechtsteil, was insbesondere Geistliche mit Entsetzen zur Kenntnis nahmen. Die Kleidung der Landsknechte beeinflusste die zivile Mode des damaligen Europas stark und wurde sogar in Stahl nachgebildet. So entstanden „gepuffte und geschlitzte“ Paraderüstungen, die repräsentativen Zwecken dienten. Die Mode der Schamkapseln geht auf die Landsknechte zurück, die ihren Hosenlatz als Erste auspolsterten.
Berühmte Landsknechte und Landsknechtsführer
- Konrad von Boyneburg, der „kleine Hess“
- Götz von Berlichingen, der „Ritter mit der eisernen Faust“
- Marx Sittich von Ems, der „Bauernschlächter“
- Joß Fritz
- Leonhard Fronsperger, bedeutendster deutsche Militärschriftsteller des 16. Jahrhunderts, Feldgerichtsschultheiß unter Kaiser Maximilian II.
- Georg von Frundsberg, der „Vater der Landsknechte“
- Florian Geyer, der Anführer der aufständischen Tauberbauern
- Jörg Graff
- Graf Eitelfritz (Eitel Friedrich) II. von (Hohen-)Zollern, der erste Feldhauptmann der Landsknechte und
- dessen Sohn Graf Eitelfritz (Eitel Friedrich) III. von (Hohen-)Zollern
- Hans Walther von Hürnheim
- Reichsritter Ulrich von Hutten, patriotischer Humanist und Dichter
- Thomas Maier
- Remigius Mans, genannt „der Riese Romäus“
- Graf Engelbert von Nassau, erster Statthalter der Grafschaft Holland
- Jäcklein Rohrbach, Rebell und Bauernführer
- Niklas Graf Salm
- Sebastian Schertlin von Burtenbach, Oberkommandant aller Landknechte im Deutschen Reich
- Franz von Sickingen, der Anführer im pfälzischen Ritterkrieg
- Thomas Slentz, der Führer der „schwarzen Garde“
- Hans Staden
- Georg Truchsess von Waldburg-Zeil bekannt als Bauernjörg
- Ulrich Schmidl, ein Abenteurer und Konquistador
- Hans Wild
Literatur
- Thomas Arnold: The Renaissance at War, London 2002, ISBN 0-304-36353-7
- Ernst Götzinger: Reallexikon der deutschen Altertümer, Leipzig 1885, daraus die Zitate von Sebastian Franck: Chronica des gantzen Teutschen lands, Bern 1539
- Baumann, Reinhard: Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg, München 1994
- Blau, Friedrich: Die deutschen Landsknechte, Görlitz 1882, Nachdruck Wien 1985, ISBN 3-88851-032-5
- Burschel, Peter: Söldner im Nordwestdeutschland des 16. und 17. Jahrhunderts. Sozialgeschichtliche Studien, Göttingen 1994
- Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst: Das Mittelalter. Die Neuzeit ISBN 3-937872-42-6
- Fiedler, Siegfried: Taktik und Strategie der Landsknechte, Augsburg 2002
- Fronsperger, Lienhart: 'Die Kaiserlichen Kriegsrechte’, 1552
- Fronsperger, Lienhart: ‘Fünff Bücher von Kriegsregiment und Ordnung', 1566
- Hochheimer, Albert: Verraten und verkauft. Die Geschichte der europäischen Söldner, Henry Goverts Verlag, Stuttgart 1967
- Kroll, Stefan/ Krüger, Kersten (Hrsg.): Militär und ländliche Gesellschaft in der frühen Neuzeit, Hamburg 2000
- Liebe, Georg: Soldat und Waffenhandwerk, Leipzig 1899
- Douglas Miller, John Richards: Landsknechte 1486-1560, St. Augustin 2004, ISBN 3-87748-636-3
- Müller, Reinhold und Lachmann, Manfred: Spielmann, Trompeter, Hoboist, Berlin (Ost) 1988, ISBN 978-3-327-00852-2
- N.N.: Der große Brockhaus (Band 11), Leipzig 1932
- Ortenburg, Georg: Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Landsknechte, Koblenz 1984
- Pleticha, Heinrich: Landsknecht Bundschuh Söldner - Die große Zeit der Landsknechte, die Wirren der Bauernaufstände und des Dreißigjährigen Kriegs, Würzburg 1974, ISBN 3-401-03714-5
- Quaas, Gerhard: Das Handwerk der Landsknechte. Waffen und Bewaffnung zwischen 1500 und 1600, (Militärgeschichte und Wehrwissenschaften Band 3), Osnabrück 1997. ISBN 3-7648-2508-1
- Rogg, Matthias: Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten: ein Stand in der Kunst des 16. Jahrhunderts, Paderborn u.a. 2002. ISBN 3-506-74474-7
- Schmidtchen, Volker: Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie, Weinheim 1990. ISBN 3-527-17580-6
- Stöcklein, Hans: Der deutschen Nation Landsknecht, Leipzig: Bibliographisches Institut (1935).
- Von Seggern, Birgit: Der Landsknecht im Spiegel der Renaissancegrafik, Bonn 2003
Einzelnachweise
- ↑ http://www.xxx (3. Januar 2010)
- ↑ http://www.xxx
- ↑ „Faisons le limechon ä la mode d'Allemagne“ und „chacun avalle sa picquell“ zitiert nach Max Laux, Der Ursprung der Landsknechte, In, Zeitschrift für Kulturgeschichte 8 (1901) S. 12, zitiert gem. [1]
- ↑ „Damals wurde Konrad Gächuff von der Tagsatzung verklagt, er habe geäußert, er wolle schwäbische, und andere Landsknechte so ausrüsten und unterrichten, dass einer derselben mehr wert sei, als zwei Eidgenossen.“ Vgl. [2]
- ↑ http://xxx
- ↑ als „Beschossene Knechte“ bezeichnet, vgl. [3]
- ↑ vgl [4]
- ↑ [5]
- ↑ http://xxx
- ↑ vgl. [6]
- ↑ http://www.xxx
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Edelknecht
Ein Edelknecht (Armiger) war ein adliger, ritterbürtiger, erwachsener, aber noch nicht zum Ritter geschlagener oder mit dem Schwert umgürteter mittelalterlicher Krieger oder Edelmann.
Der Begriff Edelknecht wird allerdings in der Literatur und Dichtung nicht einheitlich verwendet. Oft werden auch Schildknappen oder ritterliche Dienstmannen als Edelknechte bezeichnet. In den zeitgenössischen lateinischen Quellen erscheinen Edelknechte u.a. als "servientes equites, servientes loricati, famuli, scutiferi, satellites equestres, clientes oder servientes armati ut milites". Diese Begriffe können wiederum auch nicht ritterbürtige Sergenten (franz: "sergents à cheval") bezeichnen, also nach ritterlicher Art bewaffnete Krieger nichtritterlicher Abstammung.
Mit dem militärischen Bedeutungsverlust der Ritter, Edelknechte und Schildknappen im 16. Jahrhundert mutierten die Funktionstitel Edelknecht bzw. Schildknappe in vielen Ländern Europas zu einem bloßen Adelstitel. Beispiele dafür sind Edler in den Monarchien Süddeutschlands und in Österreich, sowie écuyer in Frankreich oder squire in England.
Ritter und Edelknecht
Aber diese Würde war ein Schmuck der Wohlhabenden und Ansehnlichen des Standes geworden, sie wurde von der großen Mehrzahl des Adels nicht mehr erworben, ja nicht einmal begehrt. (Gustav Freytag)
Die meisten Angehörigen des niederen Dienstadels mussten aus wirtschaftlichen Gründen auf den Erwerb der Ritterwürde verzichten. Häufig ermöglichte man nur dem ältesten Sohn einer Familie den Ritterstand, seine Brüder mussten Edelknechte bleiben. Für das tägliche Leben hatte dies wenig Bedeutung, allenfalls bei Turnieren wurden Unterschiede zwischen Rittern und Knechten gemacht. Die drei Ritterpferde standen nur „richtigen“ Rittern zu, Edelknechte mussten sich mit zweien begnügen, wurden aber meist zum Turnier zugelassen.
Eine sichtbare Unterscheidung zwischen Edelknechten und Rittern war ursprünglich der Schwertgurt, der das eigentliche Symbol der Ritterwürde war (Schwertleite). Nichtritterliche Krieger befestigten das Schwert üblicherweise am Sattel. Diese Unterscheidung wurde in der Realität allerdings rasch aufgegeben. So trägt etwa der Edelknecht Konrad Kolb von Boppard (gest. 1393) auf seinem Grabstein in der Karmelitenkirche zu Boppard einen reich verzierten Schwertgurt. Auch sonst präsentiert sich der Edelmann in der vollen ritterlichen Bewaffnung. In der zugehörigen Inschrift wird er ausdrücklich als Armiger bezeichnet.
Der niedere Adel, der den größten Teil der Ritter und vor allem der Edelknechte stellte, war nicht nur ein Berufskriegerstand. So waren die mitteleuropäischen Kleinadligen mehr größere Bauern und Gutsverwalter als Soldaten, so dass die Ritterwürde im Alltag entbehrlich war.
Einigen Edelknechten wurde wegen besonderer Tapferkeit oder anderer Verdienste sogar mehrmals die Ritterwürde verliehen. Allerdings waren diese „Promotionen“ eher von symbolischem Charakter, vergleichbar einer Ordensverleihung. Den Ausgezeichneten fehlte meist die wirtschaftliche Grundlage, um die Ritterwürde dauerhaft anzunehmen. Der ständige Unterhalt der drei üblichen Ritterpferde und der entsprechenden Anzahl an Knechten war diesen Niederadligen aus finanziellen Gründen meist unmöglich oder einfach zu teuer. Auch die Ausrichtung einer standesgemäßen „Promotionsfeier“, bei der üblicherweise die gesamte umliegende Adelsgesellschaft eingeladen werden musste, dürfte viele abgeschreckt haben. Als Edelknecht war man auch als „Ausbilder“ eines jungen Ritters ungeeignet, sparte sich hier also erheblichen zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Aufwand.
Die gleichzeitige Ritterpromotion vieler Edelknechte war vor allem anlässlich größerer Schlachten üblich. Wenn die Zahl der ausgezeichneten Knechte auch häufig übertrieben überliefert sein dürfte, wurden sie manchmal schon vor der Schlacht zur Hebung der Kampfmoral ausgesprochen. Die Promotion nach dem Kampf war als besondere Ehrung tapferer Krieger weitaus häufiger. Hier zählte die Leistung mehr als die Herkunft, auch Bauern und Handwerker wurden gelegentlich derart ausgezeichnet. Auch anlässlich von Turnieren oder Hochzeiten kamen Massenpromotionen vor. Wie erwähnt blieben diese Promotionen oft ohne Auswirkungen auf den tatsächlichen Stand des Geehrten.
Aus allen diesen Gründen verzichteten auch etliche wohlhabende Adlige auf die Ritterwürde. Dies scheint im späteren Mittelalter so überhand genommen zu haben, dass sogar regional Gesetze und Verordnungen erlassen werden mussten, die Ritterwürde bei entsprechendem Vermögen also verbindlich vorgeschrieben wurde.
Gustav Freytag vermutete um 1860 in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit (Band 2,1, S. 375/376), es habe etwa fünf Mal mehr Edelknechte als Ritter gegeben. Für das ausgehende Mittelalter reduzierte er dieses Zahlenverhältnis sogar auf zehn zu eins. Trotz des weitgehenden Fehlens verlässlicher statistischer Angaben dürften die Schätzungen Freytags annähernd der Realität entsprechen. 1397 sollen am Frankfurter Fürstentag 1300 Ritter und 3700 Edelknechte teilgenommen haben. Die Teilnahme an einem derartigen gesellschaftlichen Großereignis war sicherlich nur wohlhabenden Edelknechten möglich.
Die Bopparder Karmelitenkirche birgt noch eine weitere Grabplatte eines Edelknechtes. Die Deckplatte eines ehemaligen Hochgrabes zeigt Wilhelm von Schwalbach und seine Hausfrau Anna von Leyen. Der Herr von Schwalbach trägt auch hier die volle ritterliche Ausrüstung und stützt sich auf ein großes zweihändiges Schwert. Die reiche Ausführung seines Grabmales deutet darauf hin, dass er sicherlich in guten wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt haben muss.
Allerdings versuchten einige Feudalherren auch systematisch, die Entstehung eines mächtigen und wohlhabenden Ritterstandes zu unterdrücken. Edel- und insbesondere nicht ritterbürtige Kriegsknechte waren einfach „preiswerter“ und leichter zu kontrollieren. In Zuge des allgemeinen Niederganges des Rittertums wuchs die Zahl der Edelknechte, arme „Ritter“ waren also meist gar keine.
Der Begriff Ritter umfasste ursprünglich alle berittenen Krieger, später wandelte er sich zur Standesbezeichnung. In den Augen der Bevölkerung waren Edelknechte auch „Ritter“, bis heute werden diese beiden unterschiedlichen Versionen des „Rittertums“ selbst in der seriösen wissenschaftlichen Literatur nicht deutlich genug unterschieden. Allerdings erleichtert diese Unterscheidung das Verständnis des gesellschaftlichen Phänomens Ritterschaft und besonders seines Unterganges deutlich.
Während der Schwertleite bzw. des Ritterschlages sollen oft die Worte Besser Ritter als Knecht gesprochen worden sein. Ein Beleg hierfür ist etwa der Ritterschlag Herzog Albrechts III. von Österreich, den Peter Suchenwirt um 1380 in seiner Dichtung Von Herzog Albrechts Ritterschaft überlieferte:
- Der graf von Zil Herman genant,
- daz swert auz seiner schaide zoch
- und swencht ez in di luften hoch
- und sprach zu herzog Albrecht:
- "Pezzer ritter wenne chnecht!"
- und slug den erenreichen slag.
- Do wurden auf den selben tag
- Vir und sibenzig ritter.
Quellen und Nachweise
1264
- Zeitschrift für Deutsches Alterthum. - Berlin [u.a.] : Weidmann, 8 (1851), S. 550
1311
ain todslag von graven, freien, dinstmannen, ritter oder edlen knecht, das sol steen an unsern gnaden...
- Die altbaierischen landständischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklärungen: nach den officiellen Druckausgaben mit geschichtlicher Einleitung und kurzem Wörterverzeichnisse, hrsg. durch Gustav von Lerchenfeld. München: Kaiser, 1853.
1316
wir ritter und eidelknechte und die burgere gimenlich...
- Monumenta Germaniae Historica (München): MGConst. V, S. 290
1. Viertel des 14. Jahrhunderts
manic edel kneht, biderb unde frumic, baten do den kunic, daz er si ritter werden liez
- Monumenta Germaniae Historica: [Scriptores: 8]; 5,1, Vers 15850ff
- Weitere Nachweise: Deutsches Rechtswörterbuch (DRW)[1]
Rixner
Eine der wertvollsten und leicht zugänglichen Quellen zur "Edelknechtschaft" ist das "Turnierbuch" Georg Rüxners (Rixners) (1530). In den Turnierlisten werden die Ritter und Edelknechte besonders bei spätmittelalterlichen Turnieren getrennt, oder die Ritterwürde wird hinter dem Namen erwähnt. Die Anzahl der Edelknechte übertrifft die der Ritter bei weitem. Manchmal waren weniger als ein Viertel der Teilnehmer Ritter. Die nichtritterlichen Kämpfer werden als "Edle", "Knecht" und "Edelknecht" bezeichnet. Das nur in drei Originalexemplaren erhaltene Werk wurde der Forschung 1997 als Reprint zugänglich gemacht.
- Georg Rixner: Turnierbuch - Reprint der Prachtausgabe Simmern 1530. Solingen, 1997. ISBN 3-930132-08-7
Literatur
- Ulrich Lehnart: Ritter, Knappen und Sergenten. In: Die Schlacht von Worringen 1288 - Kriegsführung im Mittelalter, S. 18 - 23. Frankfurt am Main, 1993. ISBN 3-923217-66-8
- Rudolf Kilian Weigand: Halbritter und Schildknechte. Zur Kategorisierung und Illustrierung sozialer Randgruppen im ›Renner‹ Hugos von Trimberg. In: Die Präsenz des Mittelalters in seinen Handschriften. Ergebnisse der Berliner Tagung in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 06. - 08. April 2000, hg. von H.-J. Schiewer und K. Stackmann, Tübingen 2002, S. 83-105.
Einzelnachweise
- ↑ www.xxx
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Eduard I. (England)
Eduard I., englisch auch Edward Longshanks (* 17. Juni 1239 in Westminster, London, England; † 7. Juli 1307 bei Burgh by Sands, Grafschaft Cumberland, England), war von 1272 bis 1307 König von England, ab 1283 auch Fürst von Wales. Er war der älteste Sohn Heinrichs III. aus dem Haus Anjou-Plantagenet und dessen Gemahlin Eleonore von der Provence.
↑ Portrait in der Westminster Abbey von Edward I
Leben
Werdegang
Eduard hatte acht Geschwister und wuchs unter der Obhut von Hugh Giffard und dessen Frau Sybil (eine seiner Hebammen) im Palast von Westminster in London auf. 1246 starb Giffard und Bartholomew Pecche übernahm die Erziehung. Eduard sprach wie seine Vorfahren normannisches Französisch, kein Englisch, das er sehr wohl beherrschte. Erst sein Enkel Eduard III. führte Englisch als Sprache bei Hofe ein. Wegen seiner Größe von 1,88 m trug er den populären Beinamen „Langschenkel“ („Longshanks“), aufgrund seiner grausamen militärischen Interventionen in Schottland den inoffiziellen, aber von ihm geschätzten Beinamen „Hammer der Schotten“ („Hammer of the Scots“), den er sich in Latein auf sein Grabmal schreiben ließ: „Eduardus Primus Scotorum Malleus hic est, 1308. Pactum Serva“ („Hier liegt Eduard I., Hammer der Schotten, 1308. Bleibe treu“ – Eduards Motto). Nach Ansicht von Historikern wurde diese Inschrift möglicherweise erst 250 Jahre später angebracht. Eduard wollte auch die drei Angelsachsenkönige namens Eduard in der Zählfolge berücksichtigen, also Eduard IV. heißen. Es war der einzige Königsname, der sowohl bei den angelsächsischen als auch bei den englischen Königen verwendet wurde. Aus unbekannten Gründen wurde diese Zählung nie offiziell eingeführt.
Mit 26 Jahren geriet Eduard in der Schlacht von Lewes 1265 gemeinsam mit seinem Vater und dessen Bruder Richard in die Gefangenschaft seines angeheirateten Onkels Simon V. de Montfort, der einen Adelsaufstand gegen Heinrich III. anführte. Eduard gelang jedoch bald die Flucht und durch den Sieg bei Evesham über de Montfort (1265) die Rückgewinnung der Macht für seinen Vater sowie die Stabilisierung des Königtums. In diesem Jahr erhielt er den Titel des Lord Warden of the Cinque Ports.
Kreuzzug
1269 gelang es Kardinal Ottobono, dem späteren Papst Hadrian V., Eduard von der Kreuzzugsidee zu überzeugen. Mit rund 200 Rittern beteiligte sich der Thronfolger am 7. Kreuzzug des Königs von Frankreich Ludwig IX.. Auch seine Frau Eleonore von Kastilien sowie sein Cousin Henry of Almain begleiteten den Zug. Eigentlich war Ziel des Kreuzzugs gewesen, die belagerte Stadt Akkon zu entsetzen, doch König Ludwig war vor Tunis zum Stehen gekommen und dort an einer Krankheit gestorben. Dies hielt Eduard jedoch nicht davon ab, am ursprünglichen Plan festzuhalten. So setzte er nach Palästina über, um dort mit Karl von Anjou, dem Bruder von König Ludwig IX., den Rittern von Akkon beizustehen. Zu dieser Zeit belagerten die Mamelucken die Stadt Tripoli im Libanon. Es gelang den neu angekommenen Kreuzfahrern, diese Stadt zu entsetzen. Im Anschluss versuchte Eduard den Kreuzfahrerstaat zu stabilisieren und einen Frieden mit den Mamelucken zu erreichen. Als aber die Mamelucken Attentäter, die vorgaben, sich taufen lassen zu wollen, zu Eduard sandten, brach dieser die Verhandlungen ab und begann, einen Angriff auf Jerusalem vorzubereiten. Noch während dieser Vorbereitungen starb sein Vater am 16. November 1272 und Eduard schloss Frieden mit dem Mamelucken-Sultan Baibars I. und reiste in seine Heimat zurück. Sein Weg führte über Sizilien nach Frankreich, wo er 1273 in Chalon-sur-Saône in einem Turnier gegen den Herzog von Burgund kämpfte das zu einer regelrechten Schlacht ausartete. Anschließend zog er nach Paris wo er gegenüber König Philipp III. von Frankreich für das Herzogtum Guyenne huldigte. Darauf begab er sich direkt in dieses Lehen um dessen Verwaltung zu ordnen. Erst im August 1274 erreichte der neue König England. Am 19. August wurde er von Robert Kilwardby, dem Erzbischof von Canterbury, in Westminster gekrönt.
Tod
Am 7. Juli 1307 starb Eduard im Alter von 68 Jahren. Er wurde zunächst in der Dorfkirche von Burgh by Sands beigesetzt und später - entgegen seinem Wunsche - nach Westminster Abbey, London umgebettet. Sein Grabmal ist unzerstört erhalten und kann auch heute noch besichtigt werden. Er liegt in einem Bleisarg, der nach seinem Wunsch durch einen Goldsarg zu ersetzen sei, sollte Schottland Teil des Königreiches geworden, also seine Eroberung abgeschlossen sein. Dies ist bis heute nicht geschehen, obgleich beide Länder seit 1707 ein Reich bilden.
Politische Tätigkeiten als König
Außenpolitik
Eduard I. verfolgte eine konsequente Eroberungspolitik. Sein erstes Ziel war das bislang unabhängige Wales. Während zweier Feldzüge 1277 und 1282/1283 unterwarf er das Land und besiegte gleichzeitig den Fürsten Llywelyn ap Gruffydd, der zuvor Simon V. de Montfort unterstützt hatte. Mit dem Statut von Rhuddlan gab er dem neu gewonnenen Territorium ein strenges und für die Einwohner ungewohntes, an England angelehntes Verwaltungssystem. In Irland wurde Eduard I. militärisch nicht aktiv. Eine Reform der Verwaltungsstruktur im Jahr 1285 hatte lediglich Auswirkung auf die englisch kontrollierten Gebiete um Leinster.
Das zweite wichtige Element, das Eduards Außenpolitik und die seiner Nachfolger gleichen Namens bestimmte, war der Versuch, den Vertrag von Paris aus dem Jahr 1259 mit der französischen Krone aufzulösen. Damals hatte Heinrich III. dem französischen König Erbhuldigung für Aquitanien, die Gascogne und andere Gebiete zugesichert, was eine Anerkennung französischer Lehnshoheit über einen Teil des angevinischen Reichsgebiets bedeutete. Eduard I. bemühte sich vor allem um die Herauslösung der Gascogne aus dem Lehnsverhältnis, unter anderem durch das demonstrative Verweigern der Huldigung für dieses Territorium. 1286 begann sein dreijähriger Aufenthalt in der Gascogne, in dessen Verlauf es ihm gelang, seine Herrschaft dort zu stabilisieren, vor allem dadurch, dass die Verwaltungsstrukturen mit denen Aquitaniens verwoben und ihnen angeglichen wurden. In mehreren Konstitutionen beanspruchte Eduard für sich die Funktion der höchsten Rechtsinstanz in seinen kontinentalen Territorien. Dies stand dem Anspruch des französischen Königs Philipp IV. als oberstem Lehnsherrn entgegen. Daraufhin kam es 1294 zum Kriegsausbruch zwischen Eduard und Philipp. Die Gascogne geriet vorübergehend in französische Hand. Eduards Feldzug in Frankreich schlug fehl, da zahlreiche Barone die Heerfolge und die Kirche eine finanzielle Unterstützung verweigerten. Im zweiten Vertrag von Paris 1303 erreichte Eduard I. zumindest die Rückgabe des wichtigsten Teils des Herzogtums mit den Städten Bordeaux und Bayonne.
In Schottland machte Eduard I. 1290 bis 1292 seine Macht im Zuge der nach dem Tod König Alexanders III. entstandenen Wirren geltend. Zunächst wollte er seinen Sohn, den späteren Eduard II. mit Alexanders Enkelin Margaret verheiraten. Jedoch starb sie bereits 1290. Darauf unterstützte der englische König seinen Vasallen John Balliol in einer Gruppe von dreizehn Bewerbern um die ungeklärte Thronfolge. Da England und Schottland durch den Vertrag von York aus dem Jahr 1237 territorial und politisch getrennt waren, muss dieses Vorgehen als Versuch Eduards gedeutet werden, sich in die Position eines Oberherren über Schottland zu versetzen und den schottischen König als Vasall an sich zu binden. Die Unterordnung eines Königs im Vasallenverhältnis, der auch zu persönlichen Huldigungsleistungen verpflichtet war, bedeutete eine Erhöhung der Position des englischen Königs. Eduard I. verfolgte also gegenüber Schottland die gleiche Politik, wie sie der französische König ihm gegenüber durchzusetzen versuchte. Balliol erhob sich jedoch bereits 1296 mit französischer Unterstützung. Eduard I. schlug ihn 1298 bei Dunbar, setzte ihn ab und ließ nun Schottland durch Statthalter regieren. Unterstrichen wurde dies durch die Entfernung des Krönungssteins aus der Augustinerabtei von Scone (Scone Abbey), auf deren Ruinen sich der heutige Palast von Scone befindet.[1]. Den Stein ließ er als Einsetzungsstein in den englischen Krönungsthron, den sogenannten "King Edward's Chair" in Westminster Abbey einbauen; erst nach 700 Jahren kehrte der Stein als Leihgabe nach Schottland zurück.
1296 schlug Eduard einen Aufstand in Wales nieder.
Die von den Schotten unter William Wallace und Robert Bruce entfachten Aufstände schlug er grausam nieder. Dennoch waren Eduards militärische Aktionen in Schottland nicht von Erfolg gekrönt; das Land entglitt immer mehr der englischen Kontrolle. Auf einem Feldzug gegen Robert Bruce starb Eduard I. bei Burgh by Sands nahe Carlisle.
Innenpolitik
Die folgenreichste innenpolitische Maßnahme Eduards I. war die Schaffung des Modellparlaments im Jahr 1295, das von da an regelmäßig zusammentrat und die Entwicklung des britischen Parlamentarismus maßgeblich beeinflusste. Neben geistlichen und weltlichen Lords berief Eduard auch je zwei Abgeordnete aus jeder Stadt und jeder Grafschaft in die Versammlung. Er stand in gutem Einvernehmen mit ihr und vergrößerte die Macht des Parlaments wesentlich, indem er 1297 dessen Steuerbewilligungsrecht anerkannte.
Der Sicherung der fiskalischen Grundlagen des Königtums diente auch seine Politik gegenüber der Kirche. Ab 1294 setzte er, ähnlich wie Philipp IV. in Frankreich, die Besteuerung kirchlichen Grundbesitzes durch. Darüber hinaus beanspruchte Eduard ein Kontrollrecht des Königs bei der Vergabe kirchlicher Lehen und unterband die Erhebung von Abgaben durch den Papst in seinen Territorien weitgehend. Dies brachte ihn wie auch Philipp von Frankreich in Konflikt mit Papst Bonifatius VIII.
Als Gesetzgeber machte sich Eduard I. um Handel und Münzwesen, vor allem aber um das Rechtswesen verdient. Im Gegensatz zur schwachen Herrschaft seines Vaters gab er eine Vielzahl von Erlassen und Gesetzen heraus, wobei er sich auf einen loyalen und leistungsfähigen Beraterstab aus Klerikern, Adligen und, vor allem am Ende seiner Herrschaft, ausgebildeten Juristen stützen konnte. Damit einher ging eine Verschriftlichung des Rechtswesens, das sich bis dahin vor allem auf mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht berufen hatte. Mit den Statuten „De Donis“ (1285) und „Quia Emptores“ (1290) stellte er ein verbindliches Grundstücksrecht auf. Zudem schränkte er damit die Entstehung von Afterlehen bei Bodenverkäufen ein, was die Stellung des Königs und des Hochadels im Lehnssystem stärkte, den Landadel aber schwächte. Mit dem „Statute of Mortmain“ von 1275 schrieb Eduard für die Übertragung von Grundbesitz an die Kirche die königliche Zustimmung vor. Der Erlass „Circumspecte Agatis“ von 1286 beschränkte die Kirchengerichtsbarkeit weitgehend auf kirchliche Angelegenheiten. „Quo Warranto“ sollte 1275 auch die Gerichtsbarkeit der Magnaten einschränken, wurde aber nur ansatzweise durchgesetzt. Die zahlreichen Statuten, die Grundlagen für die spätere juristische und Verwaltungsstruktur Englands schufen, waren möglicherweise wichtiger als seine meist erfolglosen militärischen Unternehmungen.
Das „Statutem de Iudaismo“ von 1275 sollte den Geldverleih einschränken, zugleich den Juden aber Zugang zu anderen Berufszweigen wie Handwerk und Landwirtschaft eröffnen. Dagegen richtete sich sowohl das Parlament als auch der Klerus. Nach einer Papstbulle von 1286, die auf die strikte Trennung zwischen Christen und Juden bestand, ging Eduard hart gegen sie vor. Der König zwang die Juden, erkennbare gelbe Zeichen an der äußeren Kleidung zu tragen und ließ die Familienoberhäupter festsetzten, von denen einige hingerichtet wurden. 1290 formulierte er das Ausweisungsedikt, das alle Juden zum Verlassen des Landes zwang. 1303 eröffnete er ausländischen Kaufleuten mit der „Carta Mercatoria“ Privilegien und erhöhte zugleich die Zölle, um die Kroneinnahmen zu steigern.
Heeresreform
Eduard I. war der erste, der eine stärkere Rolle der Infanterie in einer neuen Kriegsführung anstrebte. Er erkannte, dass Bergbevölkerungen wie in Wales nicht mit kurz dienenden Kavallerieverbänden zu schlagen waren. Er führte daher wichtige Neuerungen ein, die lange Zeit beibehalten wurden: Er stellte ein das ganze Jahr dienendes Berufsheer auf. Um das Rekrutierungsproblem zu lösen, ermöglichte Eduard I. ein Verfahren, mit dem sich viele seiner Vasallen vom Kriegsdienst freikaufen konnten, genannt Scutage. Die anderen forderte er auf, weniger, aber besser ausgerüstete Truppen zur Verfügung zu stellen und nach Ableistung der Dienstpflicht weiter zu bezahlen. Ein solcher Militärdienstzeitvertrag – Vorläufer der „Indentur“ – wurde erstmals 1277 geschlossen. Diese Verträge waren schriftliche Abmachungen zwischen einem Berufsoffizier – auch Adeligen – und dem König. Sie bestimmten unter anderem Stärke und Zusammensetzung der zur Verfügung gestellten Truppen, ihren Standort, die Dauer und Art ihrer Dienste, die Höhe ihres Lohns, der Sondervergütungen. Diese Verbände setzten sich gewöhnlich aus allen Waffengattungen zusammen, wie Artillerietechnikern, Ärzten, Mineuren, Fußsoldaten, Feldgeistlichen, Dolmetschern, Bogenschützen und gewappneten schweren Reitern. Die Dauer der Dienstzeit schwankt zwischen vierzig Tagen und einer unbestimmten, „in Belieben des Königs“ gestellten Zeit. Eine weitere, von Eduard I. eingeführte Neuerung, war der Langbogen als Hauptwaffe. Mit dieser Waffe ließ sich mit einer gewissen Übung ein gezielter Schuss bis auf 240 Meter abgeben, die äußerste Reichweite betrug etwa 350 Meter. In den Feldzügen gegen Wales erkannte man erstmals den taktischen Wert des Langbogens. Durch einen Pfeilregen ließ sich der Feind zu Beginn einer Schlacht schwächen, und seine Verbände verloren ihren Zusammenhalt. Beim Angriff gaben die Bogenschützen den eigenen Truppen Feuerschutz.
Historische Bedeutung
Zahlreiche Historiker gehen davon aus, dass mit Eduard I. ein Prozess einsetzte, in dessen Verlauf sich die ehemals normannischen Plantagenets verstärkt als englische Könige und weniger als Herrscher eines Reichs verstanden, dessen wichtigste Territorien auf dem europäischen Festland lagen. Parallel dazu lässt sich auch in der englischen Bevölkerung in seiner Epoche ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl ausmachen, sowohl in der Abgrenzung gegen benachbarte Völker (vor allem gegen die Schotten) als auch in der immer manifester werdenden Verschmelzung zwischen Normannen und Angelsachsen.
Ehen und Kinder
In erster Ehe heiratete er Eleonore von Kastilien, Tochter des kastilischen Königs Ferdinand III., mit der er die folgenden Kinder hatte:
- namenlose Tochter (*/† 1255, begraben in Bordeaux)
- Katherine (*/† 1264)
- Joan (*/† 1265, begraben in Westminster Abbey vor dem 7. September 1265)
- John (* 10. Juli 1266; † 1. August 1272)
- Henry (1267–1274)
- Eleanor (1269–1298)
- Juliana (Katherine) (* 1271; † 5. September 1274)
- Joan of Acre (*1272; † 23. April 1307)
- ∞ 1290 mit Gilbert de Clare, 6. Earl of Hertford, 3. Earl of Gloucester († 1295)
- ∞ 1297 mit Ralph de Monthermer
- Alphonso (1273–1284)
- Margaret (11. September 1275–1333)
- Berengaria (1276–1279)
- Mary (11. März 1278–8. Juli 1322)
- Isabella (* 1279)
- Alice (* 12. März 1279)
- Elizabeth (7. August 1282–5. Mai 1316)
- Eduard (1284–1327)
- Beatrice (* 1286) und
- Blanche (* 1290)
Sie starb an einer Blutvergiftung, nachdem sie den Eiter einer Wunde ihres Mannes ausgesaugt hatte.
In zweiter Ehe vermählte er sich 1299 mit Margarethe von Frankreich, die ihm die folgenden Kinder gebar:
- Thomas (1. Juni 1300–August 1338)
- Edmund (5. August 1303–19. März 1330) und
- Eleonore (4. Mai 1306–1322)
Einzelnachweise
↑ Peter Sager: Schottland. 2. Aufl., 1980, S. 235 f.
Literatur
Dieter Berg: Die Anjou-Plantagenets. Stuttgart u.a. 2003, S. 155 ff.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Heinrich II. (Mecklenburg)
Heinrich II., Fürst zu Mecklenburg, genannt der Löwe (* (nach 14.4.) 1266; † 21. Januar 1329 in Sternberg) war von 1287 bis 1298 Regent, von 1298 bis 1302 Mitregent und von 1302 bis 1329 alleiniger Fürst von Mecklenburg.
Er war Sohn Heinrichs I. und regierte 1287–1289 gemeinsam mit seinem Bruder Johann III. (Mecklenburg). Zuvor (seit dem Jahr 1275) übte seine Mutter Anastasia mit seinen Onkel Nikolaus III. (bis 1290) und Johann II. (bis 1283) die Regentschaft aus. Er war 1298–1301 Mitregent seines Vaters und folgte diesem nach dessen Gefangennahme und spätestens nach dessen Tod 1302 in der Regierung.
Am Anfang seiner Regierungszeit führte er erfolglos Krieg gegen Nikolaus II. von Werle um die Erbfolge von Heinrich I. von Werle. Nach dem Tod der Söhne (um 1299) seines Schwiegervaters Albrecht III. schenkte dieser ihm (durch Scheinkauf) die Herrschaft Stargard. Dieses war als schon 1292 als Wittum durch Heinrichs Frau Beatrix mit in die Ehe gebracht worden. Durch den Wittmannsdorfer Vertrag im Jahre 1304 wurde dies nach dem Tod Albrechts endgültig festgeschrieben.
Im Jahr 1299 versuchte er in einem ersten Versuch, im Bündnis mit dem Markgrafen von Brandenburg und Nikolaus II. von Werle das Fürstentum Rostock zu erobern. Dessen Fürst Nikolaus I. von Rostock stellte sein Land im Jahr 1300 unter Schutz und die Lehensherrschaft des Königs Erich von Dänemark. Diesem unterlag Heinrich und der dänische König wurde selbst Besitzer der Herrschaft Rostock. Im Jahr 1304 kam Heinrich II. zusammen mit dem Markgrafen von Brandenburg dem böhmischen König Wenzel III. von Böhmen im Krieg gegen König Albrecht I. zu Hilfe. Dieser Krieg brachte Heinrich II. den Beinamen der Löwe. 1310 folgte der Krieg gegen die Hansestädte Wismar und Rostock. Auslöser war die Weigerung Wismars, die Hochzeit seiner Tochter Mechthild mit dem Herzog Otto zu Braunschweig-Lüneburg in der Stadt durchzuführen. Die Hochzeit ließ er daraufhin in Sternberg durchführen. Heinrich II. wählte die Stadt danach zu seiner Residenz. Schon 1311 unterwarf sich Wismar und Heinrich II. zog gegen Rostock. Am 15. Dezember 1312 wurde Rostock nach heftiger Gegenwehr eingenommen. Bei Heinrichs Pilgerzug 1313 nach Madonna della Rocca erhob sich Rostock, wurde aber am 12. Januar 1314 schnell eingenommen. 1315 kämpfte Heinrich II. im sogenannten Markgrafenkrieg gegen die Stadt Stralsund und gegen den brandenburgischen Markgrafen Waldemar, welcher in das Land Stargard eingefallen war. Die Belagerung Stralsunds musste Heinrich II. im Juli 1316 erfolglos aufgeben, konnte aber Waldemar bei Gransee besiegen und bekam mit dem Templiner Frieden vom 25. November 1317 die Herrschaft Stargard endgültig zugesprochen. Im Jahr 1319 kämpfte er zusammen mit Grafen Gerhard von Holstein erfolglos gegen die Dithmarscher. Diese siegten in der Schlacht von Wöhrden, aus der Heinrich II. nur mit Mühe entkam. Nach dem Tod des brandenburgischen Markgrafen Waldemar eroberte er die Prignitz und die Uckermark. Nach einem erneuten Krieg gegen Rostock, gelang es ihm mit den dänischen König Christoph II. am 21. Mai 1323 Frieden zu schließen. Er erhielt die Herrschaften Rostock, Gnoien und Schwaan als erbliche Lehen von Dänemark. Im Krieg gegen den neuen brandenburgischen Markgrafen Ludwig I. (unter Vormundschaft des Graf Berthold von Henneberg) verlor er seine Eroberungen in der Uckermark und in der Prignitz und musste am 24. Mai 1325 gegen Abfindung Frieden schließen. Auch der Rügische Erbfolgekrieg nach dem Tod des letzten Rüganer Fürsten Wizlaw am 10. November 1325 endete nach hartem Kampf im Frieden zu Brudersdorf am 27. Juni 1328 nur mit einer Geldentschädigung. Am 21. Januar 1329 starb Heinrich II.
Er war in erster Ehe mit Beatrix von Brandenburg († vor 25. September 1314), Tochter von Albrecht III. von Brandenburg, in zweiter Ehe nach dem 6. Juli 1315 mit Anna zu Sachsen-Wittenberg († zw. 25. Juni 1327 und dem 9. August 1328), Tochter des Herzogs Albrecht zu Sachsen-Wittenberg und in dritter Ehe mit Agnes, Tochter des Grafen Günther von Lindow-Ruppin († nach dem 30. Juli 1343) verheiratet.
Kinder
mit Beatrix:
- Mechthild (1293-1357) ∞ seit 1311 Herzog Otto zu Braunschweig-Lüneburg
mit Anna zu Sachsen-Wittenberg:
- Heinrich (1316-1321)
- Anastasia (1317-1321)
- Albrecht II., genannt Der Große, Herr zu Mecklenburg, und ab 1348 erster Herzog zu Mecklenburg
- Agnes (1320-1340) ∞ 6. Januar 1338 mit Nikolaus III. von Werle-Güstrow
- Johann I. (IV.), Herr zu Mecklenburg, 1348 Herzog zu Mecklenburg-Stargard (1329–1392)
- Beatrix von Mecklenburg-Schwerin, (1324-5. August 1399) Äbtissin im Kloster Ribnitz (1348-1395)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Erik Magnusson - Erik II. (Norwegen)
Er war der älteste Sohn von König Magnus VI. lagabøte und von Ingeborg von Dänemark (Tochter von König Erik IV.). Er wurde am 2. Juli 1280 in Bergen gekrönt.
Er kam in Konflikt mit der Kirche und erhielt den Beinamen prestehater (= Priesterfeind). Der war allerdings bereits entstanden, als er noch unter der Vormundschaft der norwegischen Aristokraten stand, die mit aller Macht versuchten, den Einfluss der Kirche zurückzudrängen und ihre Privilegien entscheidend zu beschneiden.
1281 heiratete er Margarete, die Tochter König Alexanders III. von Schottland und dessen Frau Margarete von England. Sie starb 1283 im Kindbett. Im selben Jahr hatte er zwei Reiter-Unglücke, bei denen er sich einen dauerhaften Hirnschaden und eine Gehbehinderung zuzog. Er hinkte seitdem. In zweiter Ehe heiratete er 1293 Isabel Bruce, die Tochter von Lord Robert V. Bruce und Schwester von König Robert the Bruce von Schottland.
Erik starb 1299 ohne männliche Erben. Seine Kinder waren aus 1. Ehe Margarete (1283 – September 1290) und aus 2. Ehe Ingeborg (* 1297; † nach 1353), die am 29. November 1312 Waldemar Folkung, Herzog von Finnland, heiratete.
Ergänzungsartikel aus Wikipedia, übernommen aus ,,Geschichte Norwegens”:
Erik Magnusson
Erik Magnusson übernahm die Königswürde mit zwölf Jahren. Er stand daher unter der Vormundschaft des Reichsrates. Dieser nahm den Konfrontationskurs seines Großvaters gegen die Kirche und dessen aggressive Außenpolitik wieder auf. Diese Politik richtete sich gegen Dänemark und die Hanse. Nur zu England und Schottland blieben die Beziehungen gut. Die Verbindung mit Schottland wurde durch die Ehe mit der sieben Jahre älteren Königstochter Margarete im Jahre 1281 gefestigt. Sie brachte eine Mitgift von 14 000 Mark Silber mit in die Ehe. Darüber hinaus wurden die schottischen Zahlungen für die Insel Man und die Hebriden wieder aufgenommen.
1280 kam es zu erneuten schweren Konflikten zwischen Reichsrat und Kirche, die dazu führten, dass 1282 Erzbischof Jon Raude zusammen mit den Bischöfen von Oslo und Hamar das Reich verlassen mussten. Er starb im gleichen Jahr in in Schweden. Danach kam es zu einem Vergleich mit der Kirche.
Die Politik gegen die Hanse führte zu einer Sperrung des Øresunds. Dies zwang zu Verhandlungen, die 1285 zu dem Schiedsspruch von Kalmar durch König führten, wonach Norwegen 6 000 Silber zu zahlen und die Handelsprivilegien wieder zu gewähren hatte. Das führte in der Folgezeit praktisch zu einem Staatsbankrott. Der Hanse blieb aber der Handel ins Hinterland und die Handelsfahrt nördlich von Bergen nach wie vor verboten. Das war ein Separatfrieden zwischen Norwegen und den norddeutschen Städten, in den Dänemark nicht einbezogen war. Der Reichsrat konnte daher seine antidänische Politik fortsetzen. Als Grundlage wurde der Erbanspruch von Ingeborg, der Frau von König und Tochter des dänischen Königs herangezogen. Nach dem Mord an wurde die dänische Adelsopposition der Täterschaft beschuldigt und pauschal in die Verbannung geschickt. Sie kam nach Norwegen. An ihrer Spitze standen Graf Jakob von Nord-. Es war immer wieder das Ziel norwegischer Politik gewesen, Halland zu gewinnen. 1289 begann der Krieg mit einem großen Flottenaufgebot nach Dänemark. 1290 kam es zu einem zweiten Heereszug und zur Bildung befestigter Brückenköpfe in Halland, was die Kontrolle über den Øresund ermöglichte. Daneben unterstützte Norwegen die Opposition gegen . Nach den nächsten Kriegszügen 1293 und 1295 bot König Erik von Dänemark Vergleichsverhandlungen an, die im Herbst 1295 mit einem Waffenstillstand in Hindsgavl auf Fünen endeten. König Erik von Norwegen und sein Bruder erhielten freie Verfügungsgewalt über die in Dänemark von der Mutter geerbten Güter, und die Verbannten erhielten ihren Besitz wieder. Der Waffenstillstand wurde später erneuert und währte bis in die Regierungszeit . Die ständigen Rüstungsanstrengungen überstrapazierten den norwegischen Haushalt und die Einnahmen, so dass 1285 akuter Geldmangel eintrat.
Am 13. Juli 1299 starb König Erik und sein Bruder Håkon trat am 10. August die Nachfolge an.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Erik VI. (Dänemark)
Erich VI. Menved (dän. Erik VI. Menved; * 1274; † 13. November 1319) war ein Sohn von Erich V. und von 1286 bis 1319 König von Dänemark.
Leben
Seine Eltern waren König Erik V. Klipping und Agnes von Brandenburg. Er folgte seinem 1286 ermordeten Vater als Minderjähriger auf dem Thron. Kurzzeitig war Waldemar IV. von Schleswig Reichsverweser des jungen Königs, dem der Herzog seine Freiheit verdankte. Bis 1294 regierte seine Mutter für ihn. Der Beiname "Menved" soll seiner bevorzugten Eidesformel “ved alle hellige mænd” - "bei allen heiligen Männern" entstammen.
1296 heiratete Erik Ingeborg Magnusdottir, die Tochter König Magnus Ladulås von Schweden. Erik VI. sah sich in der Tradition König Waldemars II. und legitimierte seine expansionistische Politik im südlichen Ostseeraum durch eine von König Albrecht I. bestätigte Urkunde aus der Kanzlei Kaiser Friedrichs II., die den Dänenkönigen jene Herrschaft nördlich von Elbe und Elde zugestand, stürzte Dänemark dadurch jedoch in ein finanzielles Fiasko. Seine Herrschaft war geprägt von einer starken innerdänischen Opposition und Adelsrevolten, die sich in der Person Jens Grand, dem Erzbischof von Lund, manifestierten. Auch die schwedische Politik, die Auseinandersetzungen zwischen König Birger Magnusson, der die Schwester von Erik VI. ehelichte, und dessen Brüdern Erik und Waldemar, brachte ihn in militärische Konflikte.
Beziehungen zu den Hansestädten im südlichen Ostseeraum
Erik verfolgte eine dänische Hegemonialpolitik im pommerschen Gebiet. So versuchte er den aufstrebenden Hansestädten territorialstaatliche Gewalt entgegenzusetzen, ihre Privilegien zu beschneiden und gleichwohl schwedisch-norwegische Söldnerwerbungen dort zu unterbinden.
Beziehung zu Lübeck
Er erwarb zeitweilig die Schutzherrschaft über Lübeck (1307 - 1319), da das dortige Patriziat einen Konflikt mit den Holstenfürsten erwartete. Der Dänenkönig war bei schwacher Königsherrschaft im Spätmittelalter ein starker Bundesgenosse, sodass ihm das Amt eines Schirmvogts zu Lübeck angetragen worden ist. Das Beistandsbündnis der Hansestädte von 1308 unterzeichnete Lübeck aber nur unter der Vorgabe, in keine Auseinandersetzung mit Erik zu geraten.
Episode vor Rostock
Erik, der seit 1300 de facto "Oberlehnsherr" über Rostock war, wollte 1311 ein großes Fest dort ausrichten. Es sollte eine Präsentation höfisch-feudalen Selbstverständnisses werden. Bedeutende Gestalten der damaligen dichterischen Elite wie Heinrich Frauenlob von Meißen waren anwesend, um die Ereignisse im Juni festzuhalten. Die Stadt öffnete dem riesigen Aufgebot jedoch nicht ihre Tore, weil sie vermutete, Erik von Dänemark wolle seine Position als Schutzherr von Rostock weiter ausbauen. Jenes ritterliche Fest musste nun vor dessen Toren gefeiert werden. Von diesem Ereignis schwer beleidigt, erklärte der Erik der Stadt den Krieg. Ein erster Bund der Hansestädte lag nun im Kampfe mit einer Koalition von Reichsgrafen, zu denen die Markgrafen zu Brandenburg, sowie der Feldherr Heinrich II. von Mecklenburg, der als Stadthauptmann zu Rostock von Erik eingesetzt worden war, gehörten. Diese Episode brachte das einst unmittelbare Fürstentum Rostock als Lehen unter die Gewalt des expandierenden Mecklenburgs.
Stralsund und der Konflikt mit dem Markgrafen von Brandenburg
Da Stralsund mit den Rügenfürsten verbunden war, die ihrerseits in Lehnsabhängigkeit zu Dänemark standen, führten dortige Aufstände zu weiteren militärischen Aktionen Eriks im Alten Reich. Dadurch geriet er in einen Konflikt (Markgrafenkrieg) zu dem brandenburgischen Markgrafen Woldemar, der stets darauf bedacht war, der Markgrafschaft einen Weg zum Meer zu erschließen. Mit Hilfe des von ihm zum Marschall ernannten mecklenburgischen Grafen Heinrich dem Löwen und anderen Herrschern versuchte Erik VI. seine Politik zu verwirklichen. Dieser Krieg der Jahre 1316/17 war der größte, den das ehemalige Obodritenland bis dato gesehen hatte, mündete in der Schlacht von Gransee und brachte schließlich wenig Veränderungen im Status Quo. Der Chronist Ernst von Kirchberg, im Auftrag Herzog Albrechts III. von Mecklenburg stehend, beschreibt diese Vorgänge eindrucksvoll in einer Reimchronik.
Erik erwies sich somit als einer der letzten Herrscher, die Dänemark als Großmacht etablieren wollten.
Literatur
- Ingvor Margaretha Andersson: König Erich Menved und Lübeck. In: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. 39, 1959, S.69- 116.
- Erich Hoffmann: König Erik Menved und Mecklenburg. In: Tillmann Schmidt, und Helge Wieden (Hrsg.): Mecklenburg und seine Nachbarn. Rostock 1997, S. 43- 68. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Mecklenburg: Reihe B, Schriften zur Mecklenburgischen Geschichte, Kultur und Landeskunde)
- Werner Knoch: Wismar, Rostock und Heinrich II. von Mecklenburg 1310/4 nach der Reimchronik Ernst von Kirchbergs (1378). In: Hansische Geschichtsblätter 110, 1992, S. 43- 56.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Waldemar IV. (Dänemark)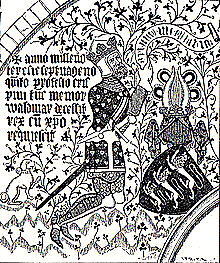
Waldemar IV. Atterdag (* um 1321; † 24. Oktober 1375 auf Schloss Gurre) war zwischen 1340 und 1375 König von Dänemark.
Sein Beiname „Atterdag“ bedeutet auf Dänisch wörtlich „neuer Tag“, kann aber auch mit dem niederdeutschen „ter tage“ erklärt werden, was sinngemäß übersetzt wird mit „In welchen Zeiten leben wir!“.
Waldemar Atterdag ist der Vater der dänischen Königin Margrete I. von Dänemark.
Leben
Waldemar war der jüngste Sohn des Königs Christoph II. von Dänemark und der Euphemia von Pommern-Wolgast, Tochter von Herzog Bogislaw IV. Von 1326 bis 1338 wurde er am Hof des römisch-deutschen Kaisers Ludwig des Bayern erzogen. 1340 wurde er dänischer König. 1347 wurde Waldemar Atterdag auf einer Pilgerfahrt nach Jerusalem von Markgraf Ludwig von Brandenburg zum Ritter geschlagen. In die Lebenszeit Waldemar Atterdags fällt der erste Ausbruch der Pest in Europa, 1348 - 1350, der auch in Nordeuropa viele Menschen zum Opfer fielen. Waldemar Atterdag starb im Jahre 1375. Sein Leichnam wurde zunächst in Vordingborg bestattet und 1377 in die Klosterkirche von Sorø überführt.
Politik Waldemars
Zur Zeit der Mündigkeit Waldemars um das Jahr 1336 gab es in Dänemark keine zentrale Regierung, und die Herrschaft über die verpfändeten Provinzen wurde von den Pfandherren, teilweise von Unterpfandherren ausgeübt. Zuvor war bereits im Jahre 1334 ein Aufstand seines älteren Bruders gescheitert. Daraufhin wurde durch Kaiser Ludwig den Bayern eine Vermittlung zwischen Waldemar und dem Grafen von Holstein Gerhard III. ermöglicht. Als Vermittler stellte sich der gleichnamige Sohn des Kaisers zur Verfügung. Die Machtübernahme in Dänemark konnte allerdings erst nach dem Tod des Grafen erfolgen, da dieser seinen Neffen als Waldemar 3. auf den Thron gesetzt hatte und damit faktisch der Statthalter Dänemarks war.
Nach der Ermordung Gerhards wurde Waldemar 1340 zum dänischen König gewählt. Sein Machtbereich war allerdings sehr eingeschränkt, da er nur den nördlichen Teil Jütlands umfasste. Der Teil Jütlands nördlich der Königsau war an den ehemaligen König Waldemar III. verpfändet, während Schleswig den Grafen von Holstein verpfändet war. Schonen war von seinem Pfandherren an König Magnus Eriksson verkauft worden. Waldemar IV. wurde als König von Dänemark anerkannt und hatte das Recht, die verpfändeten Ländereien wieder einzulösen.
Waldemar begann mit der Einlösung Seelands, wobei ihm der Bischof von Roskilde wichtige Dienste leistete. Überhaupt verstand er es, die Kirche zu seinem wichtigsten Verbündeten zu machen. Kopenhagen wurde ihm zur Verfügung gestellt und in den kommenden Jahren erwarb Waldemar eine Burg nach der anderen durch Eroberung oder durch Einlösung des Pfandes. Dabei setzte er bevorzugt Chorherren zu Schlossvögten ein. Mittel für seine weiteren Expansionen gewann Waldemar aus den Einkünften der eingelösten Burgen, durch Steuern sowie durch den Verkauf von Kronrechten in Estland, das er an den Deutschen Orden verkaufte. Auch die Wittelsbacher waren wichtige Geldgeber.[1] Von 1349-1354 beteiligte er sich auf deren Seite an mehreren Feldzügen in Deutschland. Im Einvernehmen mit dem Papst konnte er sogar die dänische Kirche besteuern. Gleichzeitig gelang es ihm, seine Gefolgsleute in den verschiedenen Domkapiteln unterzubringen, die er dann mit kirchlichen Pfründen versorgen konnte. So gewann der dänische König in Zusammenarbeit mit dem Papst in Avignon erstmals die volle Kontrolle über die dänischen Bischofsstühle. Als er starb, waren fast alle Bischofsstühle mit Anhängern Waldemars besetzt.
Bis 1349 hatte Waldemar die königliche Herrschaft über die seeländische Inselgruppe, über den größten Teil Jütlands und einen Teil Fünens wieder hergestellt. Während der 1350er Jahre gelang es ihm, auch die restlichen Provinzen zurückzugewinnen, 1358 eroberte er Schloss Nordborg auf Alsen. 1359 überstand Atterdag einen Adelsaufstand unter der Führung von Niels Bugge. Nach der Aussöhnung zwischen Regierung und Opposition im Landfrieden von 1360 eroberte Waldemar Schonen und im darauffolgenden Jahr die Hansestadt Visby auf Gotland, woraufhin er sich auch den Titel „Herr der Gotländer“ zulegte.
Seine Expansionspolitik rief jedoch die wendischen Hansestädte auf den Plan. Im Ersten Krieg zwischen Hanse und Dänemark, in dem es um die Herrschaft über Schonen und den schonischen Markt ging, konnte sich Waldemar erfolgreich behaupten, unterlag jedoch im zweiten Krieg von 1368 bis 1370. In diesen war zunächst auch Norwegen unter Haakon VI. einbezogen, der aber wegen einer Seeblockade rasch einen Separatfrieden schließen musste. Der Krieg wurde von der Kölner Konföderation von 1367, nämlich der Hanse, dem Herzog Albrecht von Mecklenburg und den holsteinischen Grafen mit dem Ziel geführt, die alten Handelsprivilegien garantiert und die Kontrolle über den Øresund zu bekommen. Die Kriegsführung überließ Waldemar seinem Gefolgsmann Henning Podebusk; er selbst unternahm zu dieser Zeit eine Europareise, wohl um weitere Verbündete zu finden. Die Mecklenburger und Holsteiner planten eine vollständige Aufteilung Dänemarks: Herzog Albrecht sollte Sjælland, Møn und Falster erhalten, dessen Sohn, König Albrecht von Schweden, sollte Skåne und Gotland und die holsteinischen Grafen Jylland, Fyn und Langeland bekommen. Da Herzog Albrecht nicht genügend Streitkräfte besaß, holte er Seeräuber zu Hilfe. Die Hansestädte unter Führung Lübecks erreichten 1370 den für sie günstigen Separatfrieden von Stralsund. Sie erhielten die Festungen Helsingborg, Malmö, Skanør und Falsterbo für 15 Jahre, auszulösen gegen 12.000 Mark reinen Silbers. Damit kam der Zoll am Øresund von Dänemark in die Kasse der Hanse. Außerdem durfte der dänische Reichsrat künftig keinen König ohne vorherige Zustimmung der Hanse wählen. Herzog Albrecht fühlte sich übergangen und schloss im Jahr darauf ebenfalls einen Separatfrieden mit Dänemark. Darin wurde bestimmt, dass sein Enkel Albrecht nach Waldemar Atterdag dänischer König werden sollte.
Während der letzten Jahre seiner Regierung war Waldemar bestrebt, die Herrschaft über Schleswig zu gewinnen. Bevor er diese Pläne jedoch verwirklichen konnte, starb er im Jahr 1375.
Waldemar sorgte für gute Beziehungen zum Papst, den er 1364 besuchte, zum jeweiligen Kaiser, also zu Ludwig dem Bayern als auch zu Karl IV., und zu Mecklenburg, das ihm ein wertvoller Verbündeter gegen Schweden und die Grafen von Holstein sein konnte.
Im Inneren seines Reiches war Waldemar bemüht, vakante Ämter in der Kirche mit loyalen Personen zu besetzen sowie die Einkünfte, vor allem durch eine rigorose Steuerpolitik, zu mehren.
Waldemar IV. war einer der bedeutendsten mittelalterlichen Könige Dänemarks. Die Quellen erwecken den Eindruck eines intelligenten, zynischen, ruchlosen und klugen Herrschers mit einem sicheren Instinkt für Politik und Wirtschaft, wie er über hundert Jahre später von Niccolò Machiavelli propagiert wurde. Sein Nachfolger war sein Enkel Oluf III. von Dänemark, der Sohn seiner Tochter Margret und Haakons IV. von Norwegen, des Sohnes von Magnus II. von Schweden.
Viele Sagen und Geschichten ranken sich um den König; er ist Held der örtlichen Legende vom „Wilden Jäger“. Eine berühmte Sage über seine Mätresse Tove, die auf Betreiben der Königin ermordet wurden, inspirierte viele romantische Gedichte. Ursprünglich scheint allerdings sein Ahne Waldemar I. Held der Sage gewesen zu sein.
Nachkommen
- Christoffer, (* 1341; † 11. Juni 1363). Genannt "Junker Christoffer". Begraben in der Domkirche von Roskilde.
- Margrethe, (* 1345; † 1350) ∞? Heinrich von Mecklenburg.
- Ingeborg, (* 1. April 1347; ca 1370) ∞ 1362 Heinrich von Mecklenburg. Ingeborg war die Großmutter mütterlicherseits von Erich von Pommern.
- Katrine, (* 1349). Starb als Kind.
- Valdemar, (* 1350). Starb als Kind.
- Margrete, (* 1353), später Königin Margrete I. von Dänemark
Fußnoten
- ↑ Sven Tägil
Literatur
- Sven Tägil: Valdemar Atterdag och Europa. Lund 1962.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann Wittenborg
Johann Wittenborg (* um 1321 in Lübeck; † zwischen dem 15. August und dem 21. September 1363 ebenda) war ein Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.
Leben
Wittenburg war Sohn eines Lübecker Bürgers und heiratete in die Lübecker Ratsfamilie von Bardewik ein. Aus seiner ersten Zeit wird von Reisen nach Flandern (wohl Brügge) und England berichtet. Als Kaufmann handelte er vom Baltikum bis nach London und Flandern Tuche, Getreide und Pelze. Seine Geschäfte sind durch ein überliefertes Rechungsbuch der Jahre 1346-59 dokumentiert, das bereits von seinem Vater, dem Kaufmann Hermann Wittenborg, begonnen wurde. Dem Rat der Stadt gehörte Johann Wittenborg etwa seit 1350 an. Er vertrat Lübeck auf den Hansetagen in Rostock (1358) und zumindest seit 1359 als Bürgermeister der Stadt in Greifswald (1361). Dort wurde ihm nach der Eroberung Visbys durch die Dänen (1360) der Oberbefehl über die Flotte der hanseatischen Seemacht im Krieg gegen König Waldemar IV. von Dänemark übertragen. Diese kehrte 1362 erfolglos und schwer dezimiert nach der Belagerung Helsingborgs vom Öresund in die Heimathäfen zurück. Wittenborg hatte den Fehler begangen, für die Belagerung zu viele Mannschaften an Land zu setzen, so dass seine Schiffe für die Dänen leichte Beute wurden. Zwölf Koggen gingen der Hanseflotte so verloren. Wittenborg wurde bei seiner Rückkehr nach Lübeck seiner Ämter enthoben und ins Gefängnis gesetzt. Der Hansetag im Januar 1363 in Stralsund zog ihn zur Rechenschaft; er hatte zwar Fürsprecher, wurde aber dennoch wegen der erlittenen Niederlage und „propter alias causa quas cum eo specialiter haberet (civitas)“ zum Tode verurteilt (vgl. Fehling, Ratslinie). Die Hinrichtung fand im August/September 1363 auf dem Lübecker Markt durch Enthaupten statt. Sein Testament findet sich bei Carl Wilhelm Pauli in Band 3 der Abhandlungen aus dem Lübischen Recht (1841), S. 357 ff.
Der fast verlorene Krieg der Hanse wurde durch den Frieden von Vordingborg (1365) beendet.
Literatur
- Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie, 1925 Nr. 366
- Philippe Dollinger: Die Hanse, S. 223 ff, ISBN 3-520-37102-2
- A. Bruns (Hrsg.): Lübecker Lebensläufe, 1993, ISBN 3-529-02729-4
- Paul Hasse: Wittenborg, Johann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43. Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 609 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Ergänzungsartikel I aus ,,Wikisource” zu Johann Wittenborg:
Dâr danßt Bornholm hen
70. Dâr danßt Bornholm hen.
Anno 1362 mußten die Seestädte, unter denen Lübeck die vornehmste war, dem König von Dänemark einen öffentlichen Krieg anbieten, darum daß er den unschuldigen Kauf- und Handelsleuten in seinem Reich eine Schatzung über die andere auflegte. Sie rüsteten also eine große Flotte aus, setzten den Lübschen Burgemeister Johann Wittenberg als Admiral darauf, und ließen die Schiffe nach Dänemark laufen.
Der König aber hatte den Städten auf ihre Absage – es waren ihrer 77 – zurückgeschrieben:
- Söven und söventich hense,
- Söven und söventich gense.
- Biten mi nich de gense
- Frâg ik’n Sch–t na de hense.
Auch war er nicht faul zur See, sondern setzte sein Volk gleichfalls zu Schiffe und verordnete seinen Sohn Christoffer zum Obersten darüber. Bald trafen sie auch auf einander und stritten mannlich zu beiden Seiten; und hätte sich der Streit leicht etwas länger verzogen, wenn nicht des Königs Sohn durch einen Stein aus dem Rohr erschossen wäre. Auf diesen Schaden wandten sich seine Schiffe und liefen davon.
Die Hanseaten aber waren damit nicht ersättigt, daß [132] sie die Feinde zur Flucht gebracht; sondern sie wollten auch noch Beute davon haben. Liefen deßhalb vor Kopenhagen und stiegen an’s Land; aber der König, der wohl sah, daß er sich nicht halten konnte, dachte auf eine List. Er ließ einen Waffenstillstand und Frieden anbieten, und während der Admiral Herr Johann Wittenberg Verordnete nach Lübeck abfertigte, lud er die Officiere auf sein Schloß zu seiner Königin Geburtstag. Da kamen denn auch alle, sonderlich Herr Johann Wittenborg, als der Städte Admiral, höchlich ausstaffieret; und der König empfing sie ganz herrlich. Da aber, nach Gewohnheit, Herr Johann die Königin um einen Tanz bittet, sagt sie in Züchten: es werde sich nicht wohl geziemen, vor allem Volk mit ihrer Feinde Obersten zu tanzen; dennoch könne sie es wohl zugeben, wofern er zuvor durch ein Zeichen seine Freundschaft kund thäte. Begehrt er zu wissen, was das sein möchte; spricht sie mit Hulden: „die Insel Bornholm.“ Da ist Herr Johann von der Königin so entzündet, daß er’s ihr zusagt; worauf sie den ganzen Abend mit ihm allein und niemand anders tanzt. Die Lübschen aber, da sie das sahen, sprachen mit einander: „Dâr danßt Bornholm hen!“ Des andern Morgens in der Frühe haben sie ihre Schiffe ausgereidet und sind nach Lübeck gefahren; die Dänen aber haben Bornholm eingenommen, und dem Kaufmann noch mehr Schaden gethan, denn zuvor.
[133] Herr Johann ist darnach zu Lübeck in den Thurm gesetzt, und folgendes Jahrs in einem Stuhl auf den Markt gebracht, wo ihm das Haupt abgehauen ist. Der Stuhl ist noch auf dem Rathhause; und. auf dem Markt ist die Fliese noch zu sehn, darauf der Stuhl gestanden.
Ein Rath aber ließ aus Herrn Johanns Gütern einen großen silbernen Schauer machen; auf dem stand geschrieben: dâr danßt Bornholm hen. Daraus mußten, wenn der Hippokras geschenkt ward, die Burgemeister trinken, damit sie allezeit der Städte Ehre vor Augen hätten. Solches geschah jährlich zweimal nach dem Spruch:
und abermals:
Bemerkungen
[392] (Vollständig nur mündlich.) S. 133 Schauer – großes Trinkgeschirr. Hippokras – ein stark gewürzter Wein.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren, bzw. Versionsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.
|
 |
 |
|
Ergänzungsartikel II aus ,,Wikisource” zu Johann Wittenborg:
ADB (Allgemeine Deutsche Biographie):Wittenborg, Johann
Wittenborg: Johann W., Lübscher Bürgermeister und hansischer Flottenführer des vierzehnten Jahrhunderts, entstammte einer seit mehreren Generationen in Lübeck ansässigen Kaufmannsfamilie. Schon sein Urgroßvater hatte dem städtischen Rathe angehört, sein Vater hieß Hermann, nicht Hinrich, wie bisher angenommen ist. In seiner Jugend hat W. Reisen nach Flandern, später nach England unternommen, bald nach der Mitte des Jahrhunderts ist er als Rathsherr nachweisbar, auch als Sendebote auf den Tagfahrten der Städte. Als nach der Eroberung Wisby’s durch König Waldemar Attertag von Dänemark die Hansa gegen diesen den Krieg beschloß, führte W. den Vorsitz auf der entscheidenden Versammlung zu Greifswald. Die Städte gingen ein Bündniß ein mit den Königen von Schweden und Norwegen und mit deutschen Fürsten, ein kräftiger Angriff war beabsichtigt und als Ziel des Krieges bezeichnet, König Waldemar nicht allein Gotland, Oeland und Schonen sondern die dänische Krone selber zu nehmen. Zur Deckung der Kriegskosten ward die Erhebung eines Pfundzolles im Gebiete der Ostsee wie der Westsee ausgeschrieben. Im Frühjahr 1362 war die hansische Flotte segelfertig, Johann W. führte den Oberbefehl. Aber als sie im Sunde erschien, waren weder die Schweden noch die Norweger zur Stelle. Anfänglich ist, wie es scheint, ein Angriff auf Kopenhagen beabsichtigt gewesen, auf Wunsch der verbündeten Könige jedoch wandte man sich gegen Helsingborg. Die Flottenmannschaft ward zur Belagerung der Feste ans Land gesetzt, auf den Schiffen nur eine schwache Besatzung zurückgelassen, [610] aber zwölf Wochen hindurch lag das Heer ohne Erfolg vor Helsingborg und ein kühner Ueberfall des dänischen Königs gelang vollkommen, zwölf große Schiffe mit Vorräthen und Kriegsmaterial wurden seine Beute. Das muß ungefähr Anfang August geschehen sein. Ob diese Niederlage, ob die Unbezwingbarkeit der belagerten Stadt den Anlaß gab, steht dahin, doch ward im Herbst die Belagerung aufgehoben, die hansische Flotte kehrte sieglos heim. Daß Opfer des Mißerfolges ward Johann W. Ob ihn ein persönliches Verschulden trifft, ob er sich in Verhandlungen mit König Waldemar eingelassen hat, welche die Städte mißbilligten, ist nicht deutlich. W. ward nach seiner Rückkehr nach Lübeck aus dem Rathe gestoßen, gefangen gesetzt und ihm der Proceß gemacht. Vergebens versuchte eine ihm befreundete Partei seine Freilassung zu erwirken, vergebens auch seine Sache vor die Versammlung der Städte zur Entscheidung zu bringen. Zur Tagfahrt nach Stralsund am 1. Januar 1363 ward W. zugelassen, aber diese erkannte seine Schuld an und jede weitere Einmischung der Hansa, jede Ersatzpflicht der gegen W. erhobenen Schadensansprüche, wie sie z. B. die Kieler vorbrachten, lehnte der Lübecker Rath ab. Wol nicht mit Unrecht hat man aus alledem auf Parteiungen innnerhalb des Rathes geschlossen, doch bleibt uns alles Nähere unaufgeklärt, weder der Inhalt noch die Begründung der erhobenen Anklage ist überliefert. Als dann Wittenborg’s Anhang den Versuch erneuerte, den Proceß vor das Forum der Städte zu ziehen, hat das sichtlich nur die Katastrophe beschleunigt. Im Hochsommer 1363 erlitt W. auf dem Markte seiner Vaterstadt den Tod durch die Hand des Henkers. Sein Begräbniß fand er, da der Rath so wenig seinen Namen in der Rathslinie, wie seinen Leichnam in der Marienkirche dulden wollte, in der Kirche zur Burg bei den Dominicanern. Nur zu vieles bleibt hier unaufgehellt. Auch das neuerdings im Staatsarchiv aufgefundene und noch ungedruckte Handlungsbuch Wittenborg’s, das über seine kaufmännische Thätigkeit, seine Familie u. s. w. interessante Aufschlüsse gewährt und dessen Nachrichten aus den Eintragungen der Stadtbücher noch Ergänzungen erhalten können, gibt selbstverständlich über sein Ende keine weitere Aufklärung. Uebrigens muß aus dem Umstande, daß Wittenborg’s Handlungsbuch ins Lübsche Archiv eingeliefert ist, die Schlußfolgerung gezogen worden, daß entgegen der Annahme von Mantels bei Wittenborg’s Inhaftnahme auch eine Beschlagnahme seines Vermögens stattgefunden hat.
Mantels, Beiträge zur Lübisch-Hansischen Geschichte (herausgegeben von Karl Koppmann),S. 184–194.–D. Schäfer,Die Hansestädte und König Waldemar von Dänemark,S. 275 ff., 359 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren, bzw. Versionsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.
|
 |
 |
|
Håkon VI. (Norwegen) - Haakon VI. Magnusson
Haakon VI. Magnusson (* um 1341; † 1380) war König von Norwegen, Mitkönig von Schweden 1362-64, Sohn von König Magnus Eriksson von Schweden und Norwegen und Blanche von Namur.
Leben
König von Norwegen
1343 ernannte Magnus Eriksson einen zweijährigen Sohn zum König von Norwegen. 1355 wurde Haakon nach norwegischen Recht mit 14 Jahren mündig und damit Regent. Sein nach schwedischem Recht noch minderjähriger Bruder Erik war als Thronfolger für Schweden vorgesehen. Sein Vater Magnus behielt aber das Gebiet um Tønsberg, Island, die Orkneys, Shetland, die Färöer und Hålogaland, was praktisch das gesamte Nord-Norwegen bedeutete. Außerdem herrschte Magnus weiterhin über Ostnorwegen und Westschweden, darunter das zentrale Båhus-Schloss auf Grund der Morgengabe an Blanche von Namur.
Verlobung mit Margarethe
Waldemar Atterdag versuchte vergeblich, die Gelegenheit des Aufstandes von Håkons Bruder Erik 1356 gegen seinen Vater um die schwedische Krone zu nutzen, um Schonen wieder zurückzugewinnen. 1359 versöhnten sich die beiden Könige und besiegelten den neuen Frieden mit der Verlobung zwischen Håkon und der Tochter Waldemars Margarete. Bei dieser Gelegenheit bekam Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg das Schloss Båhus.[1]
Mitkönig in Schweden
1359 starben der Bruder Erik und kurz darauf dessen schwangere Frau, ohne Erben zu hinterlassen. Magnus zog unverzüglich den bisherigen Herrschaftsbereich Eriks ein. 1360 gelang es Waldemar Atterdag, Skåne zurückzugewinnen. Dies erzeugte den Unwillen des schwedischen Adels und machte auch die Hanse und die norddeutschen Gebiete unruhig, da Dänemark nunmehr den Øresund kontrollierte. Magnus verbündete sich mit der Hanse, um Skåne zurückzugewinnen, doch das missglückte. Stattdessen setzte ihn sein Sohn Håkon im Schloss Kalmar gefangen. Nach einem Vergleich wurde er wieder freigelassen, und Håkon wurde am 15. Februar 1362 an Stelle seines toten Bruders und neben seinem Vater schwedischer König.
Heirat mit Margarethe
Sein Vater war nun mit dem dänischen König Waldemar Atterdag zerstritten und löste die Verlobung zwischen seinem Sohn und dessen Tochter und verlobte ihn mit der holsteinischen Grafentochter Elisabeth, wohl, um mit dieser Allianz Dänemark in die Zange zu nehmen. Doch die Ehe kam nicht zustande. Es folgte nämlich eine erneute Kursänderung, und die Bestrebung einer dynastischen Verbindung mit Dänemark führte 1363 zur Ehe von Håkon und Margarete von Dänemark, mit der er den Sohn Olav hatte. Elisabeth verlor die Aussicht auf den norwegischen Thron und heiratete später, als Ergebnis eines Bündnispaktes zwischen den holsteinischen Schauenburgern und den mecklenburgischen Obodriten, Albrecht IV. von Mecklenburg.
Verlust Schwedens
1363 setzte der schwedische Reichsrat Magnus ab und boten Albrecht von Mecklenburg, als Sohn von Magnus′ Schwester nach Håkon zweiter in der Thronfolge, die Krone an. Albrecht fiel mit Unterstützung der norddeutschen Fürsten in Schweden ein und wurde 1364 gekrönt.
1365 fiel Magnus in der Schlacht bei Gata in Albrechts Hände. Damit war Håkon Alleinherrscher über Norwegen und die Gebiete der dem König treu gebliebenen Folkunger. Håkon schloss eine Allianz mit Waldemar Atterdag, da beide gleiche Interessen gegenüber dem schwedischen König, der Hanse und den norddeutschen Fürsten verfolgten.
1370 strebte Håkon nach Verhandlungen mit König Albrecht über die Freilassung seines Vaters. Gleichzeitig suchte eine schwere Pestepidemie Oslo und Umgebung heim, so dass die Versorgung der Bevölkerung zusammenbrach. Um seinen Verhandlungen Nachdruck zu verleihen, hatte er eine allgemeine Mobilmachung für südnorwegische Gebiete angeordnet. Doch die Pest verhinderte die Aufstellung ausreichender Truppen.
Im Jahr drauf erhoben sich die Schweden gegen die Mecklenburger. Mit Unterstützung der Aufständischen gelang es Håkon, mit seinem Heer Stockholm zu belagern. Da kam es dann zu einem Vertrag, in welchem Håkon auf Schweden verzichtete und seinen Vater für einen Betrag zwischen 6.000 und 8.000 gediegene Mark frei bekam.[2] Dafür wurde die Festung Båhus verpfändet. Nach seiner Freilassung zog Magnus nach Bergen.
Beziehung zur Kirche
1371 starb dort der Bischof Benedikt Ringstad und Papst Gregor XI. ernannte Jakob Jensson, wahrscheinlich ein Däne, vorher päpstlicher Pönitentiar für Dakien. Er war einer von den vier norwegischen Bischöfen, die ihre Karriere in der päpstlichen Kurie begonnen hatten und war Dominikaner. Er war offenbar mit der königlichen Familie schon vorher befreundet gewesen und verschaffte ihr einige Päpstliche Privilegien. Eines davon war, dass für den König vor Tagesgrauen eine Messe gelesen werden durfte, wenn seine Geschäfte dies erforderten - für den frommen König in einem Land mit langen Nächten und kurzen Tagen im Winter von besonderer Wichtigkeit, wenn er unterwegs war.
Innenpolitik
Sein Bemühen galt zunächst der wirtschaftlichen Stabilisierung Norwegens. Er konzentrierte zur besseren Kontrolle den Handel mit dem Ausland durch Erteilung von Privilegien auf wenige Küstenstädte. Der Landflucht in den lukrativeren Handel, die die Pachteinnahmen aus der Landwirtschaft schmälerte, begegnete er durch das Verbot für alle, die weniger als 15 forngilde Mark Eigenkapital besaßen, Handel zu treiben. Er führte einen Zoll auf den Warenimport aus Island ein.
Der Tod des Vaters
Als der König mit seinem Sohn Olav und Margarethe im Herbst 1374 nach einem Besuch in Dänemark zurückkehrten, fuhren sie nach Tønsberg. Dorthin wollte auch Magnus kommen, um mit ihnen gemeinsam Weihnachten zu feiern. Der Herbst war sehr stürmisch und das königliche Schiff sank am 1. Dezember 1374 bei der Einfahrt in den Bømlofjord. Die Leiche des Königs war die einzige, die gefunden wurde.[3]
Tod
Als Håkon 1380 starb, wurde sein Sohn als Olav der IV. König von Norwegen. Da dieser jedoch noch minderjährig war, übernahm Margarethe die Regentschaft und begründete somit die Union zwischen Norwegen und Dänemark, die bis 1814 dauerte.
Fußnoten
- ↑ Fritz S. 47 Fn. 48.
- ↑ Haug S. 95.
- ↑ Haug S. 96 f.
Literatur
- Birgitta Fritz: Hus, land och län: Förwaltningen i Sverige 1250-1434. 2 Bde. Stockholm 1972-1973.
- Eldbjørg Haug: Margrete. Den siste Dronningen i Sverreætten. Oslo 2000.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Winrich von Kniprode
Winrich von Kniprode (* um 1310 unweit von Monheim am Rhein; † 24. Juni 1382 bei Marienburg, poln. Malbork) war der 22. Hochmeister des Deutschen Ordens. Er bekleidete dieses Amt in der Zeit von 1351 bis 1382. In diese Epoche fallen sowohl die Blütezeit des Rittertums als auch die Glanzzeit des Ordensstaates.
Leben
Winrich von Kniprode entstammte einem niederrheinischen Rittergeschlecht. Über den Zeitpunkt seines Ordenseintrittes ist nichts bekannt; seine erste Erwähnung als Kompan des Pflegers von Preußisch Holland datiert aus dem Jahr 1334. In der Zeit von 1338 bis 1341 war Winrich von Kniprode Komtur von Danzig, im Jahr 1342 Komtur von Balga. Während der Zeit des Hochmeisters Ludolf König von Wattzau führte er von 1341 bis 1346 als Ordensmarschall und Komtur von Königsberg das Ordensheer.
Sein Vorgänger als Hochmeister, Heinrich Dusemer, ernannte ihn im Jahr 1346 zum Großkomtur. Als solcher siegte er gemeinsam mit dem Ordensmarschall Otto von Danfeld im Winter 1348 über eine Streitmacht des litauischen Großfürsten Kęstutis in der Schlacht an der Streva südöstlich von Kaunas.
Nach der krankheitsbedingten Abdankung Heinrich Dusemers wurde Winrich von Kniprode am 14. September 1351 zum Hochmeister gewählt. Bis zu seinem Tode 1382 blieb er in diesem Amt und war damit der am längsten amtierende Hochmeister des Deutschen Ordens. Seine Regierungszeit gilt als der Höhepunkt der Geschichte des Ordensstaates. Es wurde damals beim westeuropäischen Adel zur Mode, zu sogenannten Kriegsreisen gegen Litauen aufzubrechen. So setzte man auf spezifische Art die Tradition der Kreuzzüge fort. Winrich gelang es, diese kriegerischen Ambitionen des abendländischen Adels in die Dienste des Ordens zu stellen (siehe: Preußenfahrt). Auch nahm der Orden unter Kniprodes Ägide Einfluss auf die innenpolitischen Verhältnisse der untereinander verfeindeten Litauer (z. B. der Vertrag von Daudisken im Mai 1380 mit dem Großfürsten Jogaila, dem späteren polnischen König Władysław II., gegen dessen Onkel und Rivalen Kęstutis).
Die Verwaltung wurde modernisiert und die Wirtschaft nachhaltig gefördert. So trat der Orden mit einer eigenen Handelsorganisation, vertreten durch sogenannte Großschäffer, selbst als Mitbewerber der Hanse auf, was sich bei seinem Status als Landesherr mitsamt entsprechenden Regalien (Rechten) wie z. B. dem Bernsteinmonopol als sehr Gewinn bringend erwies. Die Siedlungstätigkeit an der Weichsel und in der so genannten Wildnis (den Urwaldgebieten an den Grenzen zu Litauen) wurde planmäßig fortgesetzt. Nennenswerte Erfolge der Ordenswirtschaft waren vor allem in der Schaf- und Bienenzucht sowie im Weinanbau zu verzeichnen. Im Kampf gegen Zinswucher konnte der zulässige Höchstzins von 12,5% auf 10% gedrückt werden. Parallel dazu wurden neue Silbermünzen ausgegeben: der Schilling zu 12 Pfennig, der Halbschoter zu 16 Pfennig und das Vierchen zu 4 Pfennig. Das preußische Münzsystem wurde endgültig wie folgt festgelegt: 1 preußische Mark = 60 Schillinge = 720 Pfennige.
Im andauernden Krieg gegen Litauen errang das von ihm und dem Ordensmarschall Henning Schindekopf geführte Ordensheer am 17. Februar 1370 einen entscheidenden Sieg über ein litauisches Heer in der Schlacht bei Rudau (nördlich von Königsberg).
Während seiner Zeit gewann ein starker weltlicher Geist im Orden Einfluss. Winrich bekämpfte diesen, indem er eine Art Rotationssystem innerhalb der mittleren und höheren Ordenämter einführte inklusive strenger Rechenschaftspflicht bei Amtswechsel. Außerdem wurden in den einzelnen Komtureien unangekündigte Visitationen durchgeführt. Des weiteren wurden Maßnahmen zur Festigung von Disziplin und Ordnung der Ordensmitglieder unternommen. So wurde z.B. der aufkommenden Neigung zu Prunk mit einer verschärften Kleiderordnung entgegengetreten. Um die Wehrtüchtigkeit der Bürger aufrecht zu erhalten, wurden von Zeit zu Zeit Reservistenübungen durchgeführt.
Gleichzeitig versuchte Winrich, den allgemeinen Bildungsstand zu heben. In den Städten kam es zur Errichtung allgemeinbildender Schulen. In Marienburg erfolgte die Errichtung einer Lehranstalt zur höheren Bildung der Ordensmitglieder.
Im Jahre 1366 empfing Kniprode als erster Hochmeister auf der Marienburg den polnischen König Kasimir III.. Auch unterstützte er den Kampf der Hanse gegen die Dänen, der im Frieden von Stralsund erfolgreich für jene endete. Er setzte den Bau des Mittelschlosses fort und ließ die Stadtmauern um Marienburg errichten.
Winrich von Kniprode starb am 24. Juni 1382 und wurde in der Annenkapelle in der Marienburg beigesetzt.
Nachwirkung
Nachhaltig bedingt durch seine lange Regierungszeit in Zeiten relativer ökonomischer und militärischer Stabilität, ging Winrich von Kniprode neben Hermann von Salza als der größte und bekannteste Hochmeister des Deutschen Ordens in die Geschichte ein. Noch in den 1930er Jahren trug ein Schnelldampfer seinen Namen. In einigen deutschen Städten sind Straßen nach Winrich von Kniprode benannt, so zum Beispiel in Wilhelmshaven oder im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Auch eine katholische Grundschule in seinem vermutlichen Geburtsort Monheim am Rhein führt seinen Namen.
Literatur
- Hans Prutz: Die Ritterorden. Bechermünz Verlag, Berlin 1908
- Wolfgang Sonthofen: Der Deutsche Orden. Weltbild Verlag, Augsburg 1995
- Dieter Zimmerling: Der Deutsche Ritterorden. ECON Verlag, München 1998
- Friedrich Borchert: Die Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen erschienen in der "Preußischen Allgemeinen Zeitung" am 27. Oktober 2001.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Grafen von Schauenburg und Holstein
Das Adelsgeschlecht Grafen von Schauenburg und Holstein stammt ursprünglich von der Schauenburg bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) an der Weser. Neben der Stammgrafschaft mit ihren Residenzorten Bückeburg und Stadthagen wurde die Familie auch mit der Grafschaft Holstein belehnt. In ihrem Stammland wurde aus Schauenburg später Schaumburg.
Geschichte der Grafenfamilie
Die Familie teilte sich ab 1261 im Laufe der Zeit in mehrere Linien. Dadurch gab es mehrere Herrscher gleichzeitig in Holstein:
- Holstein-Itzehoe (1261–1290)
- Holstein-Kiel (1261–1390)
- Holstein-Segeberg (1273–1308/1350)
- Holstein-Plön (1290–1390)
- Holstein-Pinneberg oder Holstein-Schauenburg (1290–1640)
- Holstein-Rendsburg (1290–1459)
Die Teilungen endeten 1390; die Rendsburger Linie hatte den größten Teil Holsteins inne. Lediglich die kleine Grafschaft Holstein-Pinneberg bestand weiter.
Folgende Grafen waren die wichtigsten für Holstein
- (1110–1130) Adolf I. Graf von Schauenburg und Holstein (* ?; † 13. November 1130)
- (1130–1164) Adolf II. Graf von Schauenburg und Holstein (* 1128]; † 6. Juli 1164 in Demmin)
- (1164–1225) Adolf III. Graf von Schauenburg und Holstein (*ca. 1160; † 3. Januar 1225)
- (1225–1238) Adolf IV. Graf von Schauenburg und Holstein (* vor 1205; † 8. Juli 1261 in Kiel)
- (1239–1290) Gerhard I. Graf von Holstein-Itzehoe (*ca. 1232; † 1290)
- (1290–1315) Adolf VI. Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg (*ca. 1256; † 1315)
- (1290–1304) Heinrich I. Graf von Holstein-Rendsburg (*ca. 1258; † 1304)
- (1304–1340) Gerhard III. der Große Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig und Jütland (*ca. 1293; † 1340)
- (1340–1382) Heinrich II. der Eiserne Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig (*ca. 1317; † 1382)
- (1382–1404) Gerhard VI. Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig (* ; † 1404)
- (1404–1427) Heinrich IV. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1397; † 1427)
- (1427–1433) Gerhard VII. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1404; † 1433)
- (1427–1459) Adolf VIII. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1401; † 1459)
Da Adolf VIII. ohne Erben verstarb, wählte der holsteinische Adel 1460 dessen Neffen, den seit 1448 regierenden König Christian I. von Dänemark, zum neuen Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein. Damit kam das Haus Oldenburg als Nachfolger der Schauenburger an die Macht in Schleswig und Holstein und herrschte hier bis 1864.
Die Pinneberger Familie herrschte noch bis 1640 in der kleinen Grafschaft Holstein-Pinneberg sowie im Schauenburger Stammland.
Bedeutung der Grafenfamilie in Niedersachsen
Die Schaumburger Grafen waren im 13. Jahrhundert Gografen des Bezirks Wennigsen (Deister) und bereits seit über 100 Jahren im Deister-Vorland begütert. Dieser Umstand brachte es mit sich, dass den Grafen von Schauenburg und Holstein die Vogtei des Klosters Wennigsen unterstellt wurde. Die Grafenfamilie stiftete Eigentum an das Kloster[1].
Anmerkungen
- ↑ 750 Jahre Wennigsen 1200–1950 , herausgegeben vom Vorbereitenden Ausschuss für die 750-Jahrfeier der Gemeinde Wennigsen; gedruckt 1950 bei den Buchdruckwerkstätten Hannover, S. 8-9
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Waldemar (Brandenburg)
Waldemar von Brandenburg, der Große, auch Woldemar [1] (* um 1280; † 14. August 1319 in Bärwalde) aus dem Geschlecht der Askanier war von 1308 bis 1319 Markgraf von Brandenburg, ab 1302 bereits als Mitregent, von 1318 bis 1319 als Vormund für seinen Vetter Heinrich II.
Leben
Waldemars Eltern waren Markgraf Konrad I. (* um 1240; † 1304) von Brandenburg ∞ 1260 Constantia von Polen († 1281)[1], deren Vater Herzog Przemysław I . von Großpolen war.
Im Vertrag von Soldin trat Waldemar seine Ansprüche auf das Herzogtum Pommerellen mit Danzig gegen eine Zahlung von 10.000 Mark Silber an das Deutschordensland ab, doch blieben die Burgbezirke Stolp und Schlawe zunächst bei Brandenburg. Diese Länder wurden 1317 zusammen mit Rügenwalde an Herzog Wartislaw IV. von Pommern in Wolgast abgetreten.
1312 führte er Krieg mit dem Markgrafen von Meißen, Friedrich dem Gebissenen, nahm ihn gefangen und zwang ihm am 14. April 1312 den Vertrag zu Tangermünde auf. 1316 besetzte er Dresden. 1319 erwarb Waldemar für Brandenburg Züllichau und Schwiebus.
1315 besetzte Waldemar im sogenannten Markgrafenkrieg die Herrschaft Stargard, verlor aber gegen Heinrich II. von Mecklenburg die Schlacht bei Gransee und musste nach dem Templiner Frieden vom 25. November 1317 das Land Stargard an Heinrich II. zurückgeben.
1309 vermählte Waldemar sich mit Agnes von Brandenburg (1297–1334) einer Tochter von Markgraf Hermann III. Diese Ehe blieb kinderlos. 1319 starb Markgraf Waldemar und sein Vetter Heinrich II. von Brandenburg folgte ihm nach. Mit dessen frühem Tode nur ein Jahr später erlosch 1320 die Linie der Askanier als Markgrafen von Brandenburg.
Der Falsche Waldemar
Im Jahre 1348 meldete sich ein alter Mann beim Erzbischof von Magdeburg und behauptete, er sei der wirkliche Markgraf Waldemar, soeben erst von einer Pilgerfahrt aus dem Heiligen Land zurückgekehrt. Man habe 1319 den Falschen bestattet. Kaiser Karl IV. belehnte ihn daraufhin mit der Mark Brandenburg, bis er 1350 als Hochstapler entlarvt wurde; vgl. Falscher Woldemar.
Denkmäler
- 1894 Denkmal von Max Unger auf der Berliner Mühlendammbrücke (Fischerbrücke) – laut Lehnert Prototyp der frühen Standbilder in der Siegesallee [2]
- 1900 Zentrales Standbild der Denkmalgruppe 8 in der Siegesallee von Reinhold Begas mit Büsten (Nebenfiguren) von Siegfried von Feuchtwangen und Heinrich Frauenlob von Meißen.
Fußnoten
- ↑ a b Dr. Gerd Heinrich: Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Band 10, Berlin und Brandenburg, Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 1995, Seite 407 und 494, ISBN 3-520-31103-8
- ↑ Uta Lehnert: Der Kaiser und ..., S. 390; laut Richard George (Hrsg.): Hie gut Brandenburg ..., S. 132f wurde das Denkmal 1895 aufgestellt.
Literatur
- Richard George (Hrsg.): Hie gut Brandenburg alleweg! Geschichts- und Kulturbilder aus der Vergangenheit der Mark und aus Alt-Berlin bis zum Tode des Großen Kurfürsten, Verlag von W. Pauli's Nachf., Berlin 1900.
- Uta Lehnert: Der Kaiser und die Siegesallee. Réclame Royale, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-496-01189-0.
- Wilhelm von Sommerfeld: Waldemar (Markgraf von Brandenburg). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 40. Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 677–689.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann V. (Brandenburg)
Johann V., der Erlauchte (Illustris), (* 1302; † 24. März 1317) war ein Markgraf von Brandenburg seit 1308.
Johann war der Sohn des Markgrafen Hermann, der Lange von Brandenburg († 1308) und seiner Frau Anna von Österreich (1275-1327), Tochter des Kaisers Albert I., Herzog von Österreich und König von Böhmen. Mit Johann V. starb die Linie Salzwedel der Askanier aus.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wizlaw III. (Rügen)
Wizlaw III. (* 1265 oder 1268; † 8. November 1325) war der letzte slawische Fürst von Rügen. Er ist wahrscheinlich identisch mit dem Minnesänger Wizlaw aus der Jenaer Liederhandschrift.
Leben
Prinz Wizlaw von Rügen wurde als erster von vermutlich vier Söhnen und vier Töchtern in der Ehe von Fürst Wizlaw II. und der welfischen Prinzessin Agnes von Braunschweig-Lüneburg 1265 oder 1268 geboren. Wohl unter dem Einfluss seiner mütterlichen Verwandten erhielt er ein ritterlich höfische Erziehung. Er wurde unter anderem durch den Stralsunder Magister Ungelarde († um 1300) unterrichtet, der auch als Sänger bekannt war. Ein überliefertes Ereignis aus Wizlaws Jugendjahren war alles andere als schön: Wizlaw wurde während einer Andacht im Rigaer Dom, nachdem er einem Kaufmann eine unwillige Antwort wegen einer Schuld gab, von diesem niedergestochen. Als Folge davon litt er an einem Gehfehler.
Wizlaw III. wurde 1283 erstmals urkundlich genannt, als er eine Schenkung seines Vaters an das Kloster Neuenkamp bestätigte. Sein Vater regierte bis zum Ende seines Lebens und vererbte den Fürstenthron 1302 nicht an Wizlaw allein: Er musste ihn mit dem einzigen noch lebenden Bruder Sambor teilen. Beide befehdeten sich derart, dass sie 1304 zur Unterschrift eines Schriftstücks gedrängt wurden, das sie dazu zwang, in Zukunft Frieden zu halten – sonst wären ihre Mannen berechtigt gewesen, sich gegen sie zu stellen. Nach Sambors Tod 1304 regierte Wizlaw bis 1325 allein. Da er noch ohne Erben war, schloss sein Lehnsherr, der Dänenkönig Erik Menved, mit ihm 1310 einen Erbvertrag. Darin wurde vereinbart, dass das rügische Lehen beim Tode Wizlaws ohne Erben an die dänische Krone fallen sollte. Gleichzeitig verzichteten die Nebenlinien der Fürsten von Rügen, die Herren von Gristow und von Putbus, auf eine mögliche Nachfolge.
Die Regierungszeit Wizlaws verlief alles andere als friedlich: Er wurde hineingezogen in den Markgrafenkrieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum zwischen seinem Lehnsherrn Erik VI. von Dänemark (Erik Menved), Markgraf Waldemar von Brandenburg und den reichen Handelsstädten an der Ostsee. Besonders kompliziert war Wizlaws Verhältnis zu Stralsund, jener einflussreichen und mächtigen Stadt im Fürstentum Rügen. Nachdem Stralsund sich 1313 unter dem Eindruck der Eroberung Rostocks durch Heinrich II. von Mecklenburg durch Geldzahlungen und Verzicht auf Privilegien von einer drohenden Invasion dänischer, mecklenburgischer und weiter verbündeter Truppen freigekauft hatte, versuchte Wizlaw seinen Einfluss auf die Stadt auszuweiten. Die Verhandlungen dazu scheiterten, da Stralsund nicht bereit war, die von Wizlaw geforderten Einschränkungen des lübischen Rechts hinzunehmen und sich 1314 mit Waldemar von Brandenburg und dem rügischen Landadel gegen seinen Landesherrn verbündete. Als 1316 ein Heer unter dem Herzog Erich I. von Sachsen-Lauenburg Stralsund angriff, hatte Wizlaw auf Seiten der dänischen Flotte an der seeseitigen Belagerung der Stadt teilgenommen. Die Belagerung endete mit dem Sieg über das Belagerungsheer bei einem nächtlichen Ausfall der Stralsunder und der Gefangennahme des Herzogs. Auch die Belagerungsflotte erlitt große Verluste, Wizlaw musste fliehen. Erst 1317 kam es zum Friedensschluss. Wizlaw, dem es durch die Kriegskosten an Geld mangelte, vergab weitreichende Privilegien an Stralsund, und verpfändete der Stadt die fürstlichen Zölle und die Gerichtsbarkeit. Außerdem trat er ihr gegen eine Geldsumme seine Münze ab, in der ab 1319 die Sundische Mark geprägt wurde.
Wizlaw war zweimal verheiratet: Zuerst (vor 1305) mit Margareta aus einem unbekannten Geschlecht und nach ihrem Tod (um 1310) mit Agnes aus dem Hause Lindow-Ruppin. Die erste Ehe blieb wahrscheinlich kinderlos, bei der ersten Tochter Euphemia wäre aber eventuell eine Mutterschaft von Margareta denkbar. Mit Agnes hatte Wizlaw dann noch die Tochter Euphemia und als letztes Kind den lange ersehnten Nachfolger Jaromar. Doch dieser starb, vermutlich etwa dreizehnjährig, am 24. Mai 1325 noch vor dem Vater (8. November 1325). Wizlaw starb wohl an gebrochenem Herzen, weil er den Tod seines einzigen Sohns, der ja auch der letzte männliche Spross des Fürstengeschlechts war, nicht verkraften konnte.
Nach dem Tod König Erik Menveds 1319 war der Erbvertrag mit Dänemark hinfällig geworden und Wizlaw hatte 1321 einen Erbverbrüderungsvertrag mit seinem Neffen, dem Herzog Wartislaw IV. von Pommern-Wolgast geschlossen. Als dieser bereits 1326 starb, kam es zum Rügischen Erbfolgekrieg.
Der Lied- und Spruchdichter Wizlaw
Vom Sänger Wizlaw sind uns 14 Lieder und 13 Sprüche überliefert, die als Nachtrag in der Jenaer Liederhandschrift auf den Blättern 72vb - 80vb enthalten sind. Sein Werk ist erstaunlich vielseitig: Sangsprüche zu moralischen Fragen, Minnelieder im Sinne der alten Meister, geistliche Gesänge, ein Rätsel, ein Tagelied, ein Lobspruch und immer wieder auch deutliche erotische Anspielungen. Auch musikalisch ist Wizlaw sehr experimentierfreudig: Man findet hoch komplexe melismatische Melodien genauso wie zupackende Gassenhauer, eine Komposition in reiner Pentatonik und sogar orientalische Anklänge. Sein bekanntestes Lied ist das Herbstlied Loibere risen, das sich auch heute noch im Repertoire vieler Mittelaltergruppen findet und sogar von Angelo Branduardi interpretiert wurde.
Gedichtet hat er mehr Lieder als überliefert sind, da in der Jenaer Liederhandschrift nachweislich drei Blätter verlorengegangen sind. Deshalb ist auch die Autorschaft des ersten Sangspruchs Ich wil singen in der niuwen wîse ein liet unklar – früher wurde er Friedrich von Sonnenburg zugeschrieben, dessen Oeuvre im Kodex direkt vorangeht; er könnte jedoch auch zum Wizlawkorpus gehören. Die Zuordnung eines Autornamen zu den Texten konnte nur erfolgen, da ein Wizlaw sich in drei verschiedenen Liedern selbst nennt. Drei der Lieder sind infolge der abhanden gekommenen Seiten nur unvollständig erhalten. Sämtliche Minnelieder und Sprüche enthalten auch die Melodien in Quadratnotation, mehrere Sprüche werden (wie bei Sangspruchdichtern üblich) in derselben Melodie („im selben Ton“) gesungen.
Zwei Fürstenpreisstrophen, eine von Frauenlob und eine von dem Goldener, rühmen den Rügenfürsten. Einige Wissenschaftler (Seibicke, Wallner, Wachinger) vertreten die Meinung, dass der Fürst Wizlaw III. nicht der Minnesänger Wizlaw gewesen sei. Andere Literatur- und Musikwissenschaftler, die sich mit Wizlaw befasst haben, sehen jedoch eine Identität beider Personen.
Für die Identität werden folgende Argumente ins Feld geführt:
- In der Jenaer Liederhandschrift finden sich die beiden erwähnten Fürstenpreisstrophen, in denen der Rügenfürst als „Wizlaw der Junge“ tituliert wird, um ihn von seinem gleichnamigen Vater zu unterscheiden. Im gleichen Kodex finden sich die Wizlaw-Lieder, in denen dieser sich an einer Stelle als „Wizlaw der Junge“ bezeichnet. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die Verfasser der Strophen noch nicht wissen konnten, daß diese dereinst gemeinsam in einem Kodex versammelt würden.
- In einem Lied lobt der Sänger eine Minneweise (senende wise) des Sängers „Unghelarte“. Dieser ist urkundlich um 1300 in Stralsund nachgewiesen.
- In einem Lobspruch preist Wizlaw einen Herrn von Holstein (Graf Erich von Holstein-Schauenburg, 1328 als Hamburger Propst urkundlich bezeugt). Die Holsteiner standen urkundlich nachgewiesen in enger Verbindung zum Rügener Fürstenhaus. Ein Herr von Holstein unterschrieb auch 1304 das Friedensdokument zwischen den Fürsten Wizlaw und Sambor.
Gegen die Identität werden folgende Argumente ins Feld geführt:
- Der Name Wizlaw war nicht selten. Auch der Zusatz der Junge ist nicht so einzigartig, daß ihn nicht verschiedene Personen tragen konnten.
- Das überlieferte Oeuvre, vor allem die Spruchdichtung, passt eher zu einem Berufsdichter als zu einem adeligen Dilettanten. Vor allem Fürstenpreissprüche - wie der auf den Grafen von Holstein - gehören ins Repertoire bezahlter Auftragsdichtung. Dass ein ranghöherer Fürst (!) einen befreundeten Adeligen in Versen öffentlich rühmen könnte, ist im Licht der zeitgenössischen Hofliteratur unwahrscheinlich.
Der Name des Fürsten und Sängers wird in den verschiedenen Publikationen oft unterschiedlich geschrieben: Wizlaw, Wizlav, Wizlaf, Wizlaff, Witzlaw, Witzlav, Witzlaf, Witzlaff.
Literatur
(chronologisch geordnet)
- Friedrich Heinrich von der Hagen: Minnesinger, Deutsche Liederdichter des 12., 13. und 14. Jahrhunderts I - IV. Leipzig 1838, Nachdruck Aalen 1963 (Wizlaws Texte: S. 78–85, Band I, Wizlaws Melodien: S. 808–817, Band IV)
- C. G. Fabricius: Urkunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen unter den eingeborenen Fürsten., Stettin 1851
- Ludwig Ettmüller: Des Fürsten von Rügen Wizlaws des Vierten Sprüche und Lieder in niederdeutscher Sprache. (Bibliothek der gesamten deutschen National-Literatur, 33. Band), Quedlinburg und Leipzig 1852, Neuausgabe durch Edition Rodopi, Amsterdam 1969
- Theodor Pyl: Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw von Rügen. Greifswald 1872
- Franz Kuntze: Wizlaw III – Der letzte Fürst von Rügen. Halle a. S. 1893
- Theodor Pyl: Wizlaw III.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43. Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 684–688.
- Georg Holz, Franz Saran, Eduard Bernoulli (Hrsg.): Die Jenaer Liederhandschrift. Teil I. Getreuer Abdruck des Textes, hg. von Georg Holz, Teil II. Übertragung, Rhythmik und Melodik, bearb. von Eduard Bernoulli und Franz Saran, Leipzig 1901, Nachdruck Hildesheim 1966
- Erich Gülzow: Des Fürsten Wizlaw von Rügen Minnelieder und Sprüche. Greifswald 1922
- Ursula Scheil: Genealogie der Fürsten von Rügen (1164 - 1325). Greifswald 1945
- Wesley Thomas, Barbara Garvey Seagrave: The Songs Of The Minnesinger, Prince Wizlaw Of Rügen. Chapel Hill, The University of North Carolina 1967
- Sabine Werg: Die Sprüche und Lieder Wizlavs von Rügen. Untersuchungen und kritische Ausgabe der Gedichte. Hamburg 1969
- W. Seibicke: „wizlau diz scrip“ oder: Wer ist der Autor von J, fol. 72v-80v? In: NdJb. 101/1978, S. 68–85 (Argumentation, dass der Dichter Wizlaw nicht der Fürst von Rügen sei)
- Wolfgang Spiewok: Wizlaw III. von Rügen, ein Dichter. In: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk, 8/1985
- Horst-Diether Schroeder: Der Erste Rügische Erbfolgekrieg – Ursachen, Verlauf und Ergebnisse. 1986, In: Beiträge zur Geschichte Vorpommerns: die Demminer Kolloquien 1985–1994. Thomas Helms Verlag, Schwerin 1997, ISBN 3-931185-11-7.
- Birgit Spitschuh: Wizlaw von Rügen: eine Monographie. Greifswald 1989
- Joachim Wächter: Das Fürstentum Rügen - Ein Überblick. 1993, In: Beiträge zur Geschichte Vorpommerns: die Demminer Kolloquien 1985–1994. Thomas Helms Verlag, Schwerin 1997, ISBN 3-931185-11-7
- Burghart Wachinger: Wizlav. In: Verfasserlexikon 10/1999, S. 1292-1298
- Reinhard Bleck: Untersuchungen zur sogenannten Spruchdichtung und zur Sprache des Fürsten Wizlaw III. von Rügen. In: Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 681/2000, Kümmerle Verlag
- Lothar Jahn: Nach der sehnenden Klage muss ich singen - Schlaglichter auf die Musik des Minnesängers Wizlaw: In: Karfunkel Musica. 1/2005, Wald-Michelbach, S. 44–49
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Sundzoll
Der Sundzoll (dänisch: Øresundstolden, schwedisch: Öresundstullen) ist eine 1429 von König Erik VII. von Dänemark eingeführte Abgabe, die nicht-dänische Schiffe, die den Öresund durchfuhren, in Helsingør zu entrichten hatten. Die Kanonen von Schloss Kronborg setzen die Abgabe an der schmalsten Stelle des Öresunds durch. Der Sundzoll war über die Jahrhunderte eine der wichtigsten Einnahmequellen der Dänischen Krone und sicherte so die Unabhängigkeit der dänischen Könige von Adel und Reichsrat. Sie war Anlass für immerwährenden Streit der weiteren Ostseeanrainer, insbesondere der Hansestädte, die sich gegen diese Abgabe auf die Freiheit der Meere beriefen und mehrmals - zuletzt in der Grafenfehde - versuchten, in den Besitz des Sundschlösser zu gelangen.
Der Sundzoll musste auch bei einer Passage des Großen und Kleinen Belts entrichtet werden. Ab 1645 waren schwedische Schiffe durch den Frieden von Brömsebro vom Sundzoll befreit, dieses Privileg ging Schweden aber bereits 1720 durch den Frieden von Frederiksborg wieder verloren.
1567 wurde die Art der Erhebung geändert. Fortan wurde die Ladung der Schiffe besteuert. Dadurch stieg das Sundzollaufkommen auf das Dreifache an. Bei der Berechnung von Schiffsladungen in Helsingör kam ein vereinfachtes Rechenverfahren zum Einsatz, bei dem die Schiffe nur überschlägig vermessen wurden. Bis 1699 wurde die Größe der Schiffsdecks in die Kalkulation des Sundzolls mit einbezogen, was sich sogar auf die Form der auf Lübecker Werften gebauten Schiffstypen auswirkte, bei denen man als Reaktion hierauf auf ein günstiges Verhältnis von Stauraum zu Decksgröße achtete.
Für Dänemark war der Zoll am Sund bis ins 19. Jahrhundert von größter Wichtigkeit, da er eine der Haupteinnahmequellen des Reiches war und zeitweise ein Achtel der dänischen Staatseinnahmen erbrachte. Allein in den hundert Jahren von 1557 bis 1657 befuhren fast 400.000 Schiffe die Meerenge. Während der napoleonischen Kriege ging der Verkehr allerdings stark zurück. Nachdem 1802 noch 12.000 Schiffe die dänische Zoll-Station passiert hatten, waren es 1808 nur noch 121, im Folgejahr 379 Schiffe. Nach den Kriegen stiegen die Zahlen wieder steil an. In der Dekade von 1816 bis 1825 passierten jährlich über 10.000 Schiffe die Meerenge. Für das Jahr 1845 verzeichnen die Zoll-Register 15.950 Schiffe im Sund und 1853 sogar 24.648.
Immer wieder beschäftigte der Sundzoll die Parlamente und Regierungen der seefahrenden Nationen, etwa das preußische Kabinett im Jahr 1838 und das britische Parlament drei Jahre später auf Betreiben der Hafenstadt Hull. 1841 schlossen England, Schweden und Russland noch einmal Verträge mit Kopenhagen, die eine weitere Anerkennung des Sundzolls bei teilweise reduzierten Sätzen, etwa für englische Manufakturwaren, zum Inhalt hatten.
1842 wurde der Sundzoll auf internationalen Druck für alle Schiffe unabhängig von ihrem Herkunftsland auf 1 Prozent des Warenwertes reduziert, 1857 auf Drängen der USA schließlich ganz abgeschafft. Die Kopenhagener Konvention vom 14. März 1857 sprach Dänemark hierfür eine Entschädigung von 30 Millionen dänischen Reichstalern (rund 23 Millionen Taler Preußisch Kurant) zu. Lübeck und Hamburg beteiligten sich mit jeweils 102.996 beziehungsweise 107.012 dänischen Reichstalern (77.000 beziehungsweise 80.000 Taler Preußisch) an der Entschädigung für den Sundzoll.
Daneben erhob Dänemark auch an Land in Holstein, insbesondere von Lübeck, Transitzölle für die Straßenbenutzung der Chaussee nach Hamburg, den Stecknitzkanal und die Lübeck-Büchener Eisenbahn. Es war ein letzter Erfolg Lübecker Außenpolitik, dass es dem Bürgermeister Theodor Curtius gemeinsam mit seinem Gesandten Friedrich Krüger gelang, die europäischen Mächte davon zu überzeugen, die Transitzollfrage mit der Sundzollfrage zu verknüpfen. Die an Dänemark zu zahlenden Transitzölle für den Warenverkehr konnten so auf 20% des Ausgangswertes reduziert werden.
Literatur
Quellen
- Tabeller over skibsfart og varetransport gennem Øresund 1661–1783 og gennem Storebaelt 1701–1748, hrsg. von Nina Ellinger Bang, København 1906ff.
Darstellungen
- A. Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte, 1989, ISBN 3-7950-3203-2
- Hermann Scherer: Der Sundzoll. Duncker und Humblot, Berlin 1845
- C[hristian] F[riderich] Wurm: Der Sundzoll und dessen Verpflanzung auf deutschen Boden, Hamburg 1838
- Carl Friedrich Wehrmann: Die Betheiligung Lübecks bei der Ablösung des Sundzolls, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 6, Lübeck 1892, S. 405-430
- Emil Ferdinand Fehling: Vor fünfzig Jahren. Zur Erinnerung an Friedrich Krüger und Lübecks Politik am Sunde, in: Hansische Geschichtsblätter Bd. 33 (1906), S. 219-243
- Alfred Wünsche: Der Sund - eine verkehrsgeographische Untersuchung, Rostock 1937
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wenden
Wenden (auch Winden, lat. Venedi) bezeichnet diejenigen Westslawen, die vom 7. Jahrhundert an große Teile Nord- und Ostdeutschlands (Germania Slavica) bewohnten, heutzutage meist als Elbslawen bezeichnet.
Wortherkunft
Das Wort leitet sich von dem Namen Venetae ab, einem Ausdruck, der sich im Lateinischen sowohl für ein keltisches Volk der Caesar-Zeit, die Veneter nördlich der Loiremündung, wie auch ein unsicher als italisch oder illyrisch einzuordnendes Volk der Veneter an der nördlichen Adria.
Mit dem Erscheinen der Slawen wurde das Wort von frühmittelalterlichen Autoren für das ihnen unbekannte Volk verwendet – ähnlich wie Welsche oder Wallische, das etymologisch auf einen keltischen Stamm der Volcae zurück geht wird und dann auf die Romanen (Schweiz, Italien), in Britannien auf die keltischen Cymrer (Kambrier) in Wales angewandt wird.
Die Bezeichnung Wenden findet sich in diesem Sinne mehrfach:
Die Veneter an der mittleren Weichsel sind ein um 350 von den Ostgoten unterworfenes Volk, es wurde von antiken Schriftstellern als Venedae bezeichnet und findet sich bei Jordanes.
Daneben findet sich unter den Südslawen in der als Alpenslawen bezeichneten Gruppe ein von den Baiuwaren Windische genannter Stamm, wobei es sich bei dieser Bezeichnung wohl um eine sekundäre Namensübertragung handelt, so dass die zeitgenössische Latinisierung als Veneti, Vineti, Vinedi erklärbar ist. Ihre wahrscheinlich vom besiedelten Land (*car = Felsen) herrührende Eigenbezeichnung war Karantanen; 631 wird in der Fredegar-Chronik Karantanien als marcha Vinedorum (‚Mark der Wenden/Windischen‘) genannt. Seine Bewohner gehören zu den Vorfahren der heutigen Slowenen, wie sie etwa seit dem 16. Jahrhundert heißen.
Die deutsche Eigenbezeichnung der alteingesessenen Slawen in der (brandenburgischen) Niederlausitz ist Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen. Während die DDR die einheitlichen Bezeichnungen Sorben für die Slawen der Nieder- und Oberlausitz propagierte, verstehen sich viele Niederlausitzer als Wenden in Abgrenzung zu den Sorben in der (sächsischen) Oberlausitz. In diesem Sinne wird auch die slawische Sprache in der Niederlausitz als Wendisch oder Niedersorbisch bezeichnet, von der sich das (Ober-)Sorbische in der Oberlausitz unterscheidet.
Geschichte
Seit dem späten 6. Jahrhundert und im 7. Jahrhundert wanderten Slawen in die oben genannten Gebiete der Germania Slavica ein. Dabei wurden in der Zeit um 600 und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhundert zunächst die Gebiete entlang der Elbe und unteren Saale aufgesiedelt. Ab dem Ende des 7. Jahrhunderts und verstärkt im 8. Jahrhundert erfolgte die Besiedlung der nördlich davon liegenden Regionen bis zur Ostsee. Zu einer Herausbildung von „Stämmen“ und „Stammesverbänden“ (Ethnogenese) kam es erst in Folge der Landnahme in den neu erschlossenen Siedlungsräumen. Einen Höhepunkt der westslawischen Entwicklungsgeschichte stellt die frühe „Staatsbildung“ der Abodriten im Raum des heutigen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburgs im 11. Jahrhundert dar. Mit Dänen und Deutschen kämpften die Slawen um die Vorherrschaft im südlichen Ostseeraum (etwa im Wendenkreuzzug) und unterlagen schließlich. Auch auf den dänischen Inseln Lolland und Falster gab es slawische Siedlungen.
Im Laufe der mittelalterlichen Ostkolonisation ab dem 11. Jahrhundert, verstärkt aber erst im 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert, kam es zu einer Verschmelzung der Elbslawen mit den neuzugewanderten deutschen Siedlern und zur Herausbildung von sogenannten „deutschen Neustämmen“ der Brandenburger, Mecklenburger, Pommern, Schlesier und Ostpreußen (Die Ostpreußen sind jedoch nicht aus Deutschen und Wenden, sondern aus Deutschen, den baltischen Pruzzen, Litauern und den polnischen Masowiern entstanden). Die westslawischen Sprachen und Dialekte verschwanden jedoch nicht plötzlich und nicht überall im Deutschen Reich, sondern wurden in einem jahrhundertelangen Prozess der Germanisierung – nicht selten durch Restriktionen (Gebrauchsverbote) – zurückgedrängt. Im 15. Jahrhundert wurde der Gebrauch der wendischen Sprache auf den Gerichten in Anhalt untersagt, diese jedoch im Alltag weiter verwendet. Noch Martin Luther schimpfte über „wendisch sprechende“ Bauern in der Gegend von Wittenberg. In einigen Gebieten wie im niedersächsischen Wendland (siehe auch Drawehn) oder in der brandenburgisch-sächsischen Lausitz konnten die Slawen ihre kulturelle Eigenständigkeit und Sprachen jedoch bis weit ins 18. Jahrhundert beziehungsweise bis heute bewahren.
„Schwebendes Volkstum“ nach 1945
Ein recht widersprüchliches Schicksal hatten die Bevölkerungsteile, die aus den deutschen Ostgebieten nach 1945 (im südlichen Ostpreußen, Ostpommern und in Oberschlesien) vertrieben wurden. Sie sind nach 1945 teilweise im polnischen Volk aufgegangen (Masuren, Schlesier), teilweise mit den anderen Bewohnern in den Westen geflüchtet oder später ausgesiedelt worden und dann in der deutschen Bevölkerung aufgegangen, haben zu ihrer eigenen Identität gefunden (Kaschuben in den ostpommerschen Landkreisen Bütow und Lauenburg) oder aber definieren sich nunmehr – sich der Polonisierung widersetzend – als deutsche Minderheit, mitunter auch einfach als „Schlesier“. Die Wissenschaft hatte diesen Zustand der nichteindeutigen Volkszugehörigkeit früher „schwebendes Volkstum“ genannt[1][2][3]: Diese Menschen waren der Abstammung nach eher Slawen, bedienten sich aber nur noch teilweise der slawischen Sprache (oft nur als „Haussprache“), fühlten sich aber eher als Deutsche. Nach 1945, als die deutsche Provinz Pommern östlich der Oder an Polen fiel, sollten ihre Nachfahren zunächst „polonisiert“ (als eigentliche Slawen ins polnische Volk integriert) werden. Da sie sich dem aber widersetzten, weil sie sich inzwischen längst als Deutsche fühlten, ließ man sie schließlich in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen.
Geschichtsschreibung
Geschichtliches über die Wenden ist bereits von zeitgenössischen Chronisten aufgeschrieben worden, insbesondere von Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Helmold von Bosau und Saxo Grammaticus, allerdings nicht unter langfristiger Perspektive. Im 15. Jahrhundert waren die Wenden in die im Rahmen der deutschen Ostsiedlung gebildeten Neustämme, an deren hochmittelalterlichem Landesausbau sie teilnahmen, zwischen Elbe und Oder, Ostsee und Fläming nahezu restlos integriert. Den ersten großen Rückblick auf die insoweit abgeschlossene Geschichte der Wenden gab 1519 der Hamburger Gelehrte Albert Krantz. Der Kurztitel “Wandalia“ seiner “Beschreibung Wendischer Geschicht“ zeigt, dass er im Rückgriff auf antike römische Schriftsteller die Wenden irrigerweise für die Nachkommen der Vandalen (nicht der Veneter) hielt, also eines ostgermanischen Stammes; allerdings war diese falsche Gleichsetzung bereits im Mittelalter gängig gewesen. Der auch in Lübeck tätig gewesene Staatsmann Krantz begann sein Werk mit den Worten:
„In diesem Strich deß Wendischen Lands Seewärts, an den die Wenden (welche die unserigen auch Sclauen heissen) vor Jahren und jetzt die Sachsen bewohnen, haben ehemals schöne herrliche Städte gelegen, deren Macht so groß gewesen, daß sie auch den gewaltigen Königen von Dennemarck offtmals zu schaffen gegeben, die nun theils gantz umbgekehret, theils aber wie sie außgemergelt zu geringen Flecken und Vorwercken seyn gemacht worden. Gleichwol seyn unter Regierung der Sachsen, an deren stadt andere, so Gott lob jetzt in vollem Reichthumb und Macht stehen, erbawet, die sich auch deß alten Nahmens dieser Länder nicht schämen und daher noch heutiges Tages die Wendischen Städt heissen. Umb deren willen bin ich desto williger gewesen, diese Wendische Historien zu schreiben. Unnd will nunmehr hinfort anzeigen, was diese Nation vor vndenklichen Jahren für Thaten außgerichtet, was für Fürsten darinn erzogen und geboren vnnd was noch jetzunder für schöne Städte in dieser gegend an der See vorhanden.“
– Albert Krantz Wandalia
Im “V. Capitel“ fährt er fort:
„Nach dem die Sachsen diese Wendische länder unter sich vnnd in die eusserste Dienstbarkeit gebracht, ist dieser Nahme dermassen verächtlich, daß, wenn sie erzürnen, einen der Leibeigen vnd ihnen stets vnter den Füssen ligen muß, anderst nicht denn einen Sclauen schelten. Wenn wir aber vnser Vorfahren Geschichte vnd Thaten vns recht zu gemüht führen vnd erwegen, werden wir vns nicht für ein Laster, sondern für eine Ehre zu ziehen, daß wir von solchen Leuten hergeboren.“
– Albert Krantz Wandalia
Krantz bezieht sich immer wieder auf die bekanntesten Chronisten Adam, Thietmar, Helmold und Saxo, wobei er vor allem das Rühmliche hervorhebt, zum Beispiel die von Adam geschilderte Pracht von Vineta. Das Heidentum der Slawen erwähnt er zwar auch, aber ohne die bei den Chronisten übliche Abscheu, denn für Krantz sind die Wenden ja ursprünglich ein Stamm der Germanen gewesen, die ebenso heidnisch waren. In ihrem Kampf gegen das Reich unterscheiden sich für ihn die Wenden nicht von den Dänen. Krantz behandelt alle slawischen Völker Europas, aber im Mittelpunkt seines Interesses steht das Land der Obotriten, auf dem das „Wendische Quartier“ der Hanse entstand. Auch auf die Mark Brandenburg geht er ein („Die Marck Brandenburg ist der vornembsten theile einer mit von den Wendischen landen“), zunächst auf den markgräflichen Besitz auf dem Westufer der Elbe:
„Vnd will ich erachten, daß zu den zeiten der dreyer Ottonum die Sachsen nach außtreibung der Wenden diese Länder albereit innegehabt. Denn auch Keiser Heinrich, Ottonis des grossen Vater, hat die eroberte Stadt Brandenburg zu einer Sächsischen Colonien gemachet vnnd dahin einen Marggraffen verordnet, dessen Nachkömmlinge einen herrlichen Tittel von ihm auff sich gestammet. […] Wie nun die Sachsen wiederumb sich gesterckt [nach dem Slawenaufstand 983], haben sie durch beider Herren Hertzogen Heinrich und Marggraf Albrechten macht den mehrer theil der Wenden erschlagen vnnd die vbrigen vertrieben.“
– Albert Krantz Wandalia
Die märkischen Geschichtsschreiber Johann Christoph Bekmann (1641–1717) und Jacob Paul von Gundling (1673–1731) haben in ihren Geschichtswerken „Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg“ beziehungsweise „Leben und Thaten des Herrn Albrechten des Ersten, Markgrafen zur Brandenburg“ ausdrücklich Bezug genommen auf den „berühmten Skribenten Crantzius“, haben aber dessen Sicht auf die Wenden nichts qualitativ Neues hinzugefügt. Alle drei kannten die für die Entstehung der Mark Brandenburg wichtigste Quelle (Heinrich von Antwerpen, etwa 1150 bis 1230) nur in Bruchstücken ohne Kenntnis der Zusammenhänge und des Autors.
Dies war auch der Kenntnisstand Fontanes, als er 1873 im Band „Havelland“ seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ das Kapitel schrieb: „Die Wenden und die Kolonisation der Mark durch die Zisterzienser.“ Wie auch Bekmann und Gundling übernahm er von Krantz die Stichworte „Ermordung und Vertreibung der Wenden durch die Sachsen“ und „Kolonie“ („Ostkolonisation“). Ohne die Quelle Heinrich von Antwerpen (und die heutigen Forschungsergebnisse) war ihnen nicht oder nicht ausreichend bewusst, dass Albrechts Zeitgenossen Pribislaw-Heinrich von Brandenburg und Jaxa von Köpenick bereits seit Geburt Christen waren, wie nahezu alle slawischen Fürsten dieser Zeit. Auch war ihnen der bereits zu Beginn der Regierungszeit von Pribislaw abgeschlossene Erbvertrag unbekannt. Die beiden klassischen Topoi der Geschichtsschreibung über die Wenden in der Mark Brandenburg, nämlich „blutiger Kampf“ und „Christianisierung“ haben daher nicht die Bedeutung, die die heutige Populärliteratur ihnen noch immer beimisst. Der Erbvertrag mit Pribislaw und das Christentum von Jaxa werden zwar inzwischen korrekt berichtet, ohne aber das Gesamtbild der Wenden als kampfwütige Heiden ohne Kultur (Fontane: „Unkultur“[4]) zu korrigieren. Dies ist um so erstaunlicher, als der Hamburger Staatsmann Krantz, der am Anfang der Geschichtsschreibung über die Wenden stand, es sich als Ehre anrechnete, von den Wenden abzustammen.
Siedlungsformen
Typisch für die Siedlungsform der Wenden sind Rundlingsdörfer. Die im Mittelalter während der Binnenkolonisation entstandene Dorfform weist eine hufeisenförmige Anordnung der Bauernhäuser und Grundstücke auf. Der Verbreitungsraum des Rundlings erstreckt sich streifenförmig zwischen der Ostsee und dem Erzgebirge in der damaligen Kontaktzone zwischen Deutschen und Slawen. Am besten erhalten haben sich Rundlingsdörfer in der wirtschaftschwachen Region des hannoverschen Wendlands. Die slawischen Siedlungsformen vor den Rundlingen sind bisher nicht ausreichend archäologisch erforscht.[5]
Religion und Kultur der Elbslawen
Bis in das 11. und 12. Jahrhundert hinein waren die nördlichen Elbslawen von nichtchristlichen Kulten dominiert. Während zunächst Heilige Haine und Gewässer als Kultorte verehrt wurden, bildeten sich im 10. und 11. Jahrhundert allmählich ein Priestertum und Kultstätten heraus, die oft auch überregionale Bedeutung hatten. Beispiele sind hier die Tempelburgen in Kap Arkona (Rügen) und Rethra. Wichtige slawischen Gottheiten waren Radegast und Triglaw. Die Götter der Götterwelt anderer slawischer Völker existierten auch hier, jedoch bildeten sich stärker als anderswo Stammesgottheiten heraus. Oftmals veränderten alte Götter ihre Bedeutung.
Die Slawen im Elbe-Saale-Gebiet und in der Lausitz gerieten schon früher unter den Einfluss der christlichen Kirche. 968 wurde das Erzbistum Magdeburg mit den Suffraganen Zeitz, Merseburg und Meißen eingerichtet und die Christianisierung weiter vorangetrieben.
Sprachen und Dialekte der Elbslawen
Jahrhundertelang war das Deutsche Reich östlich von Elbe und Saale zweisprachig. Neben den deutschen Dialekten wurden noch lange Zeit westslawische Sprachen und Dialekte gesprochen. Im 15. Jahrhundert starb der Dialekt der Ranen auf der Insel Rügen aus, erst im 18. Jahrhundert der polabische der Drevanen/Drevänopolaben im Hannoverschen Wendland. Der protestantische Teil der Kaschuben, die Slowinzen, die in Hinterpommern lebten, verloren ihr kaschubisches Idiom etwa um 1900. Die kaschubische Sprache wird allerdings noch heute weiter östlich im ehemaligen Westpreußen und der jetzigen polnischen Woiwodschaft Pommern gesprochen. Neben dem Kaschubischen ist die sorbische Sprache der Lausitzer Sorben die einzig noch verbliebene Sprache der Wenden. Die Zahl der Sorbischsprecher schätzt man heute auf 20.000 bis 30.000 Menschen, um 1900 noch etwa 150.000. Kaschubisch wird heute von 50.000 Menschen als Alltagssprache benutzt.
Elbslawische Stämme und Stammesverbände
In Quellen aus dem ostfränkisch-Deutschen Reich werden eine große Zahl von Stämmen und Stammesverbänden insbesondere seit dem 8. Jahrhundert genannt. Die größten Verbände waren die der Abodriten, Wilzen und die Sorben (von Nord nach Süd). Jedoch bleibt häufig unklar, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Es dürfe sich jedoch nicht um festgefügte, homogene und scharf umrissene Gruppierungen gehandelt haben, wie im 19. und 20. Jahrhundert zumeist angenommen wurde. Vielmehr ist von recht mobilen Gruppierungen auszugehen, die in ihrer Zusammensetzung und Abgrenzung relativ flexibel waren.
In der Beschreibung des so genannten Bayerischen Geographen (Geographus Bavarus) aus der Mitte des 9. Jahrhunderts mit späteren Überarbeitungen und Zusätzen werden die zu dieser Zeit bekannten Stämme und die Zahl der ihnen zugehörigen civitates – Siedlungskammern mit einer zentralen Burganlage und zugehörigen Siedlungen und kleinere Befestigungen – genannt (Völkertafel von St. Emmeram).
- Abodriten/Obodriten mit mehreren Teilstämmen; zwischen Kieler Förde und mittlerer Warnow
- Obodriten im engeren Sinne von der Wismarer Bucht bis südlich des Schweriner Sees, Hauptburgen Dobin, Mecklenburg, Schwerin)
- Wagrier in Ostholstein, Hauptburg: Starigard/Oldenburg in Holstein
- Polaben zwischen Trave und Elbe, Lübeck
- Warnower an der oberen Warnow und Mildenitz
- Linonen an der Elbe um Lenzen (Lunzini)
- Wilzen' (seit dem Ende des 10. Jahrhundert auch Liutizen, Lutizen) mit vier Teilstämmen:
- Kessiner an der unteren Warnow
- Zirzipanen zwischen Recknitz, Trebel und Peene
- Tollenser östlich und südlich der Peene am Tollensesee
- Redarier südlich und östlich des Tollensesees und an der oberen Havel
- Rujane/Ranen auf Rügen
- Ukranen an der Uecker
- Mürizer an der Müritz
- Dosane an der Dosse
- Zamzizi im Ruppiner Gebiet
- Recanen an der oberen Havel
- Drevanen im Hannoverschen Wendland
- Bethelici/Belczem
- Smeldinger
- Morizani (nördlich der Saalemündung an der Elbe) mit 11 civitates
- Heveller/Stodoranen im mittleren Havelgebiet und Havelland mit 8 civitates
- Sprewanen an der unteren Dahme und Spree
- Sorben im Elb-Saale-Gebiet mit mehreren Teilstämmen wie Colodici und Siusili beziehungsweise Kleinregionen (pagi) wie Chutici und Plisni (um Altenburg), Neletici (um Wurzen und um Torgau), Quesici/Quezizi (um Eilenburg), die aber erst im 10. Jahrhundert in den Quellen erscheinen. Das Gebiet der Sorben umfasste laut dem Bayrischen Geographen etwa 50 civitates.
In den mittelalterlichen Quellen werden deutlich von den Sorben geschieden die
- Daleminzier/Glomaci an der Elbe und in der Lommatzscher Pflege
- Nisanen um Dresden
- Milzener in der Oberlausitz rund um Bautzen
- Besunzanen um Görlitz
- Lusitzi in der Niederlausitz
Böhmen und Oberpfalz
In der Oberpfalz ist der Name „Windisch“ nicht nur als Familienname anzutreffen, sondern ist auch Bestandteil des Namens der Stadt Windischeschenbach. Bis nach Slowenien (Windischgrätz), Böhmen (Windisch Kamnitz) und in die Oberpfalz waren während der großen Völkerwanderung heimatsuchende „Windische“ (die Wenden) gekommen und hatten ein nur spärlich besiedeltes Gebiet angetroffen. Bei ihnen wird die Problematik der Mehrdeutigkeit der Bezeichnung „Wenden“ besonders deutlich, weil sie weder zu den Elbslawen im engeren Sinne noch zu den Nordwestslawen im weiteren Sinne zu rechnen sind.
Ortsnamen
Folgende Orte und Ortsteile[6] führen das Wort Wenden und Wendisch, aber auch Windisch im Namen und nehmen – wenigstens teilweise – damit auf einen wendischen Ursprung Bezug. Nicht in jedem Falle ist bei diesen Ortsnamen sicher davon auszugehen, dass die Orte wendische Siedlungen waren. Einige liegen dafür allerdings zu sehr im deutschen Kerngebiet westlich der Elbe; ihre Ortsnamen dürften sich daher vom prähistorischen Bachnamen wend ableiten.[7] Mit dem Zusatz wendisch kann auch eine Richtung beschrieben worden sein.
- diverse Orte namens Wendorf, Wenddorf und Wendtorf
- Wendeburg bei Braunschweig, Niedersachsen
- Wehnde im Eichsfeld, Thüringen
- Wenden (Sauerland) im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
- Wenden, in Ebhausen, Baden-Württemberg
- Wenden in Stöckse, Niedersachsen
- Wenden in Braunschweig, Niedersachsen
- Wendenborstel in Steimbke, Niedersachsen
- Wendehausen im Eichsfeld, Thüringen
- Wendessen in Niedersachsen
- Wendewisch in Niedersachsen
- Wendezelle in Niedersachsen
- Wendhausen in Lehre, Niedersachsen
- Wendisch Baggendorf in Mecklenburg-Vorpommern
- Wendischbaselitz in Sachsen (gehört noch heute zum sorbischen Siedlungsgebiet)
- Wendisch Buckow (1937–1945: Buckow (Pom.), Kreis Schlawe) in Pommern (Polen)
- Wendisch Buckow (1937–1945: Buchenstein, Kreis Stolp) in Pommern (Polen)
- Wendischbrome in Jübar in Sachsen-Anhalt
- Wendisch Evern in Niedersachsen
- Wendischhorst in Dähre in Sachsen-Anhalt
- Wendisch Karstnitz (1937–1945: Ramnitz, Kreis Stolp) in Pommern (Polen)
- Wendisch Musta (1937–1945: Birkfähre, Kreis Rothenburg) in Schlesien (Polen)
- Wendisch Ossig (1937–1945: Warnsdorf (Niederschlesien), Kreis Görlitz) in Niederschlesien (Polen)
- Wendisch Plassow (1937–1945: Plassenberg, Kreis Stolp) in Pommern (Polen)
- Wendisch Pribbernow in Pommern (Polen)
- Wendisch Priborn in Mecklenburg-Vorpommern
- Wendisch Puddiger (1937–1945: Puddiger, Kreis Rummelsburg) in Pommern (Polen)
- Wendisch Rambow, ein Dorf bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern
- Wendisch Rietz in Brandenburg
- Wendisch Sagar (1937–1945: Bobertal, Kreis Crossen (Oder)) in Brandenburg (Polen)
- Wendisch Silkow (1937–1945: Schwerinshöhe, Kreis Stolp) in Pommern (Polen)
- Wendisch Tychow (1937–1945: Tychow, Kreis Schlawe) in Pommern (Polen)
- Wendisch Waren in Mecklenburg-Vorpommern
- Wendland in Niedersachsen
- Wendschott in Wolfsburg, Niedersachsen
- Wendsee in Brandenburg an der Havel (Brandenburg)
- diverse Orte namens Wentorf
- Windehausen, Nordthüringen
- Windischenbach, Gemeinde Pfedelbach, Baden-Württemberg
- Windischenbernsdorf, Stadtteil von Gera, Thüringen
- Windischengrün, Ortsteil von Schauenstein, Bayern
- Windischenlaibach, Ortsteil von Speichersdorf in Oberfranken, Bayern
- Windischeschenbach, Oberpfalz in Bayern
- Windischgaillenreuth, Ortsteil von Ebermannstadt, Oberfranken, Bayern
- Windischholzhausen, Ortsteil Erfurt, Thüringen
- Windisch-Marchwitz in Schlesien
- Windisch Kamnitz im Sudetenland
- Windisch Proben in der Slowakei
Anm.: Ortsnamen auf Windisch- südlich der Donau sind dem eingangs erläuterten Siedlungsraum der Karantanen/Slowenen zuzuordnen, und nicht hier angeführt, siehe dazu Windisch (Slowenisch)
- Abtswind in Bayern
- Burgwindheim in Bayern
- Geiselwind in Bayern
- Großwenden und Klein-, Ortsteile von Großlohra im Landkreis Nordhausen, Thüringen
- Kurzewind in Bayern
- Thalwenden in Thüringen
Literatur
- Sebastian Brather: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. In: Herbert Jankuhn, Heinrich Beck u. a. (Hrsg.): Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Ergänzungsbände. 2. Auflage. 30, Walter de Gruyter Inc., Berlin, New York NY 2001, ISBN 3110170612.
- Christian Lübke: Slaven zwischen Elbe/Saale und Oder. Wenden – Polaben – Elbslaven? Beobachtungen zur Namenwahl. In: Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Nr. 41, 1991, S. 17-43.
- Christian Lübke: Die Deutschen und das europäische Mittelalter. Das östliche Europa. 1. Auflage. 2, Siedler Verlag, München 2004, ISBN 3886807606.
- Madlena Norberg: Sammelband zur sorbischen/wendischen Kultur und Identität. Sind die sorbische/wendische Sprache und Identität noch zu retten?. In: Potsdamer Beiträge zur Sorabistik. Nr. 8, Universitäts-Verlag, Potsdam 2008, ISBN 9783940793355 (PDF vom Opus- und Archivierungsdienst des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg, http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/2147/pdf/pbs08_I_bericht01.pdf, abgerufen am 28. Februar 2010).
- Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. Theiss, Stuttgart 2000, ISBN 3806215456.
- Felix Biermann, Thomas Kersting (Hrsg.): Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4. bis 7. April 2005. Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Langenweißbach 2007.
- Felix Biermann u. a. (Hrsg.): Beiträge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007. Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Langenweißbach 2009.
Frühe Werke
- Albert Krantz: Wandalia. Des Fürtrefflichen Hochgelahrten Herrn Albert Crantzii Wandalia. Oder: Beschreibung Wendischer Geschicht: Darinnen der Wenden eigentlicher Vrspuung mancherley Völcker vnd vielfaltige Verwandlungen … Daraus was sol wol in … Königreichen … Wendischer vnd anderer Nationen in Dennemarcken/ Schweden/ Polen/ Vngarn/ Böhemen/ Oesterreich/ Mährern/ Schlesien/ Brandenburg/ Preussen/ Reussen/ Lieffland/ Pommern/ Mecklenburg/ Holstein. Junge, Lübeck 1636.
- Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Die Wenden in der Mark. III, 1873.
Einzelnachweise
- ↑ Robert A. Beck: Schwebendes Volkstum im Gesinnungswandel: Eine sozial-psychologische Untersuchung. In: Schriftenreihe der Stadt der Auslandsdeutschen. Nr. 1, W. Kohlhammer, Stuttgart 1938 (http://books.google.com/books?id=YqWTGQAACAAJ&dq=schwebendes+Volkstum&lr=&ei=vT1DSuk7gZzNBNHT6UQ&hl=de).
- ↑ Walter Kuhn: „Schwebendes Volkstum“ und künftige Landgestaltung in Südost-Oberschlesien. In: Neues Bauerntum. Nr. 33, 1941, S. 26–30
- ↑ Theodor Veiter: Das Recht der Volksgruppen und Sprachminderheiten in Österreich. Mit einer ethnosoziologischen Grundlegung und einem Anhang (Materialien). Braumüller, Wien 1970, S. 83, 291, 292
- ↑ Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 2, Berlin/Weimar 1994, S. 41.
- ↑ Hardt, Matthias: Das "slawische Dorf" und seine kolonisationszeitliche Umformung nach schriftlichen und historisch-geographischen Quellen, in: Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 17/1999, S. 269-291.
- ↑ J. Leupold: Orte mit "Wendisch" im Namen. In: Wendisch Evern-Informationen. Abgerufen am 28. Februar 2010.
- ↑ Hans Bahlow: Deutschlands geographische Namenwelt : etymologisches Lexikon der Fluss- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunf. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985, ISBN 978-3-518-37721-5, S. 529.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wenden (Begriffsklärung)
(Weitergeleitet von Wendisch)
Wenden bezeichnet
slawische Völker:
- eine veraltete deutsche Bezeichnung für die slawischen Völker, siehe Slawen
- deutsche Bezeichnung für verschiedene historische westslawische Völker und Stämme, siehe Wenden
- eine deutschsprachige Eigenbezeichnung der Niedersorben, siehe Sorben
- eine veraltete österreichische Bezeichnung für Slowenen, siehe Windisch (Slowenisch)
Ortschaften und Regionen:
- die Gemeinde Wenden im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen, siehe Wenden (Sauerland)
- einen Stadtteil von Braunschweig in Niedersachsen, siehe Wenden (Braunschweig)
- einen Ortsteil der Stadt Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
- ein Dorf in der Gemeinde Stöckse im Landkreis Nienburg (Weser) in Niedersachsen
- einen Ortsteil der Gemeinde Ebhausen im Landkreis Calw in Baden-Württemberg, siehe Wenden (Ebhausen)
- den deutschen Namen eines Dorfes in Polen in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, siehe Winda
- Name der Stadt Cēsis in Lettland bis 1920
- den zwischenzeitlichen Namen der mecklenburgischen Herrschaft Werle
- den Kreis Wenden im ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
Vorgänge:
- in der Seemannssprache das Wenden eines Schiffes, siehe Wende (Segeln)
- den Richtungswechsel im Eisenbahn- und Straßenverkehr, siehe Fahrtrichtungswechsel
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wendischer Städtebund
Der Wendische Städtebund entstand 1259 zwischen Lübeck, Kiel, Wismar, Rostock und Stralsund. Er diente der Sicherung der Handelswege auf dem Land und zur See und gilt als Keimzelle sowohl des späteren wendischen Quartiers als auch der Deutschen Hanse insgesamt. Seine Wurzeln lagen im Bündnis zwischen Hamburg und Lübeck von 1230, vertraglich festgelegt 1241. Verstärkt wurde er durch das traditionell mit Hamburg verbündete Lüneburg sowie später durch die pommerschen Städte Greifswald, Stettin und Anklam. Zum Teil waren diese Städte auch im Wendischen Münzverein zusammen geschlossen.
Literatur
Philippe Dollinger: Die Hanse. 5. Auflage, Stuttgart 1998, ISBN 3520371057.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Zeeland
Zeeland (deutsch Seeland, seeländisch Zeêland) ist eine Provinz in den südwestlichen Niederlanden. Die Provinz besteht aus einer Reihe von Inseln, Halbinseln und einem Stück Festland an der Grenze zu Belgien. Der Name „Zeeland“ ist hiervon abgeleitet.
Die Inseln und Halbinseln sind:
- Zuid-Beveland (Halbinsel, zusammen mit Walcheren)
- Walcheren (Halbinsel, grenzt an Zuid-Beveland)
- Noord-Beveland (Insel)
- Tholen (Halbinsel)
- Schouwen-Duiveland (Insel)
- St. Philipsland (Halbinsel)
Der restliche Teil, der weder Insel noch Halbinsel ist, dessen einziger Landzugang bis vor kurzem über Belgien bestand, heißt Zeeuws Vlaanderen. Seit Mitte 2003 besteht mit dem Westerscheldetunnel ein weiterer Landzugang, der diesmal Zeeuws Vlaanderen direkt mit den übrigen Niederlanden verbindet. Der Tunnel führt von Terneuzen bis auf das Gebiet der Gemeinde Borsele.
Die Hauptstadt ist Middelburg. Vlissingen ist ein wichtiger Seehafen, ebenso Terneuzen. Andere Städte sind Hulst, Goes und Zierikzee. Die Einwohnerzahl beträgt 381.507.
Im größten Teil der Provinz werden Dialekte des Seeländischen gesprochen; nur in der Gemeinde Hulst hört man Ostflämisch. Auch wenn die Dialekte nicht mehr überall häufig gesprochen werden, besonders in Middelburg und Vlissingen, wird diese Sprache noch von sechzig Prozent der Bevölkerung jeden Tag benutzt.
Zeeland war seit dem Gallischen Krieg Teil des Römischen Reiches. Aus dieser Zeit stammen einige Bauwerke wie die Stele der Göttin Nehalennia, die in der Nähe des Seebades Domburg 1647 von Fischern gefunden wurde.
Eine architektonische Meisterleistung ist das Brückenbauwerk Zeelandbrug, das Schouwen-Duiveland mit Noord-Beveland verbindet. Eine Zeit lang war dies die längste Brücke der Welt.
Durch die Deltawerke mit dem monumentalen Oosterschelde-Sturmflutwehr wird die Provinz vor Hochwasser und Sturmfluten geschützt.
Geschichte
Vorgeschichte
Erste Siedlungsspuren auf Zeeland weisen in die keltische und römische Antike. Im Jahr 52 v. Chr. unterwarf Julius Caesar die Menapier, die auf dem Gebiet des heutigen Zeeland gesiedelt haben dürften. Die Gallia Belgica lag auf der Handelsroute von der Germania Inferior (vor allem: Köln) zur Britannia und war schon aus diesem Grund von einem gewissen Interesse. Ob die erste Niederlassung, von der aus dann die weitere Besiedelung Zeelands ausging, das Zeeuwsche Kastell Aardenburg war, ist allerdings unklar.
Der Nehalennia -Tempel, den man bei Colijnsplaat ausmacht, dürfte auf einen Kult hinweisen, der keltischen Ursprunges war und in der vorgefundenen Form des 2. oder 3. Jahrhunderts bereits eine Adaption darstellte. Nehalennia selbst war eine regionale Gottheit, die vor allem in frugalen und maritimen Zusammenhängen erschien und kein römisches Pendant hatte. Aus Dank für geglückte See-Handelsreisen dürften auch die gefundenen Nehalennia-Steine, von denen einige im Museum Gravensteen in Zierikzee und im Rijksmuseum van Oudheden in Leiden) zu sehen sind, aufgestellt worden sein.
Mit dem 4. Jahrhundert ging dann nicht nur das Imperium Romanum, sondern auch Zeeland im wörtlichen Sinne zunehmend unter. Das Versinken des zur Nordsee offenen Landes dürfte sich bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts hingezogen haben. Mit dem Ende des 6. Jahrhunderts wird dann schon wieder eine kleinere Handelsniederlassung auf Walcheren vermutet. Es spricht einiges dafür, dass es sich bei den neuen Siedlern nun um Friesen gehandelt hat.
Fränkische Zeit
Zwischen 688 und 695 wurden dann die niederländischen Küstengebiete von Pippin II. erobert, womit die fränkische Zeit begann. In diese Zeit fiel auch die Christianisierung Zeelands. 690 ging bei Zoutelande der irische Mönch Willibrord (658-739) an Land. Der heute noch an vielen Orten gewürdigte Mönch war berüchtigt für sein hartes Vorgehen gegen die sogenannten Heiden: Teile eines von Willibrord selbst zerschlagenen heidnischen Heiligtums sollen noch heute im Sockel des Altares der Kirche zu Westkapelle enthalten sein. 695 wurde Willibrord dann Bischof von Utrecht. Der früh heilig gesprochene und von Alkuin in der Vita Sancta Willibrordi um 786 und dann von Theofried um 1104 beschriebene Kleriker verstarb 739 in dem von ihm in Echternach (Luxemburg) gegründeten Kloster.
Nachdem schon unter Karl dem Großen (768-814) und Ludwig dem Frommen (814-840) vermehrt Einfälle der Normannen entlang der großen Flüsse, vor allem aber des Rheins verzeichnet werden konnten, kam es mit dem beginnenden 9. Jahrhundert dann auch vermehrt zu Einfällen in Zeeland. Über den Eindruck, den die nach sagenhaften Meeresungeheuern und Drachen geschnitzten Bugpartien der Wikingerboote auf die einfache Bevölkerung machten, sind für Zeeland und auch anderen Orts eindrucksvolle Meldungen überliefert.
841 belehnte der amtsfrische Lothar sogar den Wikinger Heriold mit Walcheren – vielleicht in der Hoffnung, auf diese Weise weiteren Angriffen mit der Verlagerung zu einem innernormannischen Problem ausweichen zu können. Die Belehnung, die darauf hinweist, dass sich zu jener Zeit bereits Normannen auf Zeeland angesiedelt hatten, scheint aber in keiner Hinsicht den gewünschten Erfolg erbracht zu haben. Auf der einen Seite dürfte die Herrschaft der Normannen innerhalb der autochthonen Bevölkerung keine Akzeptanz gefunden haben, auf der anderen Seite ließen sich wohl auch die Einfälle anderer Normannen auf diese Weise nicht verhindern – denn von zirka 880 bis 890 entstanden über Zeeland verteilt gegen derartige Überfälle überall Fluchtburgen: Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen), Oost-Souburg bei Vlissingen, Middelburg, Domburg und Burgh bei Burgh-Haamstede sind aus derartigen Befestigungen hervorgegangen. Middelburg zeigt bis heute in seinem Grundriss die sternförmige Wehranlage. In Domburg lässt sich die rekonstruierte Burg besichtigen. Dass diese Ringwall-Burgen, die vorerst nur als Rückzugsmöglichkeit bei Angriffen genutzt, nicht aber bewohnt wurden, die Wikinger beeindruckt haben dürften, mag Trelleborg auf Sjaelland in Dänemark illustrieren, in dem sich eine normannische Kopie dieses Burgstyps findet. Die Überfälle auf Zeeland endeten aber erst etwa hundert Jahre später, um 1000.
Mittelalter, Frühe Neuzeit
Seit dem Mittelalter ist der Kampf gegen das Wasser ein elementarer Bestandteil der Geschichte von Zeeland. Gewinn und Verlust von Land wechselten einander ab. Fast die komplette Provinz (außer den Dünen) liegt unter dem Meeresspiegel. Die Landschaft ist ein Flickenteppich aus Poldern und Deichen. Die vielen kleinen Inseln sind langsam zu den größeren (Halb-)Inseln, die heute Bestand haben, zusammengewachsen.
Im 16. und 17. Jahrhundert hatte Zeeland eine bedeutende wirtschaftliche Stellung innerhalb der Niederlande inne. Einige Städte wie Middelburg, Veere oder Zierikzee waren bedeutsame Handelsstädte. In diesen Städten sind immer noch viele Häuser, Kirchen oder andere Zeugen der seeländischen Blütezeit zu finden. Im 18. Jahrhundert sank die wirtschaftliche und politische Bedeutung Zeelands immer mehr. Zum einen versandeten viele kleinere Flüsse, was die Schifffahrt stark behinderte. Zum anderen hatten die Französische Revolution und Napoleons Feldzüge Anfang des 19. Jahrhunderts auch Auswirkungen auf Zeeland. Die Niederländische Ostindien-Kompanie, die einen Sitz in Middelburg hatte, wurde 1798 liquidiert.
Moderne
Mit der Ausbreitung des Eisenbahnnetzes in den Niederlanden wurden Zuid-Beveland und Walcheren im 19. Jahrhundert mittels Dämmen mit dem Festland der Provinz Nordbrabant verbunden. Seit 1870 sind Middelburg, Vlissingen und Goes an die Eisenbahnlinie nach Bergen op Zoom und Roosendaal angebunden.
Im Zweiten Weltkrieg wurde auch Zeeland von deutschen Truppen besetzt und mit Befestigungsanlagen des Atlantikwalls überzogen. Alliierte Truppen befreiten den größten Teil der Provinz im Oktober und November 1944 während der Schlacht an der Scheldemündung.
In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 wurde Zeeland von der Hollandsturmflut getroffen. Über 1800 Menschen starben bei der größten Naturkatastrophe der Nachkriegszeit in den Niederlanden. Um solch eine Katastrophe in der Zukunft zu verhindern, wurden ab 1960 die Deltawerke gebaut. Ein Nebeneffekt der Abriegelung der Nordsee von den kleinen Seitenarmen und Flussmündungen war, dass die Verbindungen der Provinz mit dem Rest der Niederlande wesentlich verbessert wurden. 1997 wurde das große Projekt mit der Eröffnung des Maeslant-Sturmflutwehrs, das allerdings nicht zur Provinz Zeeland gehört, fertiggestellt.
Die wirtschaftliche und soziale Struktur der Inseln Zeelands wurde durch die festen Verbindungen mit dem Land stark verändert. Die ehemals abgelegenen Gebiete sind von der Randstad aus nun binnen einer Stunde zu erreichen. Der Tourismus ist stark angestiegen.
Sehenswürdigkeiten
Eine Vielzahl der Sehenswürdigkeiten der Provinz konzentriert sich auf die größeren Städte.
In Middelburg lohnt ein Besuch der Abtei "Onze-Lieve-Vrouwe" und des Stadhuis (Rathaus). Auch der Erlebnispark "Miniatuur Walcheren", in dem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Halbinsel Walcheren im Maßstab 1:20 nachgebaut wurden, ist einen Abstecher wert. Das "Zeeuws Museum" (Museum der Provinz Zeeland) befindet sich ebenfalls in Middelburg.
Das Städtchen Veere kann mit einer jahrhundertealten Stadtkulisse aufwarten. Viele der Häuser stammen aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, als der Handel mit schottischer Wolle florierte.
Die Stadt Vlissingen, die an der Mündung der Westerschelde in die Nordsee liegt, ist schon aufgrund ihrer Lage eine Sehenswürdigkeit. Vom Boulevard aus kann man den regen Schiffsverkehr von und nach Antwerpen beobachten. Im "Arsenaal", einem modernen Erlebniskomplex, gibt es verschiedene Stationen, an denen das Meer einem nähergebracht wird. Teil dieses Komplexes ist das "Kraaiennest", ein 65 Meter hoher Aussichtsturm.
Die Altstadt van Goes steht seit den 1970er Jahren unter Denkmalschutz. Es gibt viele historischen Gebäude in die Innenstadt, ebenso viele Laden.
Die Altstadt von Zierikzee steht seit den 1960er Jahren unter Denkmalschutz. Knapp 600 Gebäude sind als erhaltenswert gekennzeichnet.
Die größte technische Sehenswürdigkeit in Zeeland ist das Sturmflutwehr der Deltawerke. Im Volksmund spricht man auch vom "Achten Weltwunder". Auf der künstlich aufgeschütteten Insel "Neeltje Jans" gibt es ein Besucherinformationszentrum, das sich im Laufe der Jahre zu einem Vergnügungspark gewandelt hat.
In Hulst in Zeeuws-Vlaanderen sind die etwa vier Kilometer langen Stadtwälle samt den Stadttoren aus dem 16. und 18. Jahrhundert komplett erhalten geblieben.
Wirtschaft
Im Jahr 2006 lag das regionale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, bei 116,8 % des Durchschnitts der EU-27.[3] Die Arbeitslosenrate lag 2005 bei 3.3%[4].
Hauptwirtschaftszweige in Zeeland sind neben Ackerbau und Obstanbau auch die Chemieindustrie (im Sloe-Haven und in Terneuzen) sowie Fischerei und Miesmuschelzucht.
Verkehr
Straße
Die einzige Autobahn in Zeeland ist die A58, die Vlissingen, Middelburg und Goes mit Bergen op Zoom verbindet. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden viele Bauwerke geschaffen, die die Inseln untereinander und mit dem Festland verbinden. Der Westerscheldetunnel verbindet Zeeuws-Vlaanderen mit Zuid-Beveland. Die Zeelandbrug, die einige Zeit die längste Brücke Europas war, sowie die Straße über dem Oosterscheldesturmflutwehr verbinden Noord-Beveland mit Schouwen-Duiveland. Weitere Wege, die durch die Deltawerke entstanden sind, sind der Oesterdam und der Philipsdam.
Bahn
Die 1870 eröffnete Eisenbahnlinie von Vlissingen über Middelburg und Goes nach Roosendaal ist auch heute noch die einzige Eisenbahnlinie für Personenverkehr in Zeeland. Einmal stündlich gibt es eine Direktverbindung nach Rotterdam, Den Haag, dem Flughafen Schiphol und Amsterdam. Eine Güterzugstrecke zweigt bei Goes in Richtung Sloe-Haven ab. In Zeeuws-Vlaanderen gibt es eine Güterzuglinie von Terneuzen über Sas van Gent nach Zelzate in Belgien. Eine Museumseisenbahn verbindet im Sommerhalbjahr Goes mit Hoedekenskerke.
Siehe auch: Liste der Bahnhöfe in Zeeland
Bus
Nach der Privatisierung der niederländischen Busunternehmen übernahm Connexxion die Linien in der Provinz Zeeland. In Zeeuwsch-Vlaanderen wird der öffentliche Nahverkehr zum Teil von Veolia Transport bewerkstelligt.
Fähre
Nach der Abschaffung der Autofähren gibt es in Zeeland nur noch Fähren, die als Fußgänger, Radfahrer oder mit dem Motorroller (bis 50 cc) benutzt werden können. Die einzige Fähre, die das ganze Jahr verkehrt, ist die Verbindung Vlissingen - Breskens. Die Fähren, die nur im Sommer verkehren, dienen hauptsächlich dem Tourismus.
Sonstiges
- Neuseeland: Als Abel Tasman 1642 auf der Suche nach dem „Großen südlichen Land“ als erster Europäer Neuseeland entdeckte, glaubte er ein weiteres Stück Küste von Staten Landt gefunden zu haben. Als eine Expedition unter Hendrik Brouwer ein Jahr später feststellte, dass der von Tasman besuchte Küstenstreifen nicht zu Staten Landt gehörte, wurde das Land Nova Zeelandia (lateinisch) oder Nieuw Zeeland (niederländisch) genannt, nach der niederländischen Provinz Zeeland.
Persönlichkeiten
- Jan Peter Balkenende (* 1956), Politiker (CDA)
- Danny Blind (* 1961), ehemaliger Fußballspieler
- Wim van Hanegem (* 1944), ehemaliger Fußballspieler; Fußballtrainer
- Cees Priem, ehemaliger Radrennfahrer
- Michiel de Ruyter (1607–1676), Admiral der niederländischen Marine
- Leo van de Ketterij, ehemaliger Gitarrist der Band Shocking Blue
- Carolyn Lilipaly, ehemalige Moderatorin des Senders MTV Central
- Theofiel Middelkamp (1914–2005), ehemaliger Radrennfahrer
- Jan Raas (* 1952), ehemaliger Radrennfahrer
- Annie M. G. Schmidt (1911–1995), Schriftstellerin und Journalistin, Kinderbuchautorin
Weblinks
- xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht.
- Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite
Quellen
- ↑ Bevölkerungsstatistik, 1. März 2010 – Centraal Bureau voor de Statistiek, Niederlande
- ↑ Drie grootste kernen obv gegevens gemeente
- ↑ Eurostat Pressemitteilung 23/2009: Regionales BIP je Einwohner in der EU27 (PDF-Datei; 360 kB)
- ↑ www.xxx
- xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Bruno Warendorp
Bruno Warendorp (* wohl 1255; † 29. Juni 1341 in Lübeck) war ein Lübecker Bürgermeister des beginnenden 14. Jahrhunderts.
Warendorp[1] wurde 1301 zum Bürgermeister der Stadt gewählt und hielt dieses Amt 40 Jahre inne. Sein Haus befand sich in der Mengstraße 14. Er wurde 1307 als Pächter der städtischen Wiesen an der Trave genannt und war Eigentümer des Gutes Israelsdorf. Das Dorf Mallentin schenkte er 1331 seinem Sohn. Dem Lübecker Dom stiftete er 1332 eine Präbende. Gemeinsam mit seiner Frau Hellenburgis († 1316) wurde er in der von ihm errichteten Warendorpkapelle an der Südseite des Doms unter einer heute nicht mehr erhaltenen Bronzeplatte begraben.
Literatur
Rafael Ehrhardt: Familie und Memoria in der Stadt. Eine Fallstudie zu Lübeck im Spätmittelalter. Dissertation, Göttingen 2001. Volltext mit einer Prosopografie der Ratsfamilien von Alen, Darsow, Geverdes, Segeberg und Warendorf.
Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie, Lübeck 1925, Nr. 268.
Johannes Baltzer und Friedrich Bruns: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Herausgegeben von der Baubehörde. Band III: Kirche zu Alt-Lübeck. Dom. Jakobikirche. Ägidienkirche. Verlag von Bernhard Nöhring: Lübeck 1920, S. 71 ff. (Kapelle); S. 233, 237/239 (Grabsteine und Bronzegrabplatte). Unveränderter Nachdruck 2001: ISBN 3-89557-167-9
Einzelnachweise
- ↑ Siehe Ehrhardt, S. 170ff. Nicht zu verwechseln mit dem späteren 1369 verstorbenen Bruno von Warendorp
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Kölner Konföderation
Der Hansetag in Köln beschloss am 19. November 1367 die Kölner Konföderation als Bündnis im Krieg gegen Dänemark (und Norwegen). Es waren auch drei nichthansische Städtegruppen Mitglied der Confederatio: niederländische Städte, Holland (Amsterdam) und Seeland (Priel).
Der Verbund wurde für die Dauer des Krieges plus zusätzliche drei Jahre geschlossen und wurde nach dem Frieden von Stralsund bis 1385 stetig verlängert. Beschlossen wurde u. a. die Einführung eines „Pfundzolls“ (Gewichtsabgabe) für Ein- und Ausfuhr von Waren und eine Vereinbarung über die Anzahl der aufzustellenden Kriegsschiffe.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Friede von Stralsund
Der Friede von Stralsund wurde am 24. Mai 1370 zwischen dem dänischen König Waldemar IV. und dem Bündnis der Hansestädte in der deutschen Hansestadt Stralsund geschlossen.
Er beendete den Zweiten Hanse-Dänemark-Krieg zwischen den beiden Parteien und damit einen Konflikt, der mit dem Ersten Hanse-Dänemark-Krieg nach der dänischen Eroberung der Hansestadt Visby auf der Insel Gotland im August 1361 begonnen hatte und nur durch eine kurze Friedensphase von 1365 bis 1367 unterbrochen wurde.
Vorgeschichte
Der dänische König Waldemar IV. hatte sein Land von der Fremdherrschaft durch Holstein, Mecklenburg und Schweden befreit und damit auch den Handel auf der Ostsee wieder sicherer gemacht. Mit der Eroberung Schonens und der Brandschatzung Visbys (Gotland) und der Wegnahme bedeutender Privilegien waren die Hansestädte in ihrem Handel stark eingeschränkt. Sie erklärten in Verhandlungen in Greifswald unter Leitung des Lübecker Bürgermeisters Johann Wittenborg, an denen auch der Deutsche Ritterorden sowie Gesandte Schwedens und Norwegens teilnahmen, den Dänen im September 1361 den Krieg.
Zur Vorbereitung erhoben die beteiligten Städte einen Pfundzoll zur Finanzierung des Krieges. Die Hansen und die Könige sollten jeweils Schiffe und 2000 bewaffnete Männer stellen. Vertraglich fixiert waren auch die Ziele der Kampfhandlungen: Schonen und Gotland sollten an Schweden fallen, die hansischen Privilegien wiederhergestellt und den Städten Pfandbesitz in den eroberten Gebieten geboten werden. Johann Wittenborg führte die Flotte von 48 Schiffen (darunter 27 Koggen) mit 2240 Bewaffneten im April 1362 vor dem Hiddenseer Dornbusch zusammen. 600 Bewaffnete stellte Lübeck, jeweils 400 Stralsund und Rostock, je 200 Wismar, Greifswald und Stettin, 100 Kolberg, je 50 Stargard und Anklam und 40 Kiel. Weitere 300 kamen jeweils aus Bremen und Hamburg. Zwölf Wochen lang belagerte Johann Wittenborg Helsingborg, ohne dass die versprochene Hilfe aus Schweden oder Norwegen kam. Dann wurde er durch einen Ausfall Waldemars geschlagen. Ein Waffenstillstand wurde vereinbart und im November 1362 in Rostock bis zum 6. Januar 1364 verlängert, wobei sich die Bedingungen für die Hansestädte verbesserten. Der 1365 geschlossene Frieden von Vordingborg blieb wertlos, da die Dänen weiterhin den Handel der Hanse stark behinderten.
Konflikt
Auf dem Hansetag am 19. November 1367 in Köln fand sich ein Bündnis zusammen, die Kölner Konföderation, die aus bis zu 57 Hansestädten bestand. Am 2. Februar 1368 schlossen sie in Lübeck ein Kriegsbündnis mit König Albrecht von Schweden und norddeutschen und dänischen Adligen. Parallel zu einer Kriegserklärung an Dänemark versandte die Hanse Schreiben an 27 norddeutsche Herrscher, die Könige von England und Polen sowie an den Kaiser und den Papst, in denen sie ihr Handeln erklärten.
Im April 1368 fuhr die hansische Flotte mit 37 Schiffen und 2000 Bewaffneten nach Dänemark und nahm am 2. Mai 1368 Kopenhagen ein und zerstörte es. Schwedische und hansische Truppen nahmen im Juli des Jahres Schonen ein, Südjütland und Norwegen wurden schnell besiegt. König Waldemar floh. Allein Helsingborg hielt noch den Angriffen der Hansen stand, so dass die bewaffneten Belagerer unter Führung Brun Warendorps hier überwintern mussten. Im Frühjahr 1369 griffen sie erneut an, konnten allerdings erst am 8. September 1369 die Stadt einnehmen. Ende November 1369 schlossen Dänemark und die Hansen einen Waffenstillstand.
Friedensschluss
Am 1. Mai 1370 trafen in Stralsund die Vertreter von 23 Städten mit dem dänischen Gesandten unter Leitung Hennings von Putbus, des Erzbischofs von Lund sowie der Bischöfe von Roskilde und Odense. Der dänische König hatte nach der Niederlage sein Reich verlassen. Die Vertreter der Hansestädte Lübeck, Stralsund, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Riga, Reval, Dorpat, Kampen, Zuidersee, Briel, Harderwijk, Zutphen, Elburg, Stavoren, Deventer, Dordrecht und Amsterdam waren Bürgermeister oder Ratsherren ihrer Stadt.
Stralsunds Rolle im Wendischen Quartier der Hanse war zu dieser Zeit zweifellos gleich hinter Lübeck anzusetzen. Die beiden herausragenden außenpolitischen Führungspersönlichkeiten der Hanse in dieser Zeit waren der Lübecker Bürgermeister Jakob Pleskow und der Stralsunder Bertram Wulflam. In beiden Kriegen gegen Dänemark hatte Stralsund eine bedeutende Rolle gespielt und auch große finanzielle und materielle Beiträge geleistet. Auch politisch war Stralsunds Rolle offenbar stark: Zwischen 1358 und 1370 wurden 20 Hansetage hier abgehalten, dagegen 18 in Lübeck, 14 in Rostock und je sechs in Wismar und Greifswald. Diese politische Rolle fand ihren Ausdruck daher zu Recht in der Wahl Stralsunds für die Besiegelung der Ergebnisse der Verhandlungen mit dem dänischen Rat.
Da den Hansestädten im Gegensatz zu ihrem Kriegsverbündeten nicht der Sinn nach Herrschaftsgebieten, sondern hauptsächlich nach Vorteilen für den Handel stand, konnten sie dem ohnehin nachgiebigen Gegner Dänemark die eroberten Gebiete in Schonen überlassen und sicherten sich ihre früheren Privilegien wieder. Sie erhielten die Festungen Helsingborg, Malmö, Skanør und Falsterbo für 15 Jahre, auszulösen gegen 12.000 Mark reinen Silbers. Damit kam der Zoll am Øresund von Dänemark in die Kasse der Hanse. Außerdem durfte der dänische Reichsrat künftig keinen König ohne vorherige Zustimmung der Hanse wählen. Der Friede wurde ohne den Herzog Albrecht II. von Mecklenburg geschlossen, so dass dieser sich übergangen fühlte und einen eigenen Separatfrieden schloss, in dem er festlegte, dass sein Enkel Albrecht IV. von Mecklenburg König werden sollte.
Am 24. Mai 1370 besiegelten der Vertreter des Reichsrates des Königreichs Dänemark unter Henning Podebusk und die in der Kölner Konföderation vereinigten Städte den Stralsunder Frieden, welcher für lange Zeit die starke Rolle der Städte festschrieb. Im Vertrag wurde die Freiheit Visbys wiederhergestellt, außerdem hatte Dänemark der Hanse den freien Handel auf der Ostsee, auch gegen die Umlandfahrer zu garantieren. Die Hanse konnte sich daraufhin das Monopol im ökonomisch überaus bedeutenden Heringshandel auf der Schonischen Messe in Falsterbo sichern.
Der Friede von Stralsund markiert den Höhepunkt der Macht des hansischen Städtebunds im Ostseeraum. Außerdem erreichte er, dass Waldemars Nachfolger nur mit vorheriger Zustimmung der Hanse gewählt werden durfte.
Literatur
- Nils Jörn u.a. (Hrsg.): Der Stralsunder Frieden von 1370. Prosopographische Studien (= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F. 46), Köln/Weimar/Wien 1998. ISBN 3-412-07798-4.
- Karl Pagel: Die Hanse. Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg 1942; 3. Aufl. Braunschweig 1963
- Philippe Dollinger: Die Hanse, Kröner, Stuttgart 1989, S. 96-102 ISBN 3520371049
- Jürgen Petersohn: Europäisches Mittelalter. In: Der Große Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte. Düsseldorf 2000. ISBN 3-8155-9484-7
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Henning Podebusk - Henning von Putbus - Henning II. von Putbus
Henning Podebusk, auch Henning von Putbus (* Rügen; † 1388 in Egholm auf Sjælland) war letzter Drost von Dänemark und wird heute als dessen bedeutendster Innen- und Außenpolitiker des Mittelalters gesehen.
Leben
Podebusk entstammte der deutsch-slawischen Adelsfamilie Podebusk oder Putbus, die mit den letzten slawischen Fürsten von Rügen verwandt war. Über seine Herkunft und Jugend ist sonst nichts bekannt. Er trat 1350 in die Geschichte Dänemarks ein, nachdem ihn der König Waldemar IV. nach einem Treffen in Norddeutschland in dänische Dienste übernommen hatte. Er erwarb sich durch seine uneingeschränkte Loyalität und sein diplomatisches Können das Vertrauen Waldemars und wurde 1365 Drost, nach heutiger Diktion Ministerpräsident Dänemarks. In diese Zeit fällt die Wiederherstellung der Vormachtstellung Dänemarks im Ostseeraum verbunden mit heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Städten der Hanse. Podebusk erwies sich als Meister, wenn es darum ging, ungünstige Bedingungen von Friedensverträgen faktisch und diplomatisch durch Handelsbehinderungen zu unterlaufen, wie es sich zum Beispiel nach dem Frieden von Vordingborg (1365) zeigte. Dies führte im Anschluss an den Hansetag in Köln 1367 (Kölner Konföderation) zu einer erneuten Kriegserklärung der Hanse an Dänemark. Nach der Schlacht im Strelasund war der Krieg für König Waldemar verloren. Der Frieden von Stralsund (1370) wurde unter Führung Henning Podebusks mit den führenden Vertretern der Hanse, dem Lübecker Bürgermeister Jakob Pleskow und dem Stralsunder Bürgermeister Bertram Wulflam verhandelt.
Im Anschluss an den Frieden stellte Podebusk zunächst im inneren Dänemarks die Ordnung wieder her, hatten doch einige Angehörige des dänischen Adels im Krieg auf Seiten der Hanse gestanden. Auch gelang es ihm wiederum die für Dänemark wirtschaftlich und politisch nicht hinnehmbaren Vorgaben des Friedensvertrages abzumildern und zu unterlaufen.
Mit dem Tod König Waldemars 1375 wurde er zum gleichermaßen loyalen Berater der Königin Margarethe I., der er - wohl sein letzter Erfolg - mit der Anerkennung als Königin durch den Reichsrat (1387) den Weg zur Eroberung Schwedens und damit zur Begründung der Kalmarer Union ebnete.
Nach seinem Tod wurde das Amt eines Drosten in Dänemark nicht mehr vergeben. Podebusk wurde in der Schlosskirche von Sorø begraben.
Podebusk wird in den Gurreliedern, dem dänischen „Nibelungenlied“, als der treue Henning und Stütze König Waldemars angesichts des Todes seiner Geliebten Tove erwähnt.
Die Familie Podebusk/Putbus teilte sich 1483 in einen dänischen und einen Rügener Zweig. Der Letztere starb 1702 aus, so dass die Besitzungen auf Rügen an einen Zweig der dänischen Familie zurückfielen, die 1807 unter Wilhelm Malte I. in den schwedischen Fürstenstand erhoben wurde.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Liste der Bischöfe und Erzbischöfe von Lund
Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Lund (Schweden):
- 1060–1066 – Heinrich
- 1066–1072 – Egino
- 1072–1089 – Ricwald
- 1089–1137 – Asker (erster Erzbischof ab 1104)
- 1137–1177 – Eskil
- 1177–1201 – Absalon Hvide (Axel)
- 1201–1222 – Anders Sunesen
- 1224–1228 – Peder Saxesen
- 1228–1252 – Uffe Thrugotsen
- 1254–1274 – Jakob Erlandsen
- 1276–1280 – Trugot Torstensen
- 1280–1289 – Jens Dros
- 1289–1303 – Jens Grand (auch Bischof von Bremen)
- 1303–1310 – Isarnus von Fontiano, CanA (auch Erzbischof von Riga)
- 1310–1325 – Esger Juul
- 1325–1334 – Karl Eriksen
- 1334–1355 – Peder Jensen Galen
- 1355–1361 – Jacob Nielsen Kyrning
- 1361–1379 – Niels Jensen Bild
- 1379–1390 – Magnus Nielsen
- 1390–1391 – Peder Jensen
- 1392–1410 – Jacob Gertsen Ulfstand
- 1410–1418 – Peder Mickelsen Kruse
- 1418–1436 – Peder Lykke
- 1436–1443 – Hans Laxmand
- 1443–1472 – Tuve Nielsen
- 1472–1497 – Jens Brostrup
- 1497–1519 – Birger Gunnersen
- 1519–1523 – Aage Sparre
- 1520–1523 – Jørgen Skodborg
- 1521–1522 – Didrik Slagheck
- 1522–1532 – Johan Weze
- 1532–1536 – Torben Bille
Superintendenten und Bischöfe nach der Reformation
- 1537–1551 – Frans Vormordsen
- 1551–1560 – Niels Palladius
- 1560–1577 – Tyge Asmundsen
- 1578–1589 – Niels Hvid
- 1589–1611 – Mogens Mads
- 1611–1619 – Poul Aastrup
- 1620–1637 – Mads Jensen Medelfar
- 1638–1679 – Peder Winstrup (erster Bischof nach der Reformation)
- 1679–1687 – Canutus Hahn
- 1688–1694 – Christian Papke
- 1694–1714 – Mattias Steuchius
- 1715–1734 – Jonas Petri Linnerius
- 1734–1738 – Andreas Rydelius
- 1738–1740 – Carl Papke
- 1740–1747 – Henrik Benzelius
- 1748–1777 – Johan Engeström
- 1777–1794 – Olof Celsius der Jüngere
- 1794–1803 – Petrus Munck von Rosenschiöld
- 1805–1811 – Niels Hesslén
- 1811–1854 – Wilhelm Faxe
- 1854–1856 – Henrik Reuterdahl
- 1856–1865 – Johan Henrik Thomander
- 1865–1897 – Wilhelm Flensburg
- 1898–1925 – Gottfrid Billing
- 1925–1948 – Evard Rodhe
- 1949–1958 – Anders Nygren
- 1958–1960 – Nils Bolander
- 1960–1970 – Martin Lindström
- 1970–1980 – Olle Nivenius
- 1980–1992 – Per-Olov Ahrén
- 1992–1997 – K. G. Hammar
- 1997–2007 – Christina Odenberg
- seit 2007 - Antje Jackelén
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Liste der Bischöfe von Fünen - Bischöfe Odense
Die folgenden Personen waren Bischöfe von Fünen mit Sitz in Odense (Dänemark):
- Odinkar Hvide 988-10??
- Reiner I. 1022-10??
- Gilbert 1048-1072
- Hubald 1101-11??
- Hermann 1136-1138
- Ricolf 1138-1163
- Linus 1163-11??
- Simon 1170-1186
- Johann I. 1186-1213
- Lojus 1213-1236
- Iver 12??-1245
- Niels 1245-1247
- Jakob 1247-1252
- Reiner II. 1252-1267
- Peter 1267-1276
- Johann II. 1277-1286
- Gisiko 1286-1300
- Niels Jonassøn 1340-1362 (Jonsen)
- Erik Johansen Krabbe 1362-1376
- Waldemar Podebusk 1376-1392
- Theus Podebusk 1392-1400 (Teze)
- Jens Ovesen 1400-1420
- Navne Jensen 1420-1440
- Henning Torkildsen Ulfeld 1440-1460 (Henneke Torkilsen)
- Mogens Krafse 1460-1474
- Karl Rønnow 1475-1501
- Jens Andersen Beldenak 1501-1517
- Jens Andersen Beldenak 1523-1529
- Knud Henrikssen Gyldenstjerne 1529-1534
- Gustav Trolle 1534-1535
- Knud Henrikssen Gyldenstjerne 1535-1536
- Jörgen Jensen Sadolin 1537-1559
- Jacob Madsen Vejle 1587-1606
- Hans Knudsen Vejle 1606-1616
- Hans Mikkelsen 1616-1651
- Laurids Jacobsen Hindsholm 1651-1663
- Niels Hansen Bang 1663-1676
- Thomas Kingo 1677-1703
- Christian Rudolf Müller 1704-1712
- Christian Muus 1712-1717
- Christian Ramus 1732-1762
- Jakob Ramus 1763-1785
- Tønne Bloch 1786-1803
- Peder Hansen 1804-1810
- Frederik Plum 1811-1834
- Nicolai Faber 1834-1848
- Christian Thorning Engelstoft 1851-1889
- Hans Valdemar Sthyr 1900-1903
- Laurits Nicolai Balslev 1903-1922
- Hans Øllgard -1958
- Knud Christian Holm 1958-1984
- Vincent Lind 1984-1995
- Kresten Drejergaard 1995-heute
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Liste der Bischöfe von Roskilde
Die folgenden Personen waren Bischöfe von Roskilde (Dänemark):
(Katholische) Bischöfe vor der Reformation
- ca. 1022–1029/30 Gerbrand
- ca. 1030–1050 Avaco/Aage
- ca. 1060–1073/74 Wilhelm
- 1074–1088 Svend Nordmand
- 1088–1124 Arnold
- 1124–1134 Peter
- 1134–1137 Eskil
- 1137–1138/39 Ricco/Rike
- 1139–1158 Asker/Asser
- 1158–1191 Absalon
- 1191–1214 Peder Sunesen
- 1214/15–1224/25 Peder Jakobsen
- 1225–1249 Niels Stigsen
- 1249–1254 Jakob Erlandsen
- 1254–1277 Peder Bang
- 1278–1280 Stig (Name ist unsicher)
- 1280–1290 Ingvar (Name ist unsicher)
- 1290–1300 Johann / Jens Krag
- 1301–1320 Oluf
- 1321–1330 Johann / Jens Hind
- 1330–1344 Johann / Jens Nyborg
- 1344–1350 Jakob Poulsen
- 1350–1368 Henrik Ge(e)rtsen
- 1368–1395 Niels Jepsen Ulfeldt
- 1395–1416 Peder Jensen Lodehat
- 1416–1431 Jens Andersen Lodehat
- 1431–1448 Jens Pedersen Jernskæg
- 1449–1461 Oluf Daa
- 1461–1485 Oluf Mortensen
- 1485–1500 Niels Skave
- 1500–1512 Johan Jepsen Ravensberg
- 1512–1529 Lage Urne
- 1529–1536 Joachim Rønnow
Evangelische Bischöfe nach der Reformation
Von 1536–1923 wird der Sitz der Bischöfe nach Kopenhagen verlegt und der Titel wird in „Bischof von Seeland“ geändert
- 1537–1560 Peder Palladius
- 1560–1569 Hans Albertsen
- 1569–1590 Povl Johan Madsen
- 1590–1614 Peder Wiinstrup
- 1614–1638 Hans Poulsen Resen
- 1638–1652 Jesper Rasmussen Brochmand
- 1652–1653 Hans Hansen Resen
- 1653–1655 Laurids Scavenius
- 1655–1668 Hans Svane
- 1668–1675 Hans Wandal
- 1675–1693 Hans Bagger
- 1693–1710 Henrik Bornemann
- 1710–1737 Christian Villem Worm
- 1737–1757 Peder Hersleb
- 1757–1783 Ludvig Harboe
- 1783–1808 Nicolas Edinger Balle
- 1808–1830 Frans C. Münter
- 1830–1834 Peter Erasmus Müller
- 1834–1854 Jacob Peter Mynster
- 1854–1884 Hans Lassen Martensen
- 1884–1895 Bruun Juul Fog
- 1895–1909 Thomas Skat Rørdam
- 1909–1911 Peter Madsen
- 1911–1922 Harald Ostenfeld
- 1923–1934 Henry Fonnesbech-Wulff
- 1935–1953 Axel Rosendal
- 1953–1969 Gudmund Schiøler
- 1969–1980 Hans Kvist
- 1980–1997 Bertil Wiberg
- 1997–2008 Jan Holger Lindhardt
- seit 2008 Peter Fischer-Møller
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Bodenseehanse - Große Ravensburger Handelsgesellschaft
Die Große Ravensburger Handelsgesellschaft (lateinisch: Magna Societatis Alamannorum) wurde um 1380 durch Kaufleute aus den Familien Humpis (aus Ravensburg), Mötteli (aus Buchhorn) und Muntprat (aus Konstanz) gegründet. Sie war bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts, eines der bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen des Spätmittelalters.
Geschichte
Anfangs diente die Gesellschaft wohl vor allem der Vermarktung des heimischen Tuchs (vor allem Leinen und Barchent). Als 1402 in Ravensburg eine der ersten Papiermühlen nördlich der Alpen errichtet wurde, kam ein weiteres Eigenprodukt dazu; ebenso handelte man aber mit Gewürzen aus dem Orient, Wein und Öl aus dem Mittelmeerraum, Erzen aus Osteuropa und anderem mehr. Die Große Handelsgesellschaft ist vermutlich auch der Grund, dass Heimatforscher in Ravensburg keine historische Tracht ausfindig machen konnten; wer es sich leisten konnte, trug schon damals italienische Mode, und wer sich das Original nicht leisten konnte, schneiderte sich Kopien.
Durch die Errichtung von Niederlassungen (so genannten Geliegern) in Spanien, Frankreich, Italien und Osteuropa gewann die Handelsgesellschaft bald an gesamteuropäischer Bedeutung. Neben der in Ravensburg angesiedelten zentralen Leitung und der Niederlassung in Konstanz bestanden Verbindungen zu Memmingen, Biberach, Lindau, St. Gallen, Kempten, Ulm und anderen Städten der Umgebung. Niederlassungen, Kontore und Faktoreien hatte die Gesellschaft in der Blütezeit unter anderem in Antwerpen, Brügge, Lyon, Avignon, Genf, Wien, Venedig, Mailand, Genua, Barcelona, Saragossa und Valencia. Auch in den wichtigen Messestädten Frankfurt am Main und Nürnberg war sie präsent.
Über 100 Familien aus etwa 10 Städten des Bodenseegebietes waren an der Gesellschaft beteiligt. Die bedeutendsten waren die Humpis (die auch die meisten Regenten der Gesellschaft stellten), Mötteli, Muntprat, Ankenreute und Holbein.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich auch die Fugger auf ihren ersten Italienfahrten Handelszügen der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft anschlossen.
Ab Ende des 15. Jahrhunderts machten Familienstreitigkeiten innerhalb der führenden Familien und Abspaltungen von Handelsfamilien, die Konkurrenz der St. Galler Diesbach-Watt-Gesellschaft, der Memminger Vöhlin-Welser-Gesellschaft sowie vor allem der Augsburger Fugger und Welser der Ravensburger Handelsgesellschaft zunehmend zu schaffen.
Beschleunigt wurde der Niedergang sicher auch durch eine ungenügende Anpassung an die von der Wiederentdeckung des amerikanischen Kontinents veränderten Wirtschaftsbedingungen und durch die von hohen Goldimporten hervorgerufene Inflation.
Die Schwerfälligkeit der Ravensburger Organisationen einerseits und das Fehlen qualifizierten und risikofreudigen Nachwuchses andererseits verhinderten ein Gegensteuern. So scheuten die Ravensburger auch die Aufnahme von Bankgeschäften, die entscheidend zum späteren Reichtum der Konkurrenz etwa aus den Häusern der Fugger und Welser beitrugen. Stattdessen nutzten sie den erworbenen Reichtum, um die Stadt zu verlassen und nach dem Vorbild des Adels auf Landsitzen zu wohnen und selbst Adelstitel zu erwerben.
1530 erlosch die Handelsgesellschaft sang- und klanglos, als nicht mehr genügend Gesellschafter zur Erneuerung der jeweils nur auf Zeit geschlossenen Gesellschaftsverträge bereit waren.
Forschung und Rezeption
Lange Zeit wussten Wirtschaftshistoriker und Lokalhistoriker recht wenig über den genauen Aufbau und die Geschäfte der Handelsgesellschaft. Wilhelm Heyd stellte die Geschichte der Gesellschaft anhand der wenigen erhaltenen Akten 1890 erstmals in einer Monographie dar. 1909 wurden im Schloss Salem überraschend zahlreiche Akten der Gesellschaft gefunden, die – als unnütze Handelssachen deklariert – vorher jahrhundertelang unbeachtet geblieben waren. Aloys Schultes grundlegendes dreibändiges Werk von 1923 beruht auf diesen Akten und leitete eine tiefere Beschäftigung mit der Handelsgesellschaft ein.
In dem historischen Roman Der junge Herr Alexius von Otto Rombach wird das abenteuerliche Leben des Ravensburger Kaufmanns Alexius Hilleson auf seinen Reisen durch Europa geschildert. Obwohl sich Rombach in vielen Details auf Schulte stützt, ist der Roman doch weitgehend fiktiv.
In Ravensburg selbst erinnern viele Bauwerke, Wappen und Straßennamen an die Zeit der Handelsgesellschaft. Beim jährlichen Rutenfest werden ihre Geschäfte durch Kostümgruppen am Festzug dargestellt.
Literatur
- Wilhelm Heyd: Die grosse Ravensburger Gesellschaft. Cotta, Stuttgart 1890 (Volltext)
- Oliver Landolt: Ravensburger Gesellschaft. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
- Klaus Schelle: Die Große Oberschwäbische Handelsgesellschaft. Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach 2000 ISBN 3-933614-05-8
- Aloys Schulte: Geschichte der grossen Ravensburger Handelsgesellschaft (= Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit, Band 3). 3 Bände. Stuttgart und Berlin 1923. Nachdruck: Steiner, Wiesbaden 1964
- Maria Strasser-Lattner: Der Handel über die Bündner Pässe zwischen Oberdeutschland und Oberitalien im späten Mittelalter. Magisterarbeit, Universität Konstanz 2004 (Volltext)
- Werner A. Widmann: Die Bodenseehanse. Aus der Geschichte der grossen Ravensburger Handelsgesellschaft. Bayerische Vereinsbank, München 1988
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Christoph III. (Dänemark, Norwegen und Schweden)
Christoph III. (geboren als Christoph von Pfalz-Neumarkt; * 26. Februar 1416 in Neumarkt in der Oberpfalz; † 5. Januar 1448 in Helsingborg) war König von Dänemark (dänisch: Christoffer af Bayern, ab 1440), Schweden (schwedisch: Kristofer av Bayern, ab 1441) und Norwegen (norwegisch: Kristoffer av Bayern, ab 1442). Er war der Sohn Herzog Johanns von Pfalz-Neumarkt und Katharinas, der Schwester seines Vorgängers Eriks VII., und entstammte der wittelsbachischen Linie Pfalz-Neumarkt.
 
↑ Christoph III. von Dänemark (links); Siegel von König Christoph III. von Dänemark (rechts)
Leben
Aufstieg zum König
Christoph amtierte als einziger Sohn Herzog Johanns schon früh als dessen Stellvertreter in Neumarkt und begleitete ihn auch zu Reichstagen und Fürstenversammlungen. 1434 besuchte er seinen Onkel König Erik VII. in Dänemark, danach diente er am Hof des deutschen Kaisers Sigismund, dessen Parteigänger sein Vater war. Der Brief, in dem er Herzog Johann über dem Tod des Kaiser Sigismunds im Jahr 1437 und die Machtübernahme seines entfernten Verwandten Albrecht von Österreich informierte, ist für die Rekonstruktion dieser dramatischen Wochen von entscheidender Bedeutung.
Das Jahr 1438 stellte einen Wendepunkt in Christophs Leben dar: Nachdem er erfolgreich an den Hussitenkriegen teilgenommen und auch den Reichstag zu Nürnberg besucht hatte, erhielt er einen Brief aus Dänemark. Darin bot ihm der dänische Reichsrat das Königreich Dänemark und die Anwartschaft auf Norwegen und Schweden an. Er sollte der Nachfolger seines Onkels Erik werden, der sich mit dem Reichsrat überworfen hatte. Erik hatte im Kampf gegen die Hanse viel Geld ausgegeben, selbstherrlich Dänen und Deutsche mit Lehen in Schweden betraut und gegen den Willen des Adels Bogislaw von Pommern-Stolp als Nachfolger durchzusetzen versucht.
Christoph, für den in den Augen des Reichsrats neben seiner Verwandtschaft mit den Königshäusern Dänemarks, Schwedens und Norwegens auch seine fehlende Hausmacht sprach, wurde außer von Albrecht von Österreich auch von Herzog Adolf von Holstein und der Hanse unterstützt, während sich die von Erik bevorzugten holländischen Kaufleute und der einflussreiche Herzog Philipp von Burgund für Bogislaw aussprachen. Wohl im April 1439 reiste Christoph nach Lübeck, um sich persönlich in den Konflikt um Eriks Nachfolge einzuschalten. Der abgesetzte König Erik VII. zog sich schließlich nach Gotland zurück.
Regierungszeit
Eriks Neffe aus Neumarkt übernahm im Juli 1439 als Reichsverweser die Regierung im Königreich Dänemark und wurde im April 1440 zum König gewählt. Im darauffolgenden Jahr hatte er zunächst in Jütland einen Bauernaufstand niederzuschlagen, bevor er im September 1441 nach Uppsala reisen konnte, wo er zum König von Schweden gekrönt wurde. Im Juli 1442 erlangte Christoph in Oslo auch die norwegische Königswürde und wurde am 1. Januar 1443 zum Erzkönig der dänischen Reiche gekrönt (archirex regni Daniae). Er beherrschte damit die gesamte Kalmarer Union, ein Gebiet, das von Grönland im Westen bis Finnland im Osten reichte.
Christophs Macht war allerdings nicht unbeschränkt. Insbesondere der schwedische Adel hatte seiner Krönung nur gegen weitreichende Zugeständnisse zugestimmt. Der dortige Reichsrat durfte in Zukunft seine Mitglieder, die nun wieder gebürtige Schweden sein mussten, nicht nur selbst aussuchen, er sollte auch in die Vergabe aller wichtigen Lehen mit einbezogen werden und der König hatte alle von ihm beschlossenen Gesetze zu unterzeichnen. Ein Reichsratsausschuss sollte in Abwesenheit des Königs die Regierungsgeschäfte in Schweden führen, in Schweden eingenommene Steuern sollten nicht wie noch unter Erik VII. in anderen Teilen des Reiches ausgegeben werden dürfen. Die Reichsräte Dänemarks und Norwegens hatten zwar weniger weitreichende Vollmachten als ihre schwedischen Kollegen, Christoph konnte aber auch dort kaum gegen den Willen der Räte regieren.
Christoph führte in Jütland und Fünen die Abgabe des Zehnten ein. Im Jahr 1443 erhielt Kopenhagen ein neues Stadtrecht, das den Handel mit ausländischer Valuta verbot. Er war der erste König, der Kopenhagen zur Haupt- und Residenzstadt machte. Es wurde eine Steuer für die Passage des Öresundes erhoben. Die Hansestädte waren nicht im geringsten begeistert und verbündeten sich mit dem abgesetzten König Erik, der weiterhin auf Gotland herrschte. Bei einem Treffen 1445 wurde Christoph gezwungen, die bestehenden Rechte der Hanse in Schweden und Norwegen zu bekräftigen. Ein Teil dieses Vertrages sah auch die Vermählung Christophs mit Dorothea vor, der Tochter des Markgrafen Johann von Brandenburg. Die Trauung fand am 12. September 1445 im Kopenhagener Schloss statt.
Tod und Nachfolge
Am 5. Januar 1448 starb Christoph auf der Festung Kärnan in Helsingborg – an einer Blutvergiftung, wie man heute annimmt. Er wurde in der Domkirche von Roskilde begraben. Seine Witwe heiratete später den König Christian I. Der Thron wurde vom Reichsrat dem Herzog Adolf VIII. angeboten, doch dieser lehnte zu Gunsten seines Neffen Christian von Oldenburg ab.
Literatur
- Åke Kromnow: Christoph, König von Dänemark, Norwegen und Schweden. In: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. Band 41, 1981, ISSN 0044-2364, S. 201–210 (online).
- Johann Friedrich Ludwig Theodor Merzdorf: Christoph III.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 4. Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 235.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Kalmarer Union
Die Kalmarer Union war eine Vereinigung der Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden, welche von 1397 bis 1523 bestand.
Gebietserläuterung
Die formell nie zustande gekommene Union von Kalmar umfasste ebenfalls Teile Finnlands, welches damals unter schwedischer Herrschaft stand, Island und die Färöer, welche Teile der norwegischen Krone waren und zeitweise Schleswig-Holstein. Die Reichsräte in Dänemark, Schweden und Norwegen hatten jedoch nie das Unionsdokument ratifiziert, denn Margarethe I. wollte eine viel engere Union errichten als der Adel der nordischen Staaten. Nicht zur Union gehörten die Inseln und Städte der Hanse, die in wirtschaftlicher und politischer Konkurrenz zu den umliegenden Monarchien stand. Die Westküste Schwedens war damals ebenso wie Bornholm im Besitz Dänemarks.
Daneben herrschten in der südlichen Ostsee Monarchien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, genauer Grafschaft Holstein, Herzogtum Mecklenburg und Herzogtum Pommern sowie der angrenzende Deutsche Orden im Baltikum.
Bündnis
Die Union von Kalmar wurde von Dänemark dominiert und in Schweden und Norwegen nur von Teilen des Adels und Klerus getragen. Beherrschende Themen in der Geschichte der Kalmarer Union waren immer der Freihandel, insbesondere der der Hansestädte, die Eigeninteressen des schwedischen Hochadels und der Besitz von Schleswig. Aufgrund der verschiedenen Interessenlagen konnte sich aus der Union keine Großmacht bilden. Die Union der drei skandinavischen Staaten, die nur als eine Personalunion und ein Verteidigungsbündnis angelegt war, war kein kontinuierlich andauernder Verbund, da es im 15. Jahrhundert des Öfteren zum Zerfall des Unionskönigtums kam. Nur unter den Königen Erich von Pommern (1397–1439), Christoph von Bayern (1440–1448), Christian I. (1457–1463) und Hans (1497–1501) hatte sie realen Bestand. In diesen Zeiträumen wurde der amtierende dänische König auch vom schwedischen Hochadel als Unionskönig akzeptiert. In den dazwischen liegenden Perioden übernahm der schwedische Reichsrat sowie der von ihm gewählte Reichsverweser die Regierung im Land.
Vorgeschichte
Union Schweden-Norwegen
In Schweden wurde der Adel mächtig, da das Königtum Schwäche zeigte. Der Adel einigte sich 1319 einvernehmlich mit dem norwegischen König Magnus Eriksson auf ein Unions-Königtum. Nach einem Krieg gegen Dänemark gehen Schonen, Öland und Gotland verloren.
Union Dänemark-Norwegen
Norwegen wird von Magnus Erikson 1355 an seinen jüngeren Sohn König Haakon VI. übergeben. Dieser heiratet 1363 Margarethe von Dänemark, die Tochter von König Waldemar IV.. 1370 beugt sich Dänemark im Frieden von Stralsund der Hanse. Die Hansestädte unterstützen ihrerseits die Regentin Margarethe als Nachfolgerin von Haakon VI., um ein Gegengewicht zu dem aufstrebenden Mecklenburg zu bekommen. 1376 erreicht die Regentin Margarethe I. die Wahl ihres fünfjährigen Sohns Olav zum König von Dänemark. 1381 erbt er nach seinem Vater zudem den Thron von Norwegen. Nach dessen Tod 1387 übernahm die Regentin die Herrschaft in beiden Staaten.
Union Dänemark-Norwegen-Schweden
Schwedische Adelige opponieren gegen ihren König Albrecht und wählen Königin Margarethe I. als Regentin. König Albrecht wird 1389 geschlagen und mit seinem Sohn Erich gefangen genommen, aber die Stadt Stockholm widersetzt sich mit Hilfe von Mecklenburg und den Vitalienbrüdern bis 1395. Auch die Hansestädte Rostock und Wismar unterstützten Stockholm hierbei. Als der Seehandel durch die Vitalienbrüder Schaden nahm, griffen die Hansestädte unter der Führung von Lübeck ein. Sie übernahmen Stockholm unter ihre Verwaltung und bekamen ihre Rechte nach einer Blockade von Schonen durch Margarethe bestätigt. Mecklenburg wurde durch diese Allianz stark geschwächt. Daraufhin erfolgte zwar noch eine Eroberung Gotlands durch den Deutschen Orden, Gotland wurde aber bald auf Druck der Hanse an Dänemark zurückgegeben.
Geschichte
Am 17. Juni 1397 unterzeichneten die Reichsräte der drei Staaten in Kalmar unter Federführung der dänischen Königin Margarethe I. jenen Vertragsentwurf, der nie ratifiziert wurde, Skandinavien aber für rund eineinhalb Jahrhunderte faktisch vereinte. Jedes Reich behielt seinen Reichsrat und Regierungsaufbau.
Seit 1409 kam es zu einem Krieg zwischen Dänemark und Holstein um Schleswig. Das Herzogtum war 1326–1330 als dänisches Lehen an das Haus Schauenburg gegangen und das erstarkte Dänemark wollte seit 1427 gegen Graf Adolf VIII. von Schauenburg zu Holstein und Stormarn seine Besitzansprüche, die der deutsche König Sigismund auch bestätigte, geltend machen.
Erich von Pommern
Nach dem Tode Margarethes 1412 ergaben sich weitere Probleme, als ihr Großneffe, König und Nachfolger Erich von Pommern-Stolp einen Bruch mit der Hanse verursachte. Obwohl er im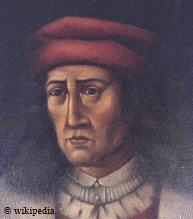 Verfassungskonflikt von Wenden im Sinne des alten Rates eingriff, wollte die Hanse seinen Anspruch auf Schleswig nicht unterstützen. Erich von Pommern verbündete sich deshalb mit Polen gegen den Deutschen Orden und erhob am Sund Steuern. Hierdurch wurden die Hanse und Holstein benachteiligt, bzw. England und Holland bevorzugt. Die Hanse unterstützte daraufhin offen die Holsteiner Grafen. Verfassungskonflikt von Wenden im Sinne des alten Rates eingriff, wollte die Hanse seinen Anspruch auf Schleswig nicht unterstützen. Erich von Pommern verbündete sich deshalb mit Polen gegen den Deutschen Orden und erhob am Sund Steuern. Hierdurch wurden die Hanse und Holstein benachteiligt, bzw. England und Holland bevorzugt. Die Hanse unterstützte daraufhin offen die Holsteiner Grafen.
1427 wurde eine hanseatische Flotte im Sund von den Dänen besiegt und die Hamburger und Lübecker Bürgermeister hierbei gefangen genommen. Ein weiterer Angriff der Hanse auf Kopenhagen schlug fehl und ein dänischer Angriff auf Stralsund ebenfalls. Eine wendische Flotte brandschatzte Bergen. Erich von Pommern verständigte sich mit dem Deutschen Orden und konnte von den neutralen Hansestädten im Osten sogar Nowgorod auf seine Seite bringen. Außerdem erhielt er in dem sich entwickelnden Kaperkrieg Unterstützung von Holland. Rostock und Stralsund schlossen 1430 einen Sonderfrieden, Flensburg wurde 1431 von Holstein erobert.
Außerdem wollte Erich von Pommern die Union in einen von Kopenhagen aus regierten Einheitsstaat umformen. Bereits seit 1434 kam es in Schweden zu Volkserhebungen. Erst als 1435 der Anführer und jetzige Nationalheld Engelbrecht Engelbrechtson ermordet wurde, brach der Aufstand zusammen. Der schwedische Adel setzte daraufhin Karl Knutson Bonde bis 1441 als Reichsverweser von Schweden ein, der weiter gegen Dänemark agierte und später König werden sollte.
Der schwedische Aufstand zwang Erich von Pommern 1435 zum Frieden von Vordingborg. Die Linie Holstein-Rendsburg des Hauses Schauenburg behielt das Herzogtum Schleswig, die Hanse bekam ihre Privilegien bestätigt und die wendischen und pommerschen Schiffe sollten im Gegensatz zu den Schiffen der im Krieg neutralen Preußen und Livländer vom dänischen Sundzoll befreit werden. Diese versprochene Freiheit wurde den wendischen Händlern aber später verwehrt.
Erich von Pommern konnte seine Macht hiernach nicht mehr durchsetzen und zog sich auf die Insel Gotland zurück.
Christoph III.
1439 tagte der Reichsrat von Dänemark in der Hansestadt Lübeck und setzte Erich von Pommern als König ab. Als Nachfolger wurde dessen bayerischer Neffe Christoph von Neumarkt gewählt. Nachdem die Hanse sich ihre Rechte bestätigen ließ, brachte ein Lübecker Schiff diesen in sein neues Reich. Schweden und Norwegen hatten die Union inzwischen aufgekündigt. 1440 wurde er auch in Schweden gewählt, 1442 in Norwegen als König anerkannt. gewählt. Nachdem die Hanse sich ihre Rechte bestätigen ließ, brachte ein Lübecker Schiff diesen in sein neues Reich. Schweden und Norwegen hatten die Union inzwischen aufgekündigt. 1440 wurde er auch in Schweden gewählt, 1442 in Norwegen als König anerkannt.
1441 gab es in Nordjütland einen Bauernaufstand. Nach anfänglichen Verlusten gelang Christoph am 8. Juni der entscheidende Sieg gegen die Wagenburg der Aufständischen bei Husby Hole.
Wegen des Sundzolls kam es zu laufenden Streitigkeiten der Ostseemächte. Christoph III. gewährte Holland die gleichen Rechte wie der Hanse, nahm von Preußen Zoll. Lübeck und Rostock verschlossen daraufhin ihre Tore vor ihm.
Der schwedische Hochadel wehrte sich auch zunehmend gegen die dänische Machtpolitik. Einerseits gab es in Schweden nationalistische Tendenzen, die einen Bruch mit Dänemark förderten und andererseits fürchtete der schwedische Adel die Einschränkung seiner Rechte und Freiheiten durch die dänische Politik. Streitpunkte waren vor allem die rigoros durchgeführte Steuerpolitik und die Besetzung der schwedischen Schlosslehen und Bischofssitze mit ausländischen, meist dänischen Adeligen. Mit diesen Handlungen verstießen die dänischen Könige regelmäßig gegen die mit dem schwedischen Hochadel getroffenen Vereinbarungen, was letztendlich sogar zur Wahl eines schwedischen Gegenkönigs, Karl Knutson Bonde, führte.
Karl Knutson Bonde und Christian I.
Nach dem Tode Christophs von Bayern 1448 wurde der schwedische Reichsverweser Karl Knutson Bonde von Schweden einvernehmlich mit Norwegen zum König gewählt. Schweden eroberte Gotland zurück, von dem aus sich Erich von Pommern als Seeräuber betätigte. 1449 wurde Karl Knutson auch zum König von Norwegen gekrönt. eroberte Gotland zurück, von dem aus sich Erich von Pommern als Seeräuber betätigte. 1449 wurde Karl Knutson auch zum König von Norwegen gekrönt.
Die Dänen wählten 1448 in Einvernehmen mit der Hanse und den wendischen Städten den deutschen Christian I. aus dem Haus Oldenburg zum König. Christian versuchte Gotland zurückzuerobern und es kam in Folge von 1451 bis 1456 zu einem Krieg zwischen Dänemark und Schweden. Daneben herrschte in der Ostsee seit 1454 Krieg zwischen preußischen Ständen und dem Deutschen Orden.
Dänemark sicherte sich die Unterstützung ausländischer Mächte, wie z. B. der Hanse, des Deutschen Ordens oder Hollands. Es hatte auch die Unterstützung einer Gruppe im schwedischen Hochadel (z. B. Oxenstierna), die vor allem aus wirtschaftlichen Interessen an der Union festhielten. Viele Adlige besaßen sowohl auf dänischer als auch schwedischer Seite große Güter. Als diese unionsfreundliche Gruppe zu stark wurde, floh König Karl Knutson 1457 nach Danzig.
Christian I. aus dem Haus Oldenburg wurde 1457 ebenfalls zum König von Schweden gekrönt. Einvernehmlich mit der Hanse wurde ein Verkehrsfriedensbündnis für die ganze Ostsee geschlossen, nur gestört durch den Zwist in den Ordensländern. 1459 wurde Christian I., der Neffe von Adolf VIII., nach dessen Tod auf Wunsch der dortigen Ritterschaft Herzog von Schleswig und Graf (ab 1474 ebenfalls Herzog) von Holstein. Hierdurch wurde seine Position gegenüber der Hanse gestärkt, da sein Herrschaftsbereich jetzt Hamburg umfasste, den Landweg zwischen Ost- und Nordsee kontrollierte und bis an Lübeck reichte, welches die führende Hansestadt war.
In Schweden erwiesen sich die Bürgerschaft von Stockholm, die Bergbau- und Hüttenunternehmer und die Bauern von Dalarna aufgrund der dänischen Steuerpolitik als unzufrieden, so dass es unter hochadeliger Führung mehrfach zu Aufständen kam, erstmals 1464. Karl Knutson Bonde war nach Stockholm zurückgekehrt und wurde erneut als König anerkannt. Der schwedische Adel verbannte ihn 1465 nach Finnland, nahm aber auch gegenüber Christian I. eine ablehnende Haltung ein. Dieser musste sich zudem seit 1463 gegen seinen Bruder Gerd wehren, der Schleswig-Holstein verlangte und schließlich als Verwalter erhielt. Für den erfolglosen Kampf verpfändete Christian I. Fehmarn und Neustadt in Holstein an Lübeck. 1467 wirkte Karl Knutson wieder in Stockholm und Christian versuchte vergeblich, Schweden anzugreifen. Für einen von beiden Königen gewünschten, dann nicht stattfindenden Vermittlungsversuch überließ Christian I. Lübeck 1469 die Stadt Kiel. Christian I. hatte inzwischen seinen Bruder nach weiteren Machtansprüchen abgesetzt, gefangen nehmen lassen und in die Seeräuberei getrieben.
Karl Knutson verstarb 1470 in Schweden. Aber danach wurde dessen Neffe ( Sohn seiner Stiefschwester) Sten Sture I. Reichsverweser. Christian landete im Juli 1471 mit Truppen vor Stockholm, erlitt aber gegen Sten Sture eine bedeutende Niederlage bei der Schlacht am Brunkeberg. Erst 1473 kam es in Kalmar zu einem Frieden zwischen Dänemark und Schweden. 1474 versuchte Christian I., sich die Unterstützung des Deutschen Kaisers für einige Vorhaben zu sichern, doch seine Macht war gebrochen. Sten Sture der Ältere blieb bis 1497 Reichsverweser und übernahm diese Aufgabe nochmals 1501–1503. Nach diesem folgte Svante Sture bis 1512. Nach der kurzen Amtszeit von Erik Trolle wurde Sten Sture der Jüngere 1512 Reichsverweser. Erst 1520 gab es mit Christian II. wieder einen letzten gemeinsamen König der Union.
Johann I.
König Hans regierte von 1481 bis 1513, wurde aber in Schweden nur teilweise als Oberhaupt anerkannt und musste sich dort weiterer Aufstände erwehren.
Christian II.
Der seit 1513 regierende dänische König Christian II. versuchte ab 1517, Schweden wieder zu unterwerfen. 1520 besiegte er Sten Sture den Jüngeren in einer Schlacht, in der letzter tödlich verwundet wurde. Der Aufstand brach zusammen und Christian versprach Amnestie.
Am 4. November 1520 wurde Christian II. in Stockholm zum schwedischen König gekrönt. Zu dem dreitägigen Fest kamen auch die schwedischen Adeligen und Bürger, die vorher in Opposition zu Dänemark gestanden hatten. Am 7. November wurden diese verhaftet und von Erzbischof Trolle, der 1517 abgesetzt worden war, der Ketzerei beschuldigt. Im Stockholmer Blutbad wurden über 80 führende schwedische oppositionelle Adlige und Kirchenvertreter des Reichsrats verurteilt und umgebracht; daraufhin erhob sich die Bevölkerung in ganz Schweden.
1521 wurde der dänische Einfluss aus dem Reich zurückgedrängt und 1523 schied Schweden mit der Wahl Gustav I. Wasa zum König endgültig aus der Kalmarer Union aus. Die Dänisch -norwegische Personalunion blieb noch bis 1814 bestehen. -norwegische Personalunion blieb noch bis 1814 bestehen.
Wappen
Siegel Eriks VII. von Pommern aus dem Jahre 1398
Das Dannebrog-Kreuz wurde seit der Zeit Eriks VII. von Pommern Bestandteil des Wappen des Monarchen; das gleiche gilt für den eine Axt tragenden Löwen Norwegens und die Wappensymbole Schwedens. Die drei Kronen waren eigentlich das Wappen Schwedens, symbolisierten dann aber auch die drei nordischen Reiche der Kalmarer Union. Im kreuzgeteilten Hauptschild des Siegel Eriks VII. stehen oben links die drei von Herzen umgebenen dänischen Löwen, oben rechts die drei Kronen, die wie der Löwe der Folkunger über drei schmalen Schrägbalken für Schweden stehen und unten der pommersche Greif. Im Herzschild erscheint der die Axt tragende Löwe Norwegens.
Ergänzungen während der Kalmarer Union
Christian I. fügte 1449 einen Löwen über neun Herzen für den Titel „der Goten“ hinzu, vermutlich im Rahmen seiner Bemühungen um die Herrschaft über Schweden, wo der patriotische Mythos von den Schweden als Nachkommen der siegreichen Goten erheblich zum nationalen Selbstverständnis beitrug. Für den Titel „der Wenden“ wurde 1440 der drachenähnliche Lindwurm hinzugefügt, der das Heidentum symbolisieren und damit auf den früheren Sieg über die heidnischen Wenden verweisen kann. Die zwei oldenburgischen Balken wurden in das Wappen Christians I. eingefügt; im Königswappen aus der Zeit Frederiks I. kommt auch das Delmenhorster Kreuz vor. Die zwei Schleswigschen Löwen sind seit 1245 bekannt und wurden 1460 Teil des Wappens des Monarchen; ebenso das Holsteinische Nesselblatt, das ursprünglich das Wappen der Schauenburger war. Als weitere Wappenfelder wurden verwendet: das Agnus Dei von Gotland, der Adler von Ösel, die Krone von Fehmarn und der Bornholmer Drache. Stierhörner, bisweilen mit Hermelin bezogen, mit Pfauenfedern besteckt waren königliche Helmzier vom Ende des 13. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre des 15. Jahrhunderts.
Literatur
- Detlef Kattinger u.a. (Hrsg.): „Huru thet war talet j kalmarn“ - Union und Zusammenarbeit in der Nordischen Geschichte. 600 Jahre Kalmarer Union (1397–1997). Verlag Dr. Kovac, Hamburg 1997, 432 S., ISBN 3-86064-584-6.
- Karl Pagel: Die Hanse. Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1983, ISBN 3-14-508879-3.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Adolf III. (Schauenburg und Holstein)
Adolf III., Graf von Schauenburg und Holstein (* 1160; † 3. Januar 1225) aus dem Geschlecht der Schauenburger war der Gründer einer Handels- und Marktsiedlung am westlichen Alsterufer.
Leben
Adolf III. war der einzige Sohn des Grafen Adolf II. (Schauenburg und Holstein) und seiner Ehefrau Mechthild von Schwarzburg-Käfernburg, einer Tochter von Graf Sizzo III. von Schwarzburg-Käfernburg.[1] Schwarzburg-Käfernburg.[1]
Adolf III. folgte seinem Vater 1164 in der Grafschaft zunächst unter der Vormundschaft seiner Mutter. Er war eine Stütze Heinrichs des Löwen. Er begleitete Heinrich auf dessen Feldzug gegen Philipp I. von Heinsberg, den Erzbischof von Köln, machte die Schlacht bei Halerfeld am 1. August 1180 (nordwestlich von Osnabrück) an der Seite von Graf Bernhard I. von Ratzeburg mit, und bekam damals die entscheidenden Rechte im Mittelwesergebiet von Heinrich dem Löwen, die zur Basis der Grafschaft Schauenburg wurden[1].
1180 fiel Adolf von Heinrich dem Löwen ab, woraufhin ihn dieser aus Holstein vertrieb. Adolf schlug sich auf die Seite Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, mit dessen Hilfe er nach dem Sturz des Löwen seine Herrschaft 1181 wiederherstellte. Mit dem Barbarossa-Privileg 1188 beschnitt Friedrich I. jedoch den Anspruch Adolfs auf die Stadt Lübeck. Adolf begleitete 1189 Barbarossa beim Dritten Kreuzzug ins Heilige Land. Im August 1190 erreichte er so Tyrus, von wo er das Kreuzzugsheer verließ und auf dem Seeweg nach Holstein zurückkehrte, um seine Lande erneut gegen den aus dem Exil zurückgekehrten Heinrich den Löwen zu verteidigen. 1196 begab er sich erneut ins Heilige Land, diesmal mit dem Kreuzzug Heinrichs VI.; er kehrte 1198 zurück.
In die Regierungszeit Adolfs III. fällt der Versuch der Expansion Dänemarks unter König Knut VI. und dessen Bruder und Nachfolger Waldemar II.. Diese Expansion war, nachdem Adolf III. 1201 die Schlacht bei Stellau verloren hatte und später in Hamburg von Waldemar II. gefangen genommen worden war, für einige Jahrzehnte erfolgreich. Nach seiner Gefangennahme verzichtete Adolf III. 1203 auf die Grafschaft Holstein und zog sich in die Grafschaft Schauenburg zurück, um die Befreiung aus seiner Gefangenschaft zu erlangen[2]. Erst seinem Sohn Adolf IV. gelang die Rückeroberung Holsteins.
Um das Jahr 1224 verzichtete Graf Adolf III. auf Ansuchen des Bischofs von Minden Konrad I. von Rüdenberg auf seine vogteilichen Rechte an den Kirchengütern des Klosters Wennigsen. Diese Urkunde ist gleichzeitig die erste schriftliche Urkunde dieses Klosters[3] sowie eine der ersten schriftlichen Urkunden des Ortes Wennigsen (Deister).
Er ist ein Cousin von Adolf I. von Dassel.
Ehe und Nachkommen
Graf Adolf III. war seit 1182 mit Adelheid von Assel († 25. Dezember 1185) und danach ab 1189 mit Adelheid von Querfurt († um 1210) verheiratet[1].
Mit letzterer hatte er sechs Kinder:
- Adolf IV. († 1261)
- Konrad († 1237/38)
- Bruno von Schauenburg († 1281), Bischof von Olmütz
- Mechthilde († um 1264) ∞ Otto I. von Tecklenburg
- Margarete ∞ Johann I. von Adensen
- Hildegunde († nach 1230) ∞ Burchard I. von Oldenburg
Literatur
- Karl Jansen: Adolf III., Graf von Holstein. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 107 f.
- Heinz Maybaum: Adolf III., Graf von Holstein. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1. Duncker & Humblot, Berlin 1953, S. 78.
- Detlev von Liliencron: Die Schlacht bei Stellau 1201. http://gutenberg.spiegel.de/liliencr/stellau/stellau.htm am 24. Juli 2006
Quellen
- ↑ a b c Genealogie Graf von Holstein-Wagrien bei genealogie-mittelalter.de am 14. Januar 2007
- ↑ Holstein (Geschichte). In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Bd. 8, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 663.
- ↑ 750 Jahre Wennigsen 1200–1950. Herausgegeben vom Vorbereitenden Ausschuss für die 750-Jahrfeier der Gemeinde Wennigsen Gedruckt 1950 bei den Buchdruckwerkstätten Hannover, S. 8
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Grafen von Schauenburg und Holstein
Das Adelsgeschlecht Grafen von Schauenburg und Holstein stammt ursprünglich von der Schauenburg bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) an der Weser. Neben der Stammgrafschaft mit ihren Residenzorten Bückeburg und Stadthagen wurde die Familie auch mit der Grafschaft Holstein belehnt. In ihrem Stammland wurde aus Schauenburg später Schaumburg.
Geschichte der Grafenfamilie
Die Familie teilte sich ab 1261 im Laufe der Zeit in mehrere Linien. Dadurch gab es mehrere Herrscher gleichzeitig in Holstein:
- Holstein-Itzehoe (1261–1290)
- Holstein-Kiel (1261–1390)
- Holstein-Segeberg (1273–1308/1350)
- Holstein-Plön (1290–1390)
- Holstein-Pinneberg oder Holstein-Schauenburg (1290–1640)
- Holstein-Rendsburg (1290–1459)
Die Teilungen endeten 1390; die Rendsburger Linie hatte den größten Teil Holsteins inne. Lediglich die kleine Grafschaft Holstein-Pinneberg bestand weiter.
Folgende Grafen waren die wichtigsten für Holstein
- (1110–1130) Adolf I. Graf von Schauenburg und Holstein (* ?; † 13. November 1130)
- (1130–1164) Adolf II. Graf von Schauenburg und Holstein (* 1128]; † 6. Juli 1164 in Demmin)
- (1164–1225) Adolf III. Graf von Schauenburg und Holstein (*ca. 1160; † 3. Januar 1225)
- (1225–1238) Adolf IV. Graf von Schauenburg und Holstein (* vor 1205; † 8. Juli 1261 in Kiel)
- (1239–1290) Gerhard I. Graf von Holstein-Itzehoe (*ca. 1232; † 1290)
- (1290–1315) Adolf VI. Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg (*ca. 1256; † 1315)
- (1290–1304) Heinrich I. Graf von Holstein-Rendsburg (*ca. 1258; † 1304)
- (1304–1340) Gerhard III. der Große Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig und Jütland (*ca. 1293; † 1340)
- (1340–1382) Heinrich II. der Eiserne Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig (*ca. 1317; † 1382)
- (1382–1404) Gerhard VI. Graf von Holstein-Rendsburg, Herzog von Schleswig (* ; † 1404)
- (1404–1427) Heinrich IV. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1397; † 1427)
- (1427–1433) Gerhard VII. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1404; † 1433)
- (1427–1459) Adolf VIII. Graf von Holstein, Herzog von Schleswig (* 1401; † 1459)
Da Adolf VIII. ohne Erben verstarb, wählte der holsteinische Adel 1460 dessen Neffen, den seit 1448 regierenden König Christian I. von Dänemark, zum neuen Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein. Damit kam das Haus Oldenburg als Nachfolger der Schauenburger an die Macht in Schleswig und Holstein und herrschte hier bis 1864.
Die Pinneberger Familie herrschte noch bis 1640 in der kleinen Grafschaft Holstein-Pinneberg sowie im Schauenburger Stammland.
Bedeutung der Grafenfamilie in Niedersachsen
Die Schaumburger Grafen waren im 13. Jahrhundert Gografen des Bezirks Wennigsen (Deister) und bereits seit über 100 Jahren im Deister-Vorland begütert. Dieser Umstand brachte es mit sich, dass den Grafen von Schauenburg und Holstein die Vogtei des Klosters Wennigsen unterstellt wurde. Die Grafenfamilie stiftete Eigentum an das Kloster[1].
Anmerkungen
- ↑ 750 Jahre Wennigsen 1200–1950 , herausgegeben vom Vorbereitenden Ausschuss für die 750-Jahrfeier der Gemeinde Wennigsen; gedruckt 1950 bei den Buchdruckwerkstätten Hannover, S. 8-9
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wilhelm I. (Braunschweig-Wolfenbüttel)
(Weitergeleitet von Wilhelm I. (Braunschweig-Lüneburg))
Wilhelm, der Siegreiche, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (* 1392; † 1482) aus dem Geschlecht der Welfen war von 1416 bis 1428 Fürst von Lüneburg, von 1428 bis 1432 sowie von 1473 bis 1482 Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel, von 1432 bis 1473 Fürst von Calenberg sowie von 1463 bis 1473 Fürst von Göttingen.
Leben
Wilhelm übernahm nach dem Tode seines Vaters Heinrich 1416 gemeinsam mit seinem Bruder Heinrich die Regierung des Fürstentums Lüneburg. 1428 kam es zwischen den Brüdern und ihrem in Wolfenbüttel regierenden Onkel Bernhard zu einer erneuten Aufteilung der welfischen Besitztümer, bei der die Brüder Wilhelm und Heinrich das um das Land zwischen Deister und Leine, dem späteren Fürstentum Calenberg, erweiterte Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel zugesprochen bekamen und Bernhard das Fürstentum Lüneburg erhielt. Nachdem einer gemeinsamen Herrschaftszeit teilten sie 1432 das Gebiet erneut auf. Während Heinrich das Wolfenbüttler Land erhielt, wurde Wilhelm mit dem neugebildeten Fürstentum Calenberg abgefunden. Die Herrschaft, die Wilhelm damals erhalten hatte, hatte noch keinen Namen. Sie bestand aus den ehemals zum Fürstentum Lüneburg gehörenden Rechten zwischen Deister und Leine, sowie der ehemaligen Grafschaft Wölpe, der Herrschaft Hallermunt sowie den Herrschaften Homburg und Everstein. Da die welfischen Fürsten alle den Titel Herzog zu Braunschweig und Lüneburg führten und die von ihnen regierten Gebiete Teilfürstentümer des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg waren, wurden die von ihnen regierten Länder nach der wichtigsten Burg oder Stadt benannt. Wilhelm wohnte häufig auf der Burg Calenberg und ließ von hier aus das Territorium verwalten. Vermutlich ist deswegen der Name Fürstentum Calenberg in dieser Zeit entstanden. Es gelang Wilhelm kurz darauf 1442 bzw. endgültig 1463, auch die Herrschaft über das Fürstentum Göttingen wahrzunehmen. 1473 erbte Wilhelm von seinem söhnelosen Bruder auch das Fürstentum Wolfenbüttel, trat aber die Herrschaft über Calenberg an seine Söhne Wilhelm d.J. und Friedrich, genannt „der Unruhige“ oder „Turbulentus“, ab.
Nachkommen
Wilhelm war in erster Ehe seit 1423 mit Cäcilie von Brandenburg, Tochter von Friedrich I. von Brandenburg, und in zweiter Ehe seit 1466 mit Mathilde von Schauenburg verheiratet. Aus erster Ehe stammen zwei Söhne:
- Friedrich (1424–1495)
- Wilhelm (1425–1503)
Literatur
- Christa Geckler: Die Celler Herzöge – Leben und Wirken 1371–1705. Georg Ströher, Celle 1986, ISBN 3-921744-05-8 (formal falsche ISBN)
- Paul Zimmermann: Wilhelm der Aeltere. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42. Duncker & Humblot, Leipzig 1897, S. 733–738.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wartislaw IX.
Herzog Wartislaw IX. von Pommern-Wolgast (* um 1400; † 17. April 1457 in Wolgast) war der älteste Sohn des Herzogs Barnim VI. und der Veronika von Hohenzollern.
Er herrschte von 1417 bis zu seinem Tod 1457 und war mit Sophia von Sachsen-Lauenburg verheiratet (seit ca. 1420).
Sie bekamen 4 Kinder. Diese waren Erich II., Wartislaw X., Elisabeth und Christoph, wobei letzterer früh verstarb.
In der Jugend erlebte Wartislaw IX. schlimme Dinge. Der Erblandmarschall von Pommern-Wolgast, Degener Buggenhagen, wurde 1417 oder 1419 vor seinen Augen von Henneke von Behr, dem Günstling der Herzogin Agnes, Witwe seines Onkels Wartislaw VIII., erschlagen. Grund war, dass Buggenhagen zuvor einen anderen Günstling der Herzogin, Curdt Bonow, getötet hatte. Henneke von Behr wurde verfolgt und den chronikalischen Überlieferungen zufolge versank er entweder beim Fluchtversuch von der Burg Usedom oder wurde später in seiner Burg Nustrow gefangen genommen und in Stralsund hingerichtet. Wohl auch unter dem Eindruck dieser Ereignisse einigte sich Wartislaw IX. 1421 mit den Städten und dem Adel seines Landes auf die Einrichtung von sogenannten Quatembergerichten, um die Rechtsordnung zu sichern.
Den Städten unter Führung des mächtigen Stralsund, hier vor allem des Bürgermeisters Otto Voge, machte er im sogenannten Goldenen Privilegium 1452 umfangreiche Zugeständnisse. Bereits 1425 musste sich Wartislaw IX. die Herrschaft in Vorpommern nördlich der Peene mit seinem Bruder Barnim VII. und seinen Vettern Barnim VIII. und Swantibor III., den Söhnen Wartislaws VIII., teilen. Da er jedoch alle überlebte, konnte er Pommern-Wolgast westlich der Swine am Ende seiner Herrschaft wieder vereinen. Nach außen musste er sich wie seine Stettiner Vettern mit den Machtambitionen der seit 1411/17 in Brandenburg herrschenden Hohenzollern auseinandersetzen. Für ihn ging es insbesondere um die Pfandbesitzungen Torgelow und Pasewalk, die die Wolgaster Herzöge seit 1369 innehatten. Im Frieden von 1448 konnte Wartislaw diese Besitzungen sichern.
Bleibenden Verdienst erwarb er sich durch die landesherrliche Förderung bei der Gründung der Universität Greifswald 1456. Nur ein halbes Jahr nach der feierlichen Eröffnung der "alma mater gryphiswaldensis" starb er, hatte aber mit zahlreichen Schenkungen und Rechtsverleihungen deren Bestand maßgeblich gesichert.
Literatur
Max Bär: Wartislav IX., Herzog von Pommern-Wolgast. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41. Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 212 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Barnim VIII. (Pommern)
Barnim VIII. (* zwischen 1405 und 1407; † zwischen 15. und 19. Dezember 1451)[1] war Herzog von Pommern-Wolgast-Barth.
Barnim VIII. war der Sohn des Herzogs Wartislaw VIII. von Pommern-Wolgast. Nach dem Tod des Vaters 1415 hatte zunächst dessen Witwe Agnes von Sachsen-Lauenburg die Vormundschaft über ihre Söhne Barnim VIII. und Swantibor II. sowie über die Söhne ihres Schwagers Barnim VI., Wartislaw IX. und Barnim VII. inne. Agnes stand dabei ein Regierungsrat unter Kord Bonow zur Seite. Mit Erreichen der Volljährigkeit aller Thronerben erfolgte 1425 eine Landesteilung im Herzogtum Pommern-Wolgast. Dabei erhielten Barnim VIII. und Swantibor das Herzogtum Barth.
Barnim VIII. beteiligte sich am Kaperkrieg Dänemarks gegen die Hanse. Im Jahre 1427 führte er auf der Seite seines Verwandten, des dänischen Königs Erich von Pommern, die dänisch-schwedische Flotte, die der hanseatischen im Öresund eine schwere Niederlage beibrachte. Danach kaperte er einen Konvoi hanseatischer Handelsschiffe, der in die Ostsee einlaufen wollte.[2]
Barnim VIII. beteiligte sich auch an Ritterturnieren, wobei er 1434 von dem Stralsunder Ratsherren und späteren Bürgermeister Arnd Voth vom Pferd gestoßen wurde.[2] Barnim und Swantibor teilten ihr Herzogtum 1435 noch einmal, wobei Barnim den festländischen Teil außer der Stadt Stralsund erhielt. Nach dem Tod Swantibors 1440 fiel die Insel Rügen wieder an ihn zurück. 1441 erwarb er den Zingst vom Kloster Hiddensee.[3] Mit Einverständnis seiner Vettern verpfändete er später seiner Nichte Katharine von Werle die Länder Barth, Zingst und Damgarten für 20.000 Gulden. 1445 verteidigte er gemeinsam mit Barnim VII. die Stadt Pasewalk gegen den Kurfürsten Friedrich II. von Brandenburg.[4]
Barnim VIII. starb an der Pest und wurde im Kloster Neuenkamp beigesetzt.[1]
Er war verheiratet mit Anna von Wunstorf. Mit ihr hatte er die Tochter Agnes (1434–1512), die 1449 Friedrich (III.) von Brandenburg, den Fetten, und 1478 Georg II. von Anhalt heiratete.[1]
Literatur
- Adolf Häckermann: Barnim VII. und Barnim VIII.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 79.
Einzelnachweise
- ↑ a b c Barnim VIII. bei www.xxx
- ↑ a b Konrad Fritze: Pommern und die Hanse. In: Beiträge zur Geschichte Vorpommerns: Die Demminer Kolloquien 1985–1994. Seite 233–234. Thomas Helms Verlag, Schwerin 1997, ISBN 3-931185-11-7
- ↑ Johannes Hinz: Pommern-Wegweiser durch ein unvergessenes Land. Seite 81. Adam Kraft Verlag, Würzburg 1991, ISBN 3-8083-1195-9
- ↑ Pasewalk in der Geschichte (PDF; 345 KB
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Kasimir V. (Pommern)
Kasimir V., nach anderer Zählung Kasimir VI. (* nach 1380; † 13. April 1435) war ein Herzog von Pommern aus dem Greifenhaus. Er regierte in Pommern-Stettin ab 1413 gemeinsam mit seinem Bruder Otto II., ab 1428 alleine.
Leben
Kasimir V. war der jüngste Sohn von Herzog Swantibor III. (* 1351; † 1413), der in Pommern-Stettin regierte. Kasimirs ältere Brüder waren Otto II. (* um 1380; † 1428) und Albrecht († vor 1412).
Sein Vater ließ ihn an der Schlacht bei Tannenberg (1410) als Führer eines pommerschen Kontingents auf Seiten des Deutschen Ordens teilnehmen. Die Schlacht endete mit einer Niederlage des Ordens; Kasimir wurde von den polnischen Siegern gefangen genommen, aber bald wieder freigelassen. In der Schlacht am Kremmer Damm (1412) kämpften Kasimir V. und sein älterer Bruder Otto II. gegen Brandenburg.
Nach dem Tode Herzog Swantibors III. im Jahre 1413 übernahmen Kasmir V. und sein älterer Bruder Otto II. gemeinsam die Herrschaft in Pommern-Stettin. Die Kämpfe mit Brandenburg gingen weiter. 1415 erwirkte Friedrich bei König Sigismund sogar für einige Zeit die Reichsacht gegen Otto II. und Kasimir V. Durch Brandenburg wurde die Reichsunmittelbarkeit Pommerns in Frage gestellt. Zunächst erteilte König Sigismund im Jahre 1417 Otto II. und Kasimir V. nur eine Belehnung, die vorbehaltlich der Rechte Brandenburgs erfolgte. Kasimir V. konnte dann 1424 für sich und seinen Bruder eine uneingeschränkte Belehnung erwirken, indem er König Sigismund in Ofen in Ungarn besuchte.
Nachdem Otto II. im Jahre 1428 kinderlos starb, setzte Kasimir V. die Herrschaft über Pommern-Stettin allein fort. Er unterdrückte einen Aufruhr in der Stadt Stettin. Er ließ die Rädelsführer hinrichten, die Stadt musste ein hohes Strafgeld zahlen und die Hanse verlassen. Herzog Kasmimir V. starb 1435 und wurde in der Ottenkirche in Stettin beigesetzt. In die Regierung über Pommern-Stettin folgte ihm sein Sohn Joachim der Jüngere.
Ehe und Nachkommen
Herzog Kasimir V. war zweimal verheiratet. Seine erste Gemahlin war Katharina, die Tochter von Herzog Bernhard I. von Braunschweig-Lüneburg. Aus dieser Ehe stammen:
- Joachim der Ältere († vor 1424)
- Joachim der Jüngere (* nach 1424; † 1451)
- Anna († nach 1447), ∞ Johann V. von Mecklenburg-Schwerin
Nach dem Tode Katharinas heiratete er Elisabeth, Tochter von Herzog Erich I. von Braunschweig-Grubenhagen. Aus dieser Ehe stammt:
- Margaretha (* um 1439), ∞ Graf Albrecht III. von Lindow-Ruppin
Nach Herzog Kasimirs Tod wurde seine Witwe Elisabeth Äbtissin von Gandersheim.
Zählung
Die Zählung der Herrscher des Greifenhauses ist seit jeher verwickelt. Von Alters her herrscht hier eine Ungleichheit, die manche Verwirrung hervorruft.[1] Die modernere Zählung als Kasimir V. ergibt sich, wenn man nur die Angehörigen des engeren Greifenhauses zählt. Zählt man hingegen einen Kasimir aus der Seitenlinie der Swantiboriden mit, so ergibt sich die Zählung als Kasimir VI., die in der älteren Literatur üblich war.
Literatur
- Gottfried von Bülow: Otto II. und Casimir VI.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 25. Duncker & Humblot, Leipzig 1887, S. 785–787.
- Martin Wehrmann: Genealogie des pommerschen Herzogshauses. Verlag Leon Sauniers Buchhandlung, Stettin 1937, S. 70–71.
- Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern. Band 2. 2. Auflage. Verlag Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1921. (Nachdruck: Augsburg 1992, ISBN 3-89350-112-6)
Fußnoten
- ↑ Martin Wehrmann: Genealogie des pommerschen Herzogshauses. Verlag Leon Sauniers Buchhandlung, Stettin 1937, S. 15.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Heinrich IV. (Holstein)
Heinrich IV. von Holstein (* 1397; † 28. Mai 1427) war 1404 bis 1427 Graf von Holstein und Herzog von Schleswig. Er war der Sohn des Gerhard VI. von Holstein (gefallen 1404) und der Katharina Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (gestorben 1417/1422). Heinrich IV. fiel am 28. Mai 1427 bei der Belagerung von Flensburg und wurde in St. Laurentius in Itzehoe begraben
Literatur
Karl Jansen: Heinrich IV., Graf von Holstein. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11. Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 525 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Tidemann Steen
Tidemann Steen (* in Hildesheim; † 1441 in Lübeck) war ein Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.
Steen wurde 1405 als Ältermann der Schonenfahrer bekannt. Um 1416 wurde er in den Rat der Stadt Lübeck berufen uns vertrat diese von da an auf allen wichtigen Hansetagen. Er entwickelte außenpolitisches Talent in zahlreichen Missionen für den Stadtstaat und verhandelte mehrfach mit König Erik VII. von Dänemark. 1427 wurde er Bürgermeister und zugleich Oberbefehlshaber der Flotte der Hanse im Einsatz gegen Dänemark. Die von ihm kommandierte Flotte wurde von den Dänen vernichtend geschlagen. Nach Rückkehr nach Lübeck wurde er ob der Niederlage seiner Ämter enthoben und im Marstall in Ketten gelegt. Die Haft wurde auf Betreiben von Fürsprechern gemildert, ab 1430 auf Einwirkung des Kaisers Sigismund in Hausarrest umgewandelt und Ende 1434 aufgehoben.
Die im Öresund erlittene Niederlage löste in mehreren Schwesterstädten erhebliche Unruhen aus. In Wismar wurden mit Johann Bantzkow und Hinrik van Haren zwei Bürgermeister noch im gleichen Jahr zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gleiches Schicksal ereilte einen Hamburger Ratsherrn Anfang 1428.
Literatur
- Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie. Lübeck, Schmidt-Römhild, 1925, Nr. 467.
- Carl Friedrich Wehrmann: Steen, Tidemann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 35. Duncker & Humblot, Leipzig 1893, S. 545–547.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Erik V. (Dänemark)
Erich V. Klipping, dän. Erik V. Klipping, zeitweise auch Erik V. Glipping genannt (* um 1249 auf Schloss Ålholm (bei Nysted), Lolland; † 22. November 1286 in Findrup bei Viborg) war König von Dänemark.
Leben
Er war der einzig überlebende Sohn König Christophs I. von Dänemark (* um 1219; † 1259) und dessen Frau Sambiria (* um 1230; † 1282).
Bereits 1254 wurde Erik als Thronfolger gewählt. Eriks Vater Christoph I. hatte allerdings seine letzten Regierungsjahre mit einem bizarren Streit gegen Erzbischof Jakob Erlandsen von Lund sowie gegen die Familie seines Vorgängers und Bruders Abel verbracht, so dass es wie ein Wunder anmutet, dass Erik nach dem vermutlich gewaltsamen Ende seines Vaters Weihnachten 1259 in Viborg zum König gekrönt wurde. Bereits 1261 geriet er nach der Schlacht auf der Lohheide in Gefangenschaft, wurde in Holstein interniert und kam erst 1264 nach Intervention durch Markgraf Johann I. wieder frei.
Erik eroberte ab 1271 zwar Flensburg, Alsen und Fehmarn, doch war seine gesamte Regierungszeit durch Anarchie geprägt. 1274 entledigte er sich seines alten Widersachers, Erzbischof Jakob Erlandsen, durch einen Armbrustschuss auf Rügen. 1282 wurden seine ohnehin faktisch schon eingeschränkten Rechte durch eine vom dänischen Adel aufgezwungene Handfeste weiter beschränkt.
Am 22. November 1286 wurde Erik in Finderup (Jütland) durch mehrere Dolchstiche ermordet. Die Identität der Mörder ist nicht eindeutig geklärt, als Drahtzieher wird sein Cousin Jakob von Halland genannt. Er liegt im Dom zu Viborg begraben.
Sein Beiname "Klipping" ("Klippe" ([1]) = vom Zain oder Silberbesteck abgeschnittene, quadratische Münze, s. [2]) war von dieser Scheidemünze abgeleitet. Die Herleitung seines alternativen Beinamens "Glipping" ("Blinzler") von dän. "glippe" = "(mit den Augen) zwinkern" wird historisch verworfen.
Ehe und Nachkommen
Mit seiner Frau Agnes (* nach 1255, † 1304), der Tochter Johanns I. von Brandenburg, die er 1273 heiratete, bekam er zahlreiche Kinder:
- Erik VI. Menved (* 1274; † 13. November 1319), König von Dänemark (1286 - 1319)
- Waldemar († 1304)
- Richsa († vor 27. Oktober 1308), ∞ 1292/1293 Nikolaus II., Fürst von Werle
- Christoph II. (* 1276; † 2. August 1332), König von Dänemark (1319 - 1326 und 1330 - 1332)
- Märta († 2. März 1341), ∞ 1298 Birger Magnusson, König von Schweden
- Katharina (* 1278, † 1283)
- Elisabeth (* 1280, † 1283)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Philippa von England - Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden, Herzogin von Pommern
Prinzessin Philippa von England, KG [1] (* 4. Juni 1394 auf Peterborough Castle, England; † 5. Januar 1430 in Vadstena, Schweden) war eine englische Prinzessin aus dem Hause Lancaster und durch Heirat Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden, sowie Herzogin von Pommern.
Leben
Philippa war die jüngste Tochter von König Heinrich IV. von England (1367–1413) und seiner Frau Mary de Bohun (1369–1394), sowie die Schwester des englischen König Heinrich V., Herzog Thomas von Clarence, Herzog John von Bedford, Herzog Humphrey von Gloucester und der jung verstorbenen Kurfürstin Blanca von der Pfalz.
Am 26. Oktober 1406 heiratete Prinzessin Philippa in Lund (Schweden) den Herzog und späteren dänisch-norwegischen und schwedischen König Erik I. (VII.) von Pommern (1382–1459), Großneffe der bedeutenden dänisch-norwegischen Königin Margarethe I. Die Heirat sollte ihm bei der Stabilisierung seines nordeuropäischen Großreiches helfen. Seine Regierung war geprägt von Konflikten mit der Hanse, dem Deutschen Orden und dem Herzogtum Holstein. Aus der Ehe gingen keine Kinder hervor.
Während der Abwesenheit ihres Mannes übernahm sie die Regentschaft, und in Schweden, wo sie große Ländereien besaß (Mitgift bzw. Morgengabe), verbrachte sie längere Zeit und war häufiger Gast im Kloster von Vadstena in der Provinz Östergötland. [2] Der Versuch des dänischen Königs Erich VII., Skandinavien aus der Abhängigkeit zu lösen und die Einführung des Sundzolls, führte 1420 bis 1435 zu einem neuerlichen Krieg, in dem Dänemark wieder unterlag und der 1435 mit dem (nach 1365 zweiten) Frieden von Vordingborg beendet wurde. Bei einem erneuten Auslandaufenthalts ihres Mannes (1423–1424, Wallfahrt nach Jerusalem) bildete sie mit einigen Mitgliedern der Hanse eine Gültigkeit des Münzsystems (Königin Philippa Søsling) [3], und 1428 organisierte sie erfolgreich die Verteidigung von Kopenhagen gegen die angreifende deutsche Hanse (hauptsächlich deutscher Städtebund). [4]
Königin Philippa starb am 5. Januar 1430 im Kloster von Vadstena, wo sie auch bestattet wurde. Nach ihrem Tod heiratete König Erik VII. um 1430 seine Konkubine Cäcilia, eine Hofdame von Philippa.
Literatur
• Heinz Barüske: Erich von Pommern. Ein nordischer König aus dem Greifengeschlecht. Rostock 1997, ISBN 3-356-00721-1
Anmerkungen
- ↑ List of Ladies of the Garter (1408)
- ↑ Königin Philippa als Wohltäter des Birgittenorden
- ↑ Die Münzen Dänemarks (bis etwa 1625)
- ↑ Hans Christian Andersen: Godfather's Picture Book (1868)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Blanca von England - Tochter Heinrichs IV. von England
Prinzessin Blanca von England (* Frühjahr 1392, Peterborough Castle; † 22. Mai 1409, Hagenau, Elsass) war durch Heirat Pfalzgräfin in der Kurpfalz. Sie starb bevor ihr Ehemann Ludwig III. (Pfalz) 1410 als Kurfürst zur Regierung gelangte.
Leben
Sie war die Tochter des englischen König Heinrich IV., aus dem Haus Plantagenet-Lancaster, und seiner Gattin Gräfin Mary de Bohun.
Eine Ehe zwischen der ältesten Tochter Heinrich IV., Blanca (auch Blanche), und dem ältesten Sohn des neugewählten deutschen König Ruprecht I., Ludwig III. sollte die beiden neuen und nicht unumstrittenen königlichen Häuser festigen (pfälzisch-englische Beziehung). Heinrich IV. war dem abgesetzten König Richard II. (1399) gefolgt, König Ruprecht I. (= gleichzeitig Kurfürst Rupprecht III. von der Pfalz) hatte aktiv die Absetzung von König Wenzel (1400) betrieben.
Der Heiratsvertrag wurde nach Festsetzung einer Mitgift von 40.000 Nobel und sonstiger Vereinbarungen unter Vermittlung der Stadt Köln am 7. März 1401 in London abgeschlossen. Als Heiratsgut brachte die Braut u.a. auch die sogenannte "Böhmische Krone" bzw. "Pfälzer Krone", in den wittelsbacher Familienbesitz ein, die sich noch heute in der Schatzkammer des Residenzmuseums zu München befindet. Es ist die älteste erhaltene englische Krone und war vermutlich die Brautkrone der Königin Anne von England.[1] [2]
Die Hochzeit zwischen der zehnjährigen Prinzessin und dem 26 Jahre alten Prinzen fand am 6. Juli 1402 im Dom zu Köln statt. Trotz der politischen Heirat soll die Ehe glücklich gewesen sein. Vier Jahre später gebar Blanca vierzehnjährig einen Sohn, Ruprecht den Engländer (1406−1426).
Im Jahre 1409 starb die neuerlich schwangere Pfalzgräfin Blanca an Fieber zu Hagenau/Elsass. In feierlichem Zug überführte man die Leiche nach Neustadt und setzte sie in der Stiftskirche bei. Ihr Mann berichtete seinem Schwiegervater in einem von dort am 4. Juni 1409 datierten Brief, dass Blanca im Mai, während eines gemeinsamen Aufenthalts mit ihm in Hagenau, von intermittierenden Fieberschüben befallen wurde, was umso bedenklicher gewesen sei, als sie im sechsten Monat schwanger war. Nachdem der Anfall sich gelegt hatte und man schon auf völlige Genesung der Kranken hoffte, sei ein dauerhaftes Fieber eingetreten, welches seine zarte junge Frau so stark mitnahm, dass man täglich mit ihrem Ableben rechnete. Es stellten sich auch zahlreiche Ohnmachten und Nasenbluten ein, welch letztere die Ärzte zwar mit Gottes Hilfe hätten stillen können; man erteilte der Prinzessin aber trotzdem die Sterbesakramente. So "ist an dem unseligsten 22. Mai, im Morgengrauen, meine Gemahlin von dieser schlechten Welt in eine bessere eingegangen", wie es Ludwig III. selbst formulierte. Am folgenden Tage habe in Neustadt die Beisetzung stattgefunden.
Kurfürst Ludwig III. ging erst acht Jahre nach dem Ableben Blancas mit Mathilde von Savoyen, Tochter des Fürsten Amadeus von Savoyen, eine neue Ehe ein, der sechs Kinder entsprangen
Blancas Ruhestätte befindet sich bis heute im katholischen Chor der Stiftskirche (Neustadt an der Weinstraße), etwas nördlich von jener des Kurfürsten Ruprecht I. (Pfalz) und seiner Gemahlin Beatrix von Berg. Die beiden nebeneinanderliegenden, kurfürstlichen Grabstätten sind durch Bronzeinschriften im neuzeitlichen Fußboden sichtbar gemacht, die von Pfalzgräfin Bianca nicht, da Kirchenbänke darauf stehen. Die originale Abdeckplatte, mit gotischer Majuskelinschrift, aber ohne Bilddarstellung, befindet sich derzeit (2010) an einer Wand in der nördlichen Chorkapelle. Bei der Entnahme bzw. Sicherung der im Kirchenboden verlegten Originalgrabplatten wurden im Dezember 1906 die drei gemauerten Gräber unversehrt aufgefunden, jedoch mit Schutt und Grundwasser angefüllt. Aus Pietätsgründen wurden sie "nicht weiter untersucht, sondern wieder zugedeckt", wie es im damaligen Bericht an das Bayerische Innenministerium heißt (LA Speyer, H3, 8370, Seite 71).
An der Chordecke der als Memoria des Hauses Wittelsbach gegründeten Stiftskirche zu Neustadt befindet sich eine Darstellung des "Jüngsten Gerichtes" aus der Zeit um 1420, mit vor Christus knienden Großfiguren von Kurfürst Ludwig III., seiner Eltern und seiner ersten Gattin Blanca von England. Man geht davon aus, daß Ludwig III. die prachtvollen Gemälde fertigen ließ, um die Grabstätte seiner von ihm sehr betrauerten 1. Frau auszuschmücken. Das komplette "Jüngste Gericht" war in der bilderfeindlichen Reformationszeit übermalt und erst 1885 wieder freigelegt worden.[3]
Nachkommen
- Ruprecht der Engländer (1406-1426)
Literatur
- • Walther Holtzmann: Die englische Heirat Pfalzgraf Ludwigs III., in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins NF 43 (1930), 1-22
- • Andreas Kraus: Handbuch der bayerischen Geschichte, 1995, Band 3, Seite 73; (Textscan des betreffenden Abschnittes)
Einzelnachweise
- ↑ Die "Böhmische bzw. Pfälzer Krone" von Prinzessin Blanka in der Schatzkammer der Münchner Residenz
- ↑ Über die Geschichte der "Böhmischen oder Pfälzer Krone" aus der Mitgift Prinzessin Blancas
- ↑ Foto des "Jüngsten Gerichtes" im Chor der Stiftskirche Neustadt/Weinstraße (Figur Blancas kopfstehend, oben rechts)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Władysław IV. Wasa
Władysław IV. Wasa (polnisch Władysław IV Waza, litauisch Vladislovas II Vaza; * 9. Juni 1595 in Krakau, Polen; † 20. Mai 1648 in Merkinė, Litauen) war ab 1632, als gewählter König von Polen und Großfürst von Litauen, der Regent des Staates Polen-Litauen sowie Titularkönig von Schweden. Er war ab 1610 erwählter Zar von Russland und ab 1613, durch die Thronbesteigung von Michael Romanow zum Zaren von Russland, bis 1634 Titularzar von Russland.
Władysław entstammte im Mannesstamm der Dynastie der Wasa und war auch Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies.
Königliche Titulatur
- Titulatur auf Latein: „Vladislaus Quartus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque haereditarius rex, electus magnus dux Moschoviae.“
- Deutsche Übersetzung: „Władysław IV., durch Gnaden Gottes König von Polen, Großfürst von Litauen, Rus, Preußen, Masowien, Samogitien, Livland, Smolensk, Sewerien, Czernihów, ebenso Erbkönig der Schweden, Goten und Vandalen, erwählter Großfürst von Moskau“
Leben
Władysław war der Sohn von König Sigismund III. Wasa und der Erzherzogin Anna von Österreich-Steiermark. Er war ein Befürworter kriegerischer Auseinandersetzungen, wobei er sich von dem pazifistisch eingestellten Adel entfernte. Er erhob Anspruch auf die schwedische und russische Krone und versuchte diesen mit Waffengewalt durchzusetzen.© wikipedia
Anspruch auf die Zarenkrone
Władysław stieß im Herbst 1617, während des Polnisch–Russischen Krieges 1609–1618, auf die russische Hauptstadt Moskau vor, wobei er von Verbänden der Saporoger Kosaken unterstützt wurde. Da Russland eine erneute Belagerung von Moskau vermeiden wollte, wurde nach harten Verhandlungen 1618 der Vertrag von Deulino geschlossen, der für 14 ½ Jahre Frieden und die de facto Anerkennung der Regentschaft von Michael I. Romanow brachte.
Unmittelbar nach Ablauf dieser Frist, sein Vater starb 1632, wurde Władysław zum König gewählt und kämpfte sich in innerhalb von zwei Jahren, während des Russisch-Polnischen Krieges 1632–1634 um Smolensk, in eine überlegene Position, aus der es ihm 1634 gelang, den Ewigen Frieden von Polanów mit Moskau zu unterzeichnen und Smolensk überlassen zu bekommen. Am Abend vor der Unterzeichnung, wurde von russischen Gesandten ein Geheimartikel unterschrieben, der Moskau angeblich zur Zahlung von 20.000 Rubel an Polen für die Abtretung der Stadt Serpejsk verpflichtete. In Wirklichkeit ging es hierbei aber um den Verzicht des Zarentitels durch Władysław.
Anspruch auf die schwedische Krone
Die Ansprüche Władysławs, der ja Erbkönig (arvkonung) von Schweden war, auf den schwedischen Thron waren oft Gründe für Streitigkeiten und Kriege zwischen Polen und Schweden, was Polen enorme wirtschaftliche Verluste einbrachte, vor allem als die Schweden, während des Schwedisch-Polnischen Krieges 1600–1629, zwischenzeitlich ein paar Küstenstädte übernahmen. Um die Macht am Baltikum zu festigen, baute er eine Flotte. Als Teilnehmer am Osmanisch-Polnischen Krieg 1620–1621 hatte der König auch einen großen Krieg gegen das Osmanische Reich geplant, was allerdings auf entschiedenen Widerstand des Adels traf.
Kosakenaufstand und Tod
Während der Herrschaft von Władysław verschlechterte sich die Lage in der Ukraine. Die Magnaten häuften dort ihr Vermögen und unterdrückten das Kosakenvolk. Ab und zu kam es zu Aufständen der Kosaken, die sehr hart bekämpft wurden. Die wachsende Unzufriedenheit führte im Jahre 1648 zum großen Kosaken- und Bauernaufstand unter der Führung von Bohdan Chmielnicki an der Spitze im Bündnis mit dem Khanat der Krim, der der polnischen Ritterschaft viele Verluste zufügte. Ein paar Tage nach dem Aufstand starb König Władysław .
Ehe und Familie
In der ersten Ehe war er mit seiner Cousine (2. Grades) Erzherzogin Cäcilia Renata, Tochter von Kaiser Ferdinand II verheiratet. Es war eine sehr unglückliche Ehe: Zwei Kinder starben im Kindesalter. Unmittelbar nach der dritten Geburt, einer Totgeburt, starb auch Cäcilia.
Im politischen Leben Königs Władysław spielte seine zweite Frau eine große Rolle, die Königin Marie Luise von Nevers-Gonzaga, die für das gute Verhältnis mit Frankreich sorgte und sich für die Wahl Vivente Rege (die Wahl des Nachfolgers zu Lebzeiten des Herrschers) einsetzte. Sie heiratete nach seinem Tod seinen Bruder Johann II. Kasimir.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Sigismund III. Wasa
Vaza, schwedisch Sigismund Vasa; * 20. Juni 1566 auf Schloss Gripsholm, Mariefred, Schweden ; † 30. April 1632 in Warschau, Polen) war ab 1587 als König von Polen und Großfürst von Litauen, gewähltes Staatsoberhaupt von Polen-Litauen, ab 1592 bis zu seiner Absetzung durch den schwedischen Ständereichstag 1599 Erbkönig von Schweden und ab 1599 bis zu seinem Tode 1632 Titularkönig von Schweden.
Sigismund III. wurde als Sohn von König Johann III. von Schweden und Katharina Jagiellonka, der Schwester des polnischen Königs Sigismund II. August, geboren. Damit gehörte er sowohl zu den Geschlechtern der Wasa als auch der Jagiellonen.
Königliche Titulatur
Titulatur auf Latein: „Sigismundus Tertius Dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Livoniæque, necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque hæreditarius rex.“
Deutsche Übersetzung: „Sigismund, durch Gottes Gnaden König von Polen, Großfürst von Litauen, Rus, Preußen, Masowien, Samogitien, Livland, ebenso Erbkönig der Schweden, Goten und Vandalen.“
König von Polen
Von seiner Mutter katholisch erzogen, wurde er nach dem Tode von Stephan Báthory am 19. August 1587 zum König von Polen gewählt. Bei dieser Wahl spielten die Bemühungen des polnischen Kanzlers Jan Zamoyski und seiner Tante Anna, der Witwe Báthorys, eine wesentliche Rolle. Letztere lieh dem Kanzler 100.000 Gulden, um Truppen zur Verteidigung ihres Neffen auszuheben. Sigismund versprach, eine Flotte auf der Ostsee zu halten, die Ostgrenze gegen die Tataren zu sichern und Schweden nicht ohne Einwilligung des polnischen Parlaments zu besuchen.
Sechzehn Tage später unterzeichnete er die Artikel von Kalmar, die das zukünftige Verhältnis zwischen Polen und Schweden regelten, da er im Laufe der Zeit seinem Vater als König von Schweden nachfolgen würde. Die beiden Königreiche sollten zeitlich unbegrenzt vereinigt werden, aber jedes sollte seine eigenen Gesetze und Bräuche behalten. Das protestantische Schweden sollte Religionsfreiheit genießen und in seiner Abwesenheit von sieben Schweden regiert werden – seinem protestantischen Onkel Karl und sechs weiteren, vom König bestimmten Personen. Schweden sollte somit nicht von Polen aus verwaltet werden.
Eine Woche nach dem Unterschreiben dieser Regelungen reiste der junge Prinz ab, um den polnischen Thron in Besitz zu nehmen. Von seinem Vater wurde ihm ausdrücklich befohlen, nach Schweden zurückzukehren, wenn die polnische Deputation, die ihn in Danzig erwartete, auf die Abtretung Estlands an Polen als Bedingung für seine Machtübernahme bestehen würde. Es stellte sich heraus, dass die Polen noch schwieriger als erwartet zufriedenzustellen waren; schließlich wurde der Kompromiss geschlossen, die territorialen Entscheidungen auf die Zeit nach dem Tod Johanns III. aufzuschieben. Sigismund wurde nun ordnungsgemäß am 27. Dezember 1587 in Krakau gekrönt.
Die Lage in Polen
Sigismunds Stellung als König von Polen war außergewöhnlich schwierig. Als Ausländer konnte er von Anfang an nicht mit der Sympathie seiner Untertanen rechnen. Als gebildetem und vornehmem Mann, der die Musik und Kunst liebte, musste ihm der Landadel unverständlich bleiben, der alle Künstler und Dichter entweder als Mechaniker oder als Abenteurer betrachtete; umgekehrt blieb er ihnen fremd. Seine umsichtige Zurückhaltung und seine unerschütterliche Ruhe wurden als Steifheit und Hochmut gebrandmarkt. Selbst Zamoyski, der ihn auf den Thron gebracht hatte, klagte, dass der König vom Teufel besessen sei.
Sigismunds Schwierigkeiten verschärften sich durch seine politischen Ansichten, die er aus Schweden fertig ausgearbeitet mitgebracht hatte und die denen des allmächtigen Kanzlers diametral entgegenstanden. Obgleich sein außenpolitisches Konzept wohl undurchführbar war, so war es doch im Vergleich zu dem Zamoyskis klar und präzise. Es zielte auf eine enge Allianz mit dem habsburgischen Österreich ab, mit dem doppelten Ziel, Schweden in seinen Machtbereich einzubeziehen und die Hohe Pforte (Regierung des Osmanischen Reiches) durch die Verbindung der zwei großen katholischen Mächte in Mitteleuropa im Zaum zu halten. Eine logische Folge dieses Konzepts war die überfällige Reform der polnischen Verfassung, ohne die nichts Nützliches aus jeglichen politischen Zusammenschlüssen zu erwarten war. Sigismunds Absichten waren also die eines Staatsmanns, der klar die bestehenden Missstände erkennt und sie beheben will. Aber alle seine Bemühungen wurden von der Missgunst und dem Misstrauen der vom Kanzler angeführten Magnaten gehemmt.
Die ersten Jahre von Sigismunds Herrschaft spiegeln einen fast kontinuierlichen Kampf zwischen Zamoyski und dem König wider, in dem die Opponenten wenig mehr erreichten, als sich gegenseitig in Schach zu halten. Beim ersten Sejm (Reichstag) 1590 durchkreuzte Zamoyski alle Bemühungen der österreichischen Parteigänger. Daraufhin zog der König aus plötzlichen Vakanzen in den obersten Beamtenrängen Vorteil, indem er die Radziwiłłs und andere litauische Würdenträger an die Macht brachte; für eine Zeit beschnitt er damit die Autorität des Kanzlers. Im Jahre 1592 heiratete Sigismund Anna von Österreich, und im selben Jahr wurde eine Versöhnung zwischen dem König und dem Kanzler eingefädelt, die ihm erlauben sollte, den nach dem Tod seines Vaters Johann III. frei gewordenen schwedischen Königsthron in Besitz zu nehmen.
Die Lage in Schweden
Am 30. September 1593 kam er in Stockholm an und wurde am 19. Februar 1594 in Uppsala gekrönt; dazu musste er garantieren, dass Schweden weiter seine protestantische Konfession pflegen durfte. Am 14. Juli reiste er nach Polen ab und ließ Herzog Karl und den Senat Schweden während seiner Abwesenheit regieren. Vier Jahre später, im Juli 1598, wurde Sigismund gezwungen, um die Krone in seinem Heimatland zu kämpfen, da sein Onkel dabei war, mit Hilfe des Senats die Macht an sich zu reißen. In Finnland, damals noch Teil des Königreichs Schweden, war Admiral Clas Eriksson Fleming einer von Sigismunds bekanntesten Unterstützern. In Finnland war der Machtkampf zwischen Sigismund und Karl verbunden mit einem Bauernaufstand, dem sogenannten Keulenkrieg. Sigismund landete mit 5000 Mann in Kalmar, hauptsächlich ungarischen Söldnern; die Festung öffnete ihm sofort die Tore, und die Hauptstadt und das Land hießen ihn Willkommen. Die katholische Welt betrachtete seine Fortschritte mit Zuversicht. Sigismunds Erfolg in Schweden wurde als der Anfang noch größerer Triumphe gesehen.
Es sollte aber anders kommen. Nach vergeblichen Verhandlungen mit seinem Onkel rückte Sigismund mit seiner Armee von Kalmar aus vor, wurde aber vom Herzog bei Stångebro am 25. September 1598 geschlagen. Drei Tage später stimmte er dem Frieden von Linköping zu, wonach alle zwischen ihm und seinem Onkel strittigen Punkte einem Reichstag in Stockholm vorgelegt werden sollten; gleich darauf setzte er mit dem Schiff nach Danzig über. Heimlich klagte er, dass die Vereinbarung von Linköping erpresst worden sei und deshalb keine Gültigkeit habe. Sigismund sah Schweden nie wieder, aber er weigerte sich beharrlich, seine Ansprüche aufzugeben oder die neue schwedische Regierung anzuerkennen. Diese Hartnäckigkeit verwickelte Polen in eine ganze Reihe von unvorteilhaften Kriegen mit Schweden. Herzog Karl wurde 1600 als Karl IX. von Schweden zum König ernannt und 1607 gekrönt.
Europäisches Machtgefüge
1602 heiratete Sigismund Constanze von Österreich, die Schwester seiner verstorbenen ersten Ehefrau. Dieses Ereignis stärkte den Einfluss der Habsburger bei Hofe und deprimierte den Kanzler nur noch mehr. Während des Sejms von 1605 bemühte sich der König um eine Reform der polnischen Verfassung, nach der im Landtag statt der notwendigen Einstimmigkeit nur noch ein Mehrheitsvotum zur Annahme eines Entscheids ausreichen sollte. Diese höchst einfache und nützliche Reform wurde jedoch durch den Widerstand Zamoyskis verhindert. Sein Tod im selben Jahr verschlimmerte alles weiter, da die Opposition nunmehr in den Händen von unfähigen oder sogar verbrecherischen Männern lag. Von 1606 bis 1610 herrschte in Polen praktisch Anarchie. Aufstände und Revolten flackerten überall auf, und alles, was Sigismund tun konnte, war, den Schaden durch seine Vermittlung und seinen Mut zu begrenzen.
Für die Außenpolitik hatte dieses Durcheinander verheerende Konsequenzen. Der sich anbahnende Kollaps des Zarentums Russland hätte Polen die einzigartige Gelegenheit gegeben, die russischen Zaren für immer auszuschalten. Aber der erforderliche Nachschub blieb aus, denn der Landtag blieb angesichts der Triumphe Żółkiewskis und anderer Generäle, die mit winzigen Armeen große Aufgaben bewältigten, unschlüssig und blockiert. Bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges schloss sich Sigismund klugerweise dem Kaiser an, um den vereinigten Anstrengungen der Protestanten und Türken die Waage zu halten. Diese Taktik war für die katholische Sache vorteilhaft, da es die Türken von Zentral- und Nordosteuropa fernhielt; trotzdem hätte die Entscheidung für Polen den Ruin bedeutet, wäre nicht der Opfermut von Stanisław Żółkiewski bei Cecora 1620 und von Jan Karol Chodkiewicz bei Chotyn 1621 während des Osmanisch-Polnischen Krieges 1620–1621 gewesen.
In seinem 66. Lebensjahr verstarb Sigismund plötzlich und unerwartet. Seine Söhne Władysław und Johann Kasimir folgten ihm auf dem Thron.
Kunstmaler und Goldschmied
König Sigismund war ein begabter Kunstmaler und Goldschmied. Nur drei von seinen Gemälden sind bis heute erhalten – eines von ihnen war so „gut“, dass es jahrhundertelang Tintoretto zugeschrieben worden war. Aus Sigismunds Goldschmiedwerkstatt stammt der größte Teil des berühmten silbernen Sarges des Heiligen Adalbert im Gnesener Dom.
Ehen und Nachkommen
Sigismund war zweimal verheiratet. Seine erste Ehefrau Erzherzogin Anna von Österreich (1573–1598) heiratete er am 31. Mai 1592; sie gebar ihm fünf Kinder:
- Anna Maria (* 23. Mai 1593; † 9. Februar 1600), Prinzessin von Polen, Litauen und Schweden;
- Katharina (* 19. April 1594; † 15. Mai 1594), Prinzessin von Polen, Litauen und Schweden;
- Władysław IV. Wasa (* 9. Juni 1595; † 20. Mai 1648), König von Polen, Großfürst von Litauen, Titularkönig von Schweden, Zar und Titularzar von Russland;
- Katharina (* 27. September 1596; † 11. Juni 1597), Prinzessin von Polen, Litauen und Schweden;
- Kristofer (*/† 10. Februar 1598), Prinz von Polen, Litauen und Schweden;
Seine zweite Ehefrau Erzherzogin Constanze von Österreich (1588–1631) heiratete er am 11. Dezember 1605; sie gebar ihm sieben Kinder:
- Johann Kasimir (* 25. Dezember 1607; † 9. Januar 1608), Prinz von Polen und Litauen;
- Johann II. Kasimir (* 21. März 1609; † 16. Dezember 1672), König von Polen, Großfürst von Litauen, Titularkönig von Schweden;
- Johann Albert (* 25. Mai 1612; † 22. Dezember 1634), Prinz von Polen und Litauen, Bischof von Krakau und Ermland, Kardinal;
- Karl Ferdinand (* 13. Oktober 1613; † 9. Mai 1655), Prinz von Polen und Litauen, Bischof von Breslau;
- Alexander Karl (* 14. November 1614; † 19. November 1634), Prinz von Polen und Litauen;
- Anna Konstantinia (* 20. Januar 1616; † 24. Mai 1616), Prinzessin, Prinz von Polen und Litauen;
- Anna Katharina (* 7. August 1619; † 9. Oktober 1651), Prinzessin von Polen und Litauen, durch Heirat mit Philipp Wilhelm, Prinzessin von Pfalz-Neuburg;
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Stephan Báthory
Stephan Báthory (ungarisch István Báthory, polnisch Stefan Batory, litauisch Steponas Batoras; * 27. September 1533 in Szilágysomlyó, Ungarn, heute Rumänien; † 12. Dezember 1586 in Grodno, Litauen, heute Weißrussland) war 1571–1576 gewählter Fürst von Siebenbürgen und ab 1576, als König von Polen und Großfürst von Litauen, gleich seiner Gemahlin Anna Jagiellonica, gewähltes Staatsoberhaupt von Polen-Litauen.
Stephan Báthory gilt als das berühmteste Mitglied der Somly-Linie der Báthory-Familie, zu denen auch seine Nichte Elisabeth Báthory, sowie der Reichsfürst Sigismund Báthory gehörten.
Titulatur
Lateinische Titulatur: „Stephanus, Dei gratia rex Poloniae et magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podlachiae, Livoniaeque, necnon princeps Transylvaniae.“
Deutsche Übersetzung: „Stephan, durch Gottes Gnaden König von Polen und Großfürst von Litauen, Rus, Preußen, Masowien, Samogitien, Kiew, Wolhynien, Podlachien, Livland, ebenso Fürst von Siebenbürgen.“
Leben und politischer Werdegang
Wahl zum Fürsten von Siebenbürgen
Er wurde als Sohn des gleichnamigen transsilvanischen Adligen István Báthory geboren. Er trat in die Dienste von Johann Sigismund Zápolya, der König von Ungarn und ab 1570 Fürst von Siebenbürgen war. Als dieser ohne natürlichen Nachfolger starb, wurde Báthory am 25. Mai 1571 mit politischer Unterstützung durch Sultan Selim II. von den ungarischen Ständen in Alba Iulia zum Fürsten von Siebenbürgen gewählt, gegen den Widerstand von Kaiser Maximilian II. und gegen den Willen seines Vorgängers, der Gáspár Békés zu seinem Nachfolger bestimmt hatte. Als dieser auf seinem Thronanspruch bestand, folgte ein Bürgerkrieg, in dem Báthory seinen Rivalen mit Hilfe seines Bruders Christof Báthory schließlich aus Siebenbürgen verjagte.
Wahl zum König und Großfürsten von Polen-Litauen
Im Juni 1574 wurde der polnische Thron wieder frei, da Heinrich von Valois es vorzog, als König nach Frankreich zurückzukehren. Daraufhin brach eine Nachfolgedebatte unter den polnischen Adligen aus, da sich, wie ein Jahr zuvor, der Habsburger Maximilian II. als Kandidat des Senats ins Spiel brachte. Insbesondere dank der Unterstützung des Kanzlers Jan Zamoyski wurde aber Báthory 1576 zum König gewählt. Als Bedingung für seine Machtübernahme wurde ihm auferlegt, Anna Jagiellonica, die Schwester des letzten Jagiellonen, König Sigismund II. August, zu heiraten. Es war eine politische Heirat, denn Anna war damals bereits 53 Jahre alt.
Als er von dieser gänzlich unerwarteten Beförderung erfuhr, rief Báthory die siebenbürgischen Stände in Medgyes zusammen und überzeugte sie davon, seinen Bruder Christoph zu seinem Nachfolger als Fürsten zu wählen. Dann eilte er nach Krakau, heiratete Anna, und wurde am 1. Mai mit beispielloser Pracht gekrönt. Anfänglich war seine Stellung extrem schwierig. Dies änderte sich jedoch mit dem plötzlichen Tod von Kaiser Maximilian II., gerade in dem Moment, als er zusammen mit Zar Iwan IV. in Polen einzumarschieren plante. Obwohl Stephan auch weiterhin tiefes Misstrauen gegen die Habsburger hegte, willigte er zuletzt in ein Verteidigungsbündnis mit dem Kaiserreich ein, das vom päpstlichen Nuntius bei seiner Rückkehr nach Rom 1578 eingefädelt wurde.
Die Herrschaft in Polen-Litauen
Die wichtigsten Ereignisse von Stephan Báthorys Herrschaft können hier nur kurz angeschnitten werden. Die bedeutende Hansestadt Danzig fürchtete um ihre Privilegien und verweigerte dem neuen König die Huldigung, solange dieser nicht ihren Autonomiestatus bestätigen würde. Danzig hatte wie andere Hansestädte, ein eigenes Heer zur Verteidigung. Danzig stand auf der Seite Kaiser Maximilians II., der ihr weitgehende Privilegien zugestand, sollte sie sich bei der Königswahl auf seine Seite schlagen. Unterstützt durch ihren immensen Reichtum, beinahe uneinnehmbare Befestigungen und Unterstützung durch Dänemark, hatte sie ihre Tore vor dem Versuch der Eroberung durch den neuen Monarchen Polens verschlossen. Zwei polnische Versuche, die Stadt einzunehmen, scheiterten.
Nach für Danzig erfolgreich verlaufenden Kämpfen an der Weichselmündung bei Weichselmünde wurde am 12. September 1577 auch die zweite Belagerung erfolglos abgebrochen. König Stephan Bathory war gezwungen, die Privilegien der Hansestadt Danzig vom 16. Juni 1454, 9. Juli 1455 und 25. Mai 1457 (eigene Außenpolitik, Recht auf unabhängige Kriegsführung, eigene Verwaltung, deutsche Amtssprache und Recht; nach 1525/1557 auch lutherisches Bekenntnis) gegen eine symbolische Geldzahlung zu bestätigen. Stephan hatte anderseits durch den Erhalt einer beträchtlichen Geldzahlung als „Entschuldigung“ sein Gesicht gewahrt und war nun in der Lage, sich auswärtigen Angelegenheiten zu widmen.
Im Krieg gegen das Zarentum Russland und der Waffenstillstand von Jam Zapolski
Die Schwierigkeiten mit dem osmanischen Sultan Murad III. wurden vorübergehend durch einen Waffenstillstand beigelegt, der am 5. November 1577 unterzeichnet wurde; der polnische Reichstag in Warschau wurde überzeugt, Stephan finanzielle Unterstützung für den unvermeidlichen Krieg gegen das Zarentum Russland zu gewähren. Drei Feldzüge (1579–1582) folgten, mit ermüdenden Märschen und erschöpfenden Belagerungen. Obwohl Bathory wiederholt von der Knauserigkeit des Reichstages behindert wurde, war er erfolgreich, und seine geschickte Diplomatie konnte zur gleichen Zeit das Misstrauen der Hohen Pforte und des römisch-deutschen Kaisers beschwichtigen.
Im Jahr 1581 drang Stephan erneut bis ins Herz des „Moskowiter Reiches“ ein, und am 22. August stand er vor der alten Stadt Pskow, deren Größe und imposante Befestigungen die polnische Armee mit Ehrfurcht erfüllte. Auch der päpstliche Gesandte Possevino protestierte; ihn hatte die Kurie ausdrücklich von Rom geschickt, um zwischen dem orthodoxen Zaren und dem katholischen König von Polen zu vermitteln, da man das Trugbild einer Vereinigung der beiden Kirchen vor Augen hatte. Trotzdem ging Stephan zur Belagerung von Pskow über. Nach erfolgloser halbjähriger Belagerung unterschrieben er und Iwan IV., genannt „der Schreckliche“, am 15. Januar 1582 den Vertrag von Jam Zapolski, in dem ein Waffenstillstand von 10 Jahren vereinbart wurde. Durch diesen Vertrag trat der Zar die Stadt Polozk und Teile Livlands, die er seit dem Livländischen Krieg besetzt hielt, an die polnisch-litauische Krone ab.
Jesuitenzeit
Innenpolitisch war der Hauptgesichtspunkt von Stephans Regierungszeit die Etablierung der Jesuiten in Polen. Sie allein vermochten seine Pläne zu verstehen und zu unterstützen, mit denen er Polen, Litauen, Russland und Siebenbürgen (als Ausgangspunkt für die Wiedervereinigung des seit 1541 dreigeteilten Ungarn) in einen großen Staat vereinigen wollte, mit dem Ziel, die Osmanen schließlich aus Europa zu vertreiben. Dieses Vorhaben zerstreute sich mit seinem plötzlichen Tod durch einen Schlaganfall 1586.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Przemysław II.
Przemysław II. (polnisch Przemysł(aw), lateinisch Primislaus; * 14. Oktober 1257 in Posen, † 8. Februar 1296 in Rogoźno, Polen) war ab 1273 Herzog von Großpolen in Posen. Nach dem Tod seines Onkels Boleslaw, Herzog von Großpolen in Kalisch, ab 1279 Herzog von Großpolen, 1290-1291 Herzog von Kleinpolen in Krakau, durch letzteres Seniorherzog (Princeps) von Polen, ab 1294 Herzog von Pommerellen und ab 1295, als Przemysław, König von Polen. Er entstammte der großpolnischen Linie der Piasten.
Leben
Przemysław war einziger Sohn von Herzog Przemysław I. und der Elisabeth, Tochter Herzogs Heinrich II. von Schlesien-Breslau. Erzogen unter der Vormundschaft seines Onkels Boleslaw des Frommen erzwang er Mitte 1273 die Herausgabe des väterlichen Erbes, die Stadt Posen. Er griff in die schlesischen Bürgerkriege ein, indem er 1276 ein Bündnis mit Herzog Heinrich IV. von Schlesien-Breslau schloss, den er 1277 im Konflikt mit Boleslaw II. von Schlesien-Liegnitz erfolglos unterstützte und zudem mit diesem ab 1281 in Grenzstreitigkeiten lag.
Nach dem Tod seines Onkels Boleslaw, 1279, regierte er selbständig in ganz Großpolen. Am 15. Februar 1282 schloss er einen Vertrag mit Herzog Mestwin II. von Pommerellen in Kępno, in dem dieser die Lehnshoheit des piastischen Herzogs anerkannte und ihm sein Herzogtum übertrug - donatio inter vivos -. Er stärkte seine Macht im Innern, indem er 1285 einen Adelsaufstand unter Führung des Geschlechts Zaremba niederwarf. Der machtvollen Position der Markgrafschaft Brandenburg in der Neumark setzte er 1287 ein Bündnis mit Herzog Bogislaw IV. von Pommern-Wolgast entgegen (1291 erneuert). Ein Jahr darauf, 1288, kam es zu einer Einigung mit seinen schlesischen Vettern, den Herzögen Heinrich IV. und Heinrich I. von Schlesien-Glogau, auf gegenseitige Erbfolge.
Nach dem Tod Herzog Heinrichs IV. 1290 nahm er das westliche Kleinpolen mit Krakau (Herzogtum Kleinpolen-Krakau) in Besitz, auf das Herzog Władysław I. Ellenlang von Kujawien ebenfalls Anspruch erhob und das östliche Kleinpolen mit Sandomierz (Herzogtum Kleinpolen-Sandomierz) besetzte. Im Januar 1291 verzichtete er zugunsten des böhmischen Königs Wenzel II. auf Krakau, behielt jedoch die Krönungsinsignien und schloss 1293 ein gegen Böhmen gerichtetes Bündnis mit Władysław von Kujawien, auf dessen Grundlage der kujawische Herzog nach dem Ableben des Bündnispartners, 1296, die meisten seiner Gebiete übernahm (obwohl ein älterer Erbvertrag mit Heinrich IV. von Breslau († 1290) und Heinrich I. von Glogau († 1309) bestand). Nach dem Tod Mestwins II., 1294, nahm er im Rahmen des Erbvertrags Pommerellen in Besitz. Unter dem Einfluss des Erzbischofs von Gnesen, Jakub Świnka, verfolgte Przemysław die Idee der Vereinigung der seit 1138 im Partikularismus zersplitterten polnischen Länder und der Wiedererlangung der Königswürde. Am 26. Juni 1295 wurde er mit Erlaubnis von Papst Bonifatius VIII. in Gnesen zum polnischen König gekrönt, wodurch die Zeit der schwachen Seniorherzogswürde beendet wurde.
Die Erneuerung der königlichen Würde in Polen nach über 200 Jahren hatte große Bedeutung für die Einigung des Königreichs Polen, das 500 Jahre Bestand haben sollte, obwohl er selber schon im Jahr nach seiner Krönung ums Leben kam. Er starb 1296 als Opfer eines Entführungsversuches, den die Markgrafen von Brandenburg (Otto V. der Lange und Johann IV.) im Bund mit der lokalen Opposition (Angehörige zweier Adelsgeschlechter, der Zaremba und Nałęcz) angestiftet hatten, die Pommerellen und Gebiete zur Neumark an der Netze für sich beanspruchten. Es ist durchaus möglich, dass König Wenzel von Böhmen im Hintergrund stand, der damals große Teile Südpolens (Schlesien, Kleinpolen) zu seinem Einflussbereich zählte und ursprünglich eine Entführung geplant war, um den Gefangenen zu Konzessionen zu bewegen. Przemysław stand in einem einvernehmlichen Verhältnis zur Kirche, unterhielt enge Kontakte zu Stadtbürgern und förderte besonders Posen, wo er neben seinen Vorfahren in der Kathedrale begraben liegt. Mit ihm erlosch die großpolnische Linie der Piasten, die durch Mieszko III. den Alten begründet worden war.
Ehefrauen
- Przemysł war dreimal verheiratet, in erster Ehe ab Juli 1273 mit:
- • Ludgarda (* um 1260; † Dezember 1283) Tochter des Herzogs Heinrich von Mecklenburg;
- in zweiter Ehe ab 11. Oktober 1285 mit:
- • Rixa/Rycheza (* um 1265; † vor 1291 ) Tochter des Königs Waldemar von Schweden;
- in dritter Ehe ab 1291 mit:
- • Margarete (* um 1270; † 1315), Tochter des Markgrafen Albrecht III. von Brandenburg;
Nachkommen
Przemysł hatte nur eine Tochter aus der Ehe mit Prinzessin Rixa von Schweden:
- • Elisabeth Rixa;
- Sie war mehrmals verheiratet, in erster Ehe ab 1303 mit:
- • König Wenzel von Böhmen und Polen;
- in zweiter Ehe ab 1306 mit:
- • Herzog Rudolf von Österreich;
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Kasimir III. (Polen)
Kasimir der Große (polnisch Kazimierz III Wielki, lateinisch Kazimirus; * 30. April 1310 in Kowal; † 5. November 1370 in Krakau, Polen) war Sohn von König Władysław I. Ellenlang aus seiner Verbindung mit Jadwiga von Kalisch, Tochter von Herzog Boleslaw dem Frommen von Großpolen. Er entstammte der Dynastie der kujawischen Piasten und war ab 1333, als Kasimir I., König von Polen (als Herzog von Polen – dux Regni Poloniae – der III.). Mit ihm starben die Piasten in königlicher Linie aus.
Leben
Vom politischen Erbe seines Vaters übernahm Kasimir das Bündnis mit Ungarn, verstärkt durch die Heirat seiner Schwester Elisabeth mit Karl Robert von Anjou, König von Ungarn, die Konflikte mit dem Deutschen Orden um Pommerellen, mit den Luxemburgern Johann und Karl IV. um die Oberherrschaft in Schlesien, sowie mit Johann, der als König von Böhmen auch auf die polnische Königskrone Anspruch erhob. Während sein Vater militärische Entscheidungen gesucht hatte, strebte Kasimir eher nach friedlichen und diplomatischen Lösungen.
1335 verzichtete König Johann für 20.000 Schock (1,2 Millionen) Prager Groschen auf die polnische Krone, gleichzeitig ließ Kasimir, um die Allianz zwischen den Luxemburgern und dem Deutschen Orden zu entkräften, im Vertrag von Trentschin „für alle Zeiten“ seine dynastischen Ansprüche auf Schlesien fallen. Nach ergebnislosen Verhandlungen mit dem Deutschen Orden um Pommerellen und das Kulmer Land strengte er einen Prozess vor der päpstlichen Kurie an. Da das für Polen günstige Urteil von 1339 vom Papst nicht bestätigt wurde, verzichtete Kasimir im Frieden von Kalisch 1343 gegen Herausgabe des 1332 vom Orden besetzten Herzogtums Kujawien und Dobrins auf die Rückgabe von Pommerellen und des Kulmer Landes, ohne jedoch die Rechtstitel preiszugeben.
Ab 1341 besetzte er einige schlesische Städte an der Grenze (1341–1356 Namysłów, Byczyna, Kluczbork und Wschowa). 1345 kam es zu erneuten Auseinandersetzungen mit den Luxemburgern um Schlesien, an deren Ende Kasimir 1348 im Vertrag von Namslau endgültig auf seine Rechte auf Schlesien verzichten musste. Seit 1343 suchte er seinen Einfluss in Pommern zu festigen (Bündnis mit den Greifen der Stettiner, wie Wolgaster Linie), was 1365 zur Besetzung einiger Netze- und Neumarkdistrikte mit Santok, Drezdenko und Gorzów Wielkopolski (bis 1372), sowie der Region um Wałcz und Czaplinek 1368 führte.
Kasimirs Hauptinteresse lag jedoch im ruthenischen Fürstentum Halytsch-Wolhynien in Rotrussland, das er mit Unterstützung Ungarns nach dem Tod des Piasten Boleslaw-Trojdenowicz (als russischer Fürst Georg II. bzw. Jurii II. genannt) ab 1340, teils direkt, teils als Lehen bis 1366 seinem Reich fast vollständig einverleibte: darunter waren die Städte Halitsch, Lemberg, Chelm, Belz, Wolodymyr-Wolynskyj, sowie die Regionen Podolien und das Sanoker Land. 1351 unterwarf er die seit etlichen Jahren säkular verselbständigten masowischen Herzogtümer teils als Lehen (Herzogtum Warschau-Rawa-Czersk), teils direkt (Herzogtum Plock) seiner Suzeränität. Diese Expansionspolitik verhalf Polen zu einer machtvollen Stellung in Mitteleuropa.
Gleichermaßen erfolgreich verliefen die Reformen im Innern, die in wirtschaftlicher Hinsicht die Besiedlung von Wüstungen, die Übertragung von Magdeburger und Kulmer Recht auf Städte und Dörfer, eine königliche Zoll- und Steuerpolitik, die Erschließung und Sicherung von Handelswegen, den Erlass von Judenprivilegien 1334, die er in den Jahren 1336 und 1367 wiederholte und die Eröffnung von Salinen betrafen verfassungsrechtlich die Kodifikation des Landrechtes (sog. Statuten Kasimirs des Großen), die Einführung der Generalstarosteien mit administrativen und gerichtlichen Befugnissen, Staatsrat und Kanzleiführung bewirkten. Kasimir sicherte die Grenzen seines Reiches mit 50 befestigten Burgen, gründete die Universität Krakau 1364, schuf eigene Appellationsgerichtshöfe für das Magdeburger Recht und verbot die Appellation nach Magdeburg. Bereits 1339 schloss er mit seinem Schwager, dem ungarischen König Karl von Anjou, einen Nachfolgevertrag, den er 1355 zugunsten seines Neffen Ludwig des Großen erneuerte und der nach seinem Tod realisiert wurde. Er ist der einzige der polnischen Könige, welcher als „der Große“ bezeichnet wird.
Ehen und Nachkommen
Kasimir war in erster Ehe (1325–1339) mit Anna von Litauen verheiratet, Tochter des Großfürsten Gediminas von Litauen; in zweiter Ehe ab 1341 bis zur Ungültigkeitserklärung 1368 mit Adelheid, Tochter von Landgraf Heinrich II. von Hessen; in dritter Ehe mit Hedwig von Sagan, Tochter von Herzog Heinrich V. von Sagan. Alle Ehen blieben ohne männliche Nachkommen; aus illegitimen Verhältnissen mit Christina de Rokyczano aus Prag und Esther, stammen mehrere Söhne.
Aus 1. Ehe mit Anna von Litauen:
- Elisabeth (ca. 1326/1361), polnische Prinzessin, verheiratet 1343 mit Herzog Bogislaw V. von Pommern-Wolgast-Stolp
- Kunigunde (ca. 1328/1357), polnische Prinzessin, verheiratet 1352 mit Herzog Ludwig VI. von Oberbayern, einem Sohn von Kaiser Ludwig IV.
Aus 2. Ehe mit Adelheid von Hessen gingen keine Kinder hervor.
Aus 3. Ehe mit Hedwig von Sagan:
- Anna von Polen (Teck) (1366–1425), polnische Prinzessin, verheiratet mit Graf Wilhelm von Cilli (slowen. Celje), deren einzige Tochter war Anna von Cilli, die spätere Gemahlin des polnischen Königs Władysław II. Jagiełło
- Kunigunde (1367–1370), polnische Prinzessin
- Hedwig (1368–1407), polnische Prinzessin
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Sigismund II. August
Sigismund II. August (polnisch Zygmunt II. August, litauisch Žygimantas Augustas; * 1. August 1520 in Krakau, Polen; † 7. Juli 1572 in Knyszyn, Polen), war ab 1529 Großfürst von Litauen, ab 1530 König von Polen und ab 1548, nach dem Tod seines Vaters, Alleinherrscher. Er war ab 1569 der erste Regent des Staates Polen-Litauen.
Das Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies blieb kinderlos, wodurch die Dynastie der Jagiellonen erlosch. Danach wurde die Wahlmonarchie eingeführt und ein französischer Prinz als Heinrich I. zum König und Großfürst von Polen-Litauen gekürt.
Familie und Ehen
Sigismund war der einzige Sohn von König Sigismund I. und dessen zweiter Ehefrau, Bona Sforza. Er war seit 1529 Großfürst von Litauen, übernahm aber erst ab 1544 selbständig Verantwortung von Staatsgeschäften. 1530 wurde er, vom polnischen Adel nur widerstrebend akzeptiert, zu Lebzeiten seines Vaters per Vivente Rege zum König von Polen gekrönt, trat die Königswürde aber erst nach dessen Tod 1548 an.
Sigismund II. blieb in seinen drei Ehen mit Elisabeth (1543–1545), Barbara Radziwiłł (1547–1551) und Katharina (1553–1571) kinderlos. Mit seinem Tod erlosch das Königsgeschlecht der Jagiellonen im Mannesstamm, daher wurde die Nachfolge in der Lubliner Union 1569 geregelt.
Herrschaft
Noch zu Lebzeiten seines Vaters war Sigismund II. August 1529 vom polnischen Adel unter der Bedingung gewählt worden, dass er alles daran setzen würde, Litauen und Preußen der polnischen Krone völlig einzuverleiben. Dadurch entstanden in der Folge Konflikte mit Russland und den nordischen Ländern, sowie bedrohliche internationale Verwicklungen. Wie auch sein Vater setzte er während seiner Regierungszeit auf Zusammenarbeit mit dem Senat und Magnatentum, geriet aber in Konflikte mit dem niederen Adel.
1561 erwarb er das Gebiet der Livländischen Konföderation und schuf das Herzogtum Kurland und Semgallen unter polnischer Lehnshoheit. Er garantierte dem deutsch-baltischen Adel innere Autonomie (deutsches Recht, sozialer Stand) und die protestantische Konfession. Während des Livländischen Krieges verlor er 1563 große Teile Livlands und Polazk an Zar Iwan IV. von Russland.
Zu Beginn seiner Regentschaft war ihm bis etwa 1550 der Schlesier Bernhard von Prittwitz, ein großer militärischer Helfer im Kampf gegen die Krimtataren. Erst ab 1550 änderte sich die politische Lage.
Lubliner Union
Am 1. Juli 1569 beschloss das von Sigismund II. einberufene Parlament, der Sejm, die Lubliner Union:
- • die Umwandlung der bis dahin in Personalunion miteinander verbundenen Staaten Königreich Polen, Großfürstentum Litauen, sowie Königliches Preußen in einen einheitlichen Staat durch eine Realunion, die so genannte Rzeczpospolita;
- • einheitliche Gesetzgebung, Amtssprache (Polnisch und Latein) und Währung;
- • ein Parlament und ein Monarch;
- • Einführung der Wahlmonarchie;
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wenzel II. (Böhmen)
Wenzel II. (tschechisch Václav, polnisch Wacław) (* 27. September 1271; † 21. Juni 1305 in Prag) war ein König von Böhmen und ab 1300 als Wenzel I. König von Polen. Er war der vorletzte Herrscher aus der Dynastie der Přemysliden.
Als Kind lebte er von 1279 bis 1283 in Gefangenschaft seines Vormunds Otto V. in Brandenburg. Nach seiner Rückkehr stand der jugendliche König in Prag bis 1288 unter dem Einfluss des Wittigonen Zawisch von Falkenstein. Als regierender König erwarb er zur böhmischen 1300 die polnische und von 1301 bis 1303 für seinen Sohn Wenzel III. die ungarische Krone.
Im Gegensatz zu seinem Vater Přemysl Ottokar II. galt Wenzel II. der Nachwelt als schwacher Herrscher. Er war kein Eroberer, sondern vor allem Diplomat. Als Herrscher über die böhmischen Silberminen verfügte er über genügend Mittel, um sich in der europäischen Politik zu behaupten und Böhmen eine langjährige Friedenszeit zu sichern.
Geburt
Wenzel wurde 1271 als lang erwarteter Thronfolger König Přemysl Ottokars II. auf der Prager Burg geboren. Sein Vater war seit 1253 König von Böhmen und hatte zudem ab 1251 die Macht in den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain erworben. Dessen erste Ehe mit Margarethe von Babenberg blieb kinderlos. Von den Kindern, die dessen zweite Frau Kunigunde von Halitsch zur Welt brachte, lebten 1271 nur noch zwei Mädchen: Kunigunde und Agnes. Wenzel war bei seiner Geburt der einzige legitime Sohn und Erbe eines Territoriums, das vom Riesengebirge bis zur Adria reichte.
Das Reich Přemysl Ottokars II. zerbrach jedoch am Konflikt mit dem römisch-deutschen König Rudolf I. von Habsburg. Bereits dessen Wahl 1273 hatte der böhmische König abgelehnt, und er widersetzte sich auch der Forderung, sich seine Länder als Reichslehen bestätigen zu lassen. 1275 verhängte Rudolf über ihn die Reichsacht. Die Feindschaft eskalierte 1276 in einen bewaffneten Zusammenstoß, in dem Přemysl unterlag. Er verlor bis auf seine Erbländer alle Territorien und musste Rudolf zwei Kinder versprechen: Kunigunde wurde zur Ehefrau für Rudolfs Sohn Hartmann bestimmt, Wenzel sollte eine Tochter des Habsburgers heiraten. Die Beziehung beider Herrscher verschlechterte sich dennoch weiter und endete 1278 mit der Schlacht auf dem Marchfeld, in der Přemysl Ottokar II. fiel. Der siebenjährige Wenzel war zum König von Böhmen geworden.
Geiselhaft
Zum Vormund hatte Přemysl Ottokar II. vor der Schlacht seinen Neffen Markgraf Otto V. von Brandenburg vorgesehen, der im Spätsommer 1278 dem Ruf der Königinwitwe folgte und mit einem mehrere hundert Mann starken Heer in Böhmen einrückte. Die Regentschaft Ottos entwickelte rasch zur Schreckensherrschaft. Die Brandenburger Truppen plünderten das Land. Der Markgraf hatte nach kurzer Zeit den Adel, die Kirche und die Königinwitwe gegen sich. Kunigunde bat zwar bereits im Oktober 1278 Rudolf von Habsburg um Vermittlung, doch die Verhandlungskommission bestätigte Otto als Vormund und Herrscher über Böhmen. Mähren behielt Rudolf für die Dauer von fünf Jahren in seiner Gewalt. Um seine Macht abzusichern, ließ Otto von Brandenburg sein Mündel im Januar 1279 aus Kunigundes Residenz in der Stadt in die Prager Burg bringen. Doch reichte dies nicht: am 4. Februar wurde Wenzel mit seiner Mutter auf die Burg Bezděz überführt. Von diesem Zeitpunkt an war der junge König Geisel des Regenten.
Die Königin wurde offenbar nicht gefangen gehalten. Sie verließ die Burg nach etwa zwei bis drei Monaten in Richtung Troppau, wo ihre Witwengüter lagen. Wenzel blieb in Ottos Gewalt. Im Spätsommer 1279 brachte der Markgraf den König außer Landes: die Reise führte über Zittau und Berlin in die Askanierburg Spandau, wo der Gefangene Ende Dezember eintraf und bis 1282 blieb. Das Bild der Brandenburger Gefangenschaft Wenzels war lange von der zeitgenössischen Schilderung der Königssaaler Chronik geprägt, nach der er hungrig und zerlumpt in Elend gehalten worden sei – ein hagiographisches Element, das so nicht aufrechterhalten werden kann. Tatsächlich blieben Wenzel II. und Otto V. auch später in engem Kontakt, und es scheint, als habe der König gerade in jener Zeit die Grundlagen seiner Bildung erworben. Er sprach später fließend Deutsch und Latein, besaß Kenntnisse der Theologie, des Rechts und der Medizin und verfasste Verse. Lesen und Schreiben lernte er jedoch nicht.
Ins Elend stürzte während der Brandenburger Herrschaft dagegen das Land. In den Jahren 1281–1282 ereignete sich in Böhmen, verursacht durch andauernde Kämpfe und zwei Mißernten, eine der schlimmsten Hungersnöte des Mittelalters. Das Land wurde von Söldnern und Räuberbanden heimgesucht und drohte im Chaos zu versinken. Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und einiger Städte nahmen Verhandlungen mit Otto auf, um den König wieder ins Land zu holen und die bedrohliche Situation abzuwenden. Diese Verhandlungen weisen auf eine grundlegende Veränderung der staatlichen Ordnung hin. Der Adel trat – in Abwesenheit einer zentralen Macht – erstmals geschlossen als Repräsentant des Landes auf und übernahm Verantwortung für dessen Schicksal. Die ersten Einigungsversuche im Frühjahr 1282 scheiterten an der Höhe des Lösegeldes. Otto brachte seine Geisel nach Prag, verlangte aber statt der ursprünglichen 15.000 zusätzliche 20.000 Pfund Silber. Wenzel wurde erneut fortgeführt und verbrachte ein weiteres Jahr in Dresden am Hof des Markgrafen von Meißen. Erst als die Verhandlungsführer dem Markgrafen einen Teil Nordböhmens als Pfand versprachen, ließ Otto den Gefangenen frei. Am 24. Mai 1283 kehrte Wenzel nach Prag zurück.
Zawisch von Falkenstein
Prag feierte die Rückkehr des Königs im Mai 1283 begeistert, selbständig regieren konnte der knapp Zwölfjährige noch nicht. Die adlige Gruppe, die sich für seine Freilassung eingesetzt hatte, teilte die höchsten Hofämter untereinander auf. Hofmeister und damit Erzieher und Vertreter des Königs wurde ihr Anführer Purkart von Janowitz. Die Konstellation hatte nur wenige Monate Bestand. Noch im Verlauf des Jahres 1283 rief Wenzel seine Mutter Kunigunde nach Prag zurück, und mit ihr kam Zawisch von Falkenstein an den Hof. Die Karriere des Burggrafen aus dem einflussreichen südböhmischen Geschlecht der Wittigonen hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits einige außergewöhnliche Wendungen durchlaufen: 1276 hatte er eine Rebellion gegen Přemysl Ottokar II. angeführt. 1280 trat er in Oppeln in den Dienst der Königinwitwe und beteiligte sich am Widerstand gegen die brandenburgische Regentschaft. Nach Prag kam er 1283 als Kunigundes Ehemann und Vater ihres jüngsten Sohnes Jan. Die ungleiche Ehe, noch dazu heimlich, ohne Wissen der Familien eingegangen, war ein Skandal, doch da vollzogen, war sie nach damaligem Recht gültig. Der junge König akzeptierte die Verbindung, und Kunigunde überließ Zawisch Wenzels Erziehung. Der Wittigone war damit faktisch zum Herrscher des Landes aufgestiegen. Er übernahm selbst kein Amt, doch noch im Winter 1283/1284 besetzte er alle wichtigen Hofposten mit seinen Verwandten und Parteigängern. Die entmachtete Adelsgruppe ging zum bewaffneten Widerstand über, musste aber im Mai 1284 einen vierjährigen Waffenstillstand akzeptieren. Die offizielle Eheschließung holten Zawisch und Kunigunde zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen 1283 und 1285 nach.
Auch wenn die Macht Zawischs in Böhmen unangreifbar schien, für den Hof des römisch-deutschen Königs blieb der Aufsteiger inakzeptabel. Dies zeigte sich deutlich in Verlauf von Wenzels eigener Eheschließung mit Guta von Habsburg. Die beiden wurden bereits 1278/1279 verlobt, möglicherweise auch schon verheiratet. Vollzogen werden konnte die Ehe aber erst im Januar 1285 bei einem Treffen der Familien in Eger, als Braut und Bräutigam 13 Jahre und damit so gut wie volljährig waren. Wenzel leistete bei der Gelegenheit dem Schwiegervater auch den Lehnseid für seine Erbländer. Zawisch war bei der Zeremonie nicht anwesend, und als Rudolf I. Eger verließ, nahm er seine Tochter wieder mit. Erst im Sommer 1287 gab der Habsburger dem Drängen der böhmischen Seite nach und die Königin zog mit ihrem Gefolge auf dem Prager Hof ein. Ein Jahr später nahm Wenzel II. die Regierungsgeschäfte in eigene Hand. Eine seiner ersten selbständigen Amtshandlungen war im Jahr 1288 eine Verschwörung gegen seinen Stiefvater, der gerade, drei Jahre nach Kunigundes Tod, eine neue Ehe eingegangen war und dessen freiwilliger Verzicht auf die Macht im Land nicht zu erwarten war. Wenzel ließ Zawisch unter einem Vorwand in die Burg rufen und nahm ihn gefangen. Nach zweijähriger Kerkerhaft starb Zawisch von Falkenstein 1290 vor der Burg Hluboká durch das Schwert. Der tiefgläubige König soll schwer an seiner Entscheidung getragen haben. Das Zisterzienserkloster Zbraslav gründete er nach Aussage zeitgenössischer Quellen als Sühne für seinen Verrat.
Herrschaft
Sowohl der Vergleich mit seinem charismatischen Vater Přemysl Ottokar II., als auch die spektakulären und skandalträchtigen Ereignisse in der Jugend Wenzels II. haben das Urteil über den König jahrhundertelang geprägt. Er galt als ein schwacher Herrscher, seine Persönlichkeit wurde als neurotisch bis krankhaft beschrieben, das Interesse an seiner Regierungszeit war gering. So urteilte bereits sein Zeitgenosse Dante Alighieri über Vater und Sohn:
- Hieß Ott’kar, der, mit Windeln noch umkleidet,
- Besser als Wenzeslaus, sein Sohn, erschien,
- Der Bärt’ge, der an Üppigkeit sich weidet.[1]
Politisch und ökonomisch erlebte Mitteleuropa in den Jahren 1290–1305, in der Zeit Wenzels II. selbständiger Regierung, allerdings eine Phase der Ruhe und Stabilität. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern pflegte der König einen Regierungsstil, der auf fachkundige Berater und Diplomatie statt auf Krieg und Eroberung setzte. Den Besitz seines Vaters in den Alpenländern konnte er nicht wiedererlangen. Das Hauptaugenmerk böhmischer Außenpolitik richtete er nach Norden: Auf die Markgrafschaft Meißen, das Pleißenland und besonders nach Polen. Als Kurfürst war er auch einer der Hauptakteure in der Politik des Heiligen Römischen Reiches. Die römisch-deutschen Könige Rudolf I., Adolf von Nassau und Albrecht I. waren seine Lehnsherren. Der Reichtum und die Macht der böhmischen Krone ließ sie zu seinen Verhandlungspartnern und oft auch zu Gegnern werden.
Böhmen
Wenzel II. übernahm von seinem Stiefvater eine relativ gefestigte Herrschaft. Um das Land endgültig zu befrieden und den erstarkten Adelsstand in Schach zu halten, stützte sich der König auf seinen Hof und hier vor allem auf geistliche Ratgeber. Die Außenpolitik legte er in die Hände erfahrener Diplomaten: Zunächst verpflichtete er Bischof Arnold von Bamberg (1290–92), dann Bernhard von Kamenz (1292–1296) und schließlich Peter von Aspelt (1296–1304).
Wirtschaftlich hatte sich die Lage nach dem Niedergang während der Brandenburger Zeit um 1290 wieder stabilisiert. Der Landesausbau während der Binnenkolonisation im 13. Jahrhundert und vor allem die neuerschlossenen ergiebigen Silbervorkommen in Kutná Hora schufen Voraussetzungen für wirtschaftlichen Aufschwung. Bereits vor 1300 wurde hier 41% des europäischen und 90% des böhmischen Silbers gefördert. Um die Arbeit in den Bergwerken und damit seine wichtigste Einnahmequelle zu regeln, gab Wenzel II. zwischen 1300 und 1305 das Ius regale montanorum in Auftrag,. ein Bergrecht, das zumindest in Teilen bis 1854 gültig blieb. 1300 führte er eine Münzreform durch, um die Qualität der Währung zu heben. Der neue Prager Groschen setzte sich wegen seines stabilen Wertes auch im benachbarten Ausland durch. Der Prager Hof blieb unter König Wenzel II. wie schon unter seinem Vater ein kulturelles Zentrum, besonders der zeitgenössischen deutschen Literatur. Ulrich von Etzenbach widmete Wenzel II. einen Alexanderroman in 30.000 Versen, und vom König selbst sind in der Manessischen Liederhandschrift drei Minnelieder erhalten.
Zum glanzvollen Höhepunkt und Machtdemonstration des königlichen Paares sollte die Krönung werden. Sie musste mehrfach verschoben werden und fand daher erst im Jahr 1297 statt. Das Fest endete tragisch: Am siebzehnten Tag nach der Krönung starb Königin Guta an Erschöpfung in Folge der Geburt ihres zehnten Kindes. Der Fortbestand der Dynastie war trotz der hohen Kinderzahl nicht ausreichend gesichert. Fünf Kinder starben als Säuglinge. Drei Töchter konnte Wenzel II. zum Knüpfen diplomatischer Bündnisse einspannen: Agnes wurde mit Ruprecht von Nassau, Anna mit Heinrich von Kärnten und Margarethe mit Boleslav von Lehnitz vermählt. Elisabeth, ursprünglich wohl für den geistlichen Stand bestimmt, blieb zu Lebzeiten ihres Vaters ledig. Nur ein Sohn, der künftige König Wenzel III., erreichte das Erwachsenenalter.
Polen
Kurz nach seiner Regierungsübernahme schaltete sich Wenzel II. in die Machtkämpfe in Polen ein. Das in Herzogtümer zersplitterte Königreich erlag ab dem 12. Jahrhundert sukzessive dem feudalen Partikularismus. Wenzel begann, systematisch Verbündete zu suchen und die Teilherrschaften unter seine Kontrolle zu bringen. 1289 leistete ihm mit Kasimir von Beuthen der erste polnische Herzog für sein Herzogtum den Lehnseid. 1291 gewann er die Oberhoheit über einen Großteil des Herzogtums Oppeln und das Herzogtum Krakau und ging ein Bündnis mit Herzog Bolesław III. von Masowien ein, dem er seine Schwester Kunigunde zur Frau gab. 1292 eroberte er das von Herzog Władysław Ellenlang von Kujawien, seinem mächtigsten polnischen Widersacher, gehaltene Herzogtum Sandomir, und war nun die stärkste Kraft in der Provinz Kleinpolen.
Einen Rückschlag erlitt die Politik Wenzels II. 1295, als Herzog Przemysław II., stärkster Mann in Großpolen und Pommerellen, überraschend zum polnischen König gekrönt wurde. Dieser fiel jedoch bereits ein Jahr später einem Mordanschlag zum Opfer. Als sein Nachfolger setzte sich Władysław Ellenlang in seiner Eigenschaft als Herzog von Großpolen und Pommerellen zunächst durch. 1299 schloss der verschuldete Herzog einen Vertrag mit Wenzel II., in dem er sich gegen eine Geldzahlung verpflichtete, dem böhmischen König den Lehnseid zu leisten. Er hielt die Vereinbarung nicht ein, daraufhin zwang ihn der Böhme 1300 ins Exil. Wenzel II. setzte sich damit, neben dem Besitz von Kleinpolen, auch als Herrscher in den Provinzen Großpolen, Pommerellen, Kujawien und Mittelpolen mit den Hauptburgen Sieradz und Łęczyca durch. Nur einzelne polnische Territorien lagen ab da noch außerhalb seiner unmittelbarer Macht, zum Beispiel das mit ihm verbündete Masowien. Vorsichshalber holte Wenzel II. noch die Zustimmung seines eigenen Lehnsherrn, des römisch-deutschen Königs Albrechts I. ein, und er hielt um die Hand Rixas an, der einzigen Tochter des verstorbenen Königs Przemysław. Als beides positiv ausfiel, marschierte Wenzel II. erneut mit einem Heer in Polen ein. Die bewaffnete Begleitung diente nur der Machtdemonstration, denn ernsthaften Widerstand gab es nicht mehr. Gekrönt wurde er im August 1300 in Gnesen durch Erzbischof Jakub Świnka. Seine Herrschaft sicherte er mit einer Reihe von Verwaltungsreformen. Unter anderem führte er das Amt eines Starosten als königlichen Vertreter ein, das auch nach seinem Tod in Gebrauch blieb. Bis Ende 1300 blieb der neue polnische König in seinem Königreich, dann zog er zurück nach Prag. Er betrat Polen nie wieder.
Die zweite Frau des Königs war im Jahr 1300 zwölf Jahre alt. Trotz dieses bereits ausreichenden Alters gab es zunächst keine Eheschließung, sondern nur eine Verlobung. Anschließend schickte Wenzel das Mädchen zu seiner Tante Griffina auf die Burg Budyně. Erst 1303 wurde die Ehe vollzogen, und Rixa, die nach der Heirat den Namen Elisabeth annahm, wurde Mutter von Wenzels jüngster Tochter Agnes. Warum Wenzel II. nach Gutas Tod sechs Jahre Witwer geblieben war, anstatt sich um weitere legitime Söhne zu sorgen, ist unklar. Glaubt man dem Verfasser der Österreichischen Reimchronik, so herrschten in diesen Jahren lockere Sitten am Prager Hof, wilde Feste wurden gefeiert und eine Geliebte Wenzels namens Agnes gab den Ton an. Einen Thronfolger für die beiden Königreiche gab es immerhin bereits.
Ungarn
Kurz vor dem Tod Wenzels II. kam mit Ungarn noch ein drittes Kronland in den Besitz der Přemysliden. Thronfolger Wenzel III. wurde bereits 1298 mit der ungarischen Prinzessin Elisabeth verlobt. Als deren Vater Andreas III. 1301 starb, erhob unter anderem auch Karl Robert von Anjou Ansprüche auf den Thron. Die Magnaten entscheiden sich aber für die Přemysliden und trugen dem böhmischen König die Stephanskrone an. Wenzel II. zögerte, die finanzielle Belastung und das Risiko waren groß. Doch schließlich sagte er zu und sandte seinen Sohn nach Ungarn. Im Mai 1301 fand in Buda die Wahl und im August in Szekesfehervar die Krönung statt. Um seine Abstammung von den Arpaden zu verdeutlichen, nahm Wenzel III. den Namen Ladislaus V. an.
Die ungarische Herrschaft scheiterte nach zwei Jahren am Veto des Papstes Bonifatius VIII. und an Albrecht von Habsburg, die beide die Machtfülle der Přemysliden zu vermindern suchten. Der Papst verhielt sich zunächst neutral, doch am 31. Mai 1303 erklärte er Karl von Anjou zum rechtmäßigen König von Ungarn. Bonifatius VIII. starb zwar im September 1303, an der Situation für die böhmischen Könige änderte sich auch unter seinem Nachfolger Benedikt XI. jedoch nichts. Wenzel II. sah sich gezwungen, mit dem römisch-deutschen König in Verhandlungen zu treten. Dessen Bedingungen waren unannehmbar: Albrecht verlangte den Verzicht auf die ungarische und polnische Krone, der territorialen Ansprüche auf Eger, Meißen und die Oberpfalz sowie eine Beteiligung an den Silberbergwerken in Kutná Hora. Als Wenzel II. einen solchen Ausgleich ablehnte, wurde Ende Juni 1304 über ihn die Reichsacht ausgesprochen, und ein Kampf der beiden Mächte stand bevor. Im Frühjahr 1304 zog Wenzel II. zunächst seinem Sohn zur Hilfe. Dessen wichtigster Berater hatte das Land verlassen müssen, der junge König war faktisch ein Gefangener im eigenen Land. Der bewaffnete Zusammenstoß blieb zwar aus, doch die Magnaten wechselten die Seiten und versagten dem gewählten König ihre Unterstützung. Nach zwei Monaten zog sich Wenzel II. mit seinem Sohn mit nach Prag zurück und gab Ungarn auf. Bei seiner Rückkehr erkrankte der König. Die Anstrengungen des Feldzuges brachten den Ausbruch der Tuberkulose mit sich.
Die letzte Auseinandersetzung musste Wenzel II. wenige Monate später bestehen. Im August 1304 fiel Albrecht von Habsburg und seine Verbündeten, kumanische Reitertrupps, in Mähren ein. Der böhmische und mährische Adel stand geschlossen auf Seiten seines Königs, doch Wenzel II. ließ sich auch diesmal nicht zum Kampf provozieren. Das Heer des Habsburgers wurde dennoch aufgerieben: Zunächst vergifteten die Bergleute in Kutná Hora das Trinkwasser der Feinde mit Silberstaub, und als Albrecht wegen des beginnenden Winters zum Abzug rüstete, griffen die böhmischen Truppen die Heimkehrer an. Die Friedensverhandlungen im Jahr 1305 bereitete Wenzel noch vor, den Friedensschluss erlebte er aber nicht mehr.
Tod
Der Tod des Königs dauerte ein halbes Jahr. Da seine Residenz in der Burg 1303 ausgebrannt war, lag der Kranke im Haus des Goldschmieds Konrad in der Prager Altstadt. Die Königssaaler Chronik schildert ausführlich, wie der Sterbende seine Angelegenheiten ordnete: er bezahlte seine Schulden, versorgte seine Witwe und gab einen Teil seines Vermögens der Kirche und den Armen. Dann tat er Buße. Nach seinem Tod am 21. Juni 1305 wurde sein Leib mit dem Schiff in das Kloster Zbraslav gebracht und in vollem königlichen Ornat in der Klosterkirche beigesetzt. Der Bericht über den Tod des Königs konnte als Argumentationsgrundlage für seine spätere Heiligsprechung verfasst worden sein. Zu diesem Schritt kam es nicht.
Wenzel II. war der vorletzte Přemyslidenkönig. Mit seinem Sohn und Nachfolger Wenzel III., der bereits 1306 einem Mordanschlag zum Opfer fiel, starb die Dynastie nach über 400-jähriger Herrschaft über Böhmen in der königlichen Linie aus.
Literatur
- • Verwendete Literatur:
- • Charvátová, Kateřina. Václav II. Král český a polský. Praha : Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-841-9.
- • Žemlička, Josef u. U. Schulze: Wenzel II. in: Lexikon des Mittelalters 8 (1977), sp. 2188-2190
- • Weiterführende Literatur:
- • Příběhy krále Přemysla Otakara II. Zlá léta po smrti krále Přemysla Otakara II. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 1947.
- • Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno : Matice moravská, 2006. ISBN 80-86488-27-6.
- • Šusta, Josef: Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. 2. Bände, Praha : Argo, 2001 und 2002. ISBN 80-7203-376-X (Bd. 1), ISBN 80-7203-377-8 (Bd. 2)
- • Adolf Bachmann: Wenzel II.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42. Duncker & Humblot, Leipzig 1897, S. 753–756.
- • Quellen:
- • Chronicon Aulae Regiae (1311–1339): Die Königsaaler Geschichtsquellen. Mit den Zusätzen und der Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag. Hg. Johann Loserth, Wien 1875, Nachdruck in der Schriftenreihe Fontes rerum Austriacarum : Abt. 1, Scriptores ; 8, Graz 1970
- • Ottokars Österreichische Reimchronik: Monumenta Germaniae Historica : [Scriptores. 8], Deutsche Chroniken = (Scriptores qui vernacula lingua usi sunt) ; 5,1
Anmerkungen
- ↑ Dante Aligihieri: Göttliche Komödie, Siebenter Gesang, in der Übersetzung von Carl Streckfuß, Leipzig 1876
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Wenzel III. (Böhmen)
Wenzel III. (* 6. Oktober 1289; † 4. August 1306 in Olmütz) war ab 1301 König von Ungarn, ab 1305 König von Böhmen und Titularkönig von Polen und der letzte aus der Dynastie der Přemysliden.
Leben
Wenzel III. war der einzige Sohn des Königs Wenzels II. und seiner Frau Guta von Habsburg. Nach dem Aussterben der Arpaden wurde er 1301 in Stuhlweißenburg als Ladislaus V. zum König von Ungarn gekrönt. Nach dem Tod seines Vaters erbte er 1305 die böhmische und polnische Krone, die sein Vater kurz zuvor erworben hatte. Neben den Kronen erbte er aber auch den Krieg mit Albrecht I. und den von Władysław I. Ellenlang angeführten Aufstand in Polen sowie Unruhen in Ungarn.
Papst Bonifatius VIII., der die Lehnshoheit über Ungarn beanspruchte, erklärte die Herrschaft über Polen und Ungarn schließlich für ungültig. Nach wenigen Wochen schloss er einen Friedensvertrag mit König Albrecht I., der durch Feldzüge das Urteil des Papstes durchzusetzen versuchte. Wenzel verlor das Egerland sowie die sich in böhmischer Hand befindlichen Teile des Vogtlands und der Mark Meißen. Die ungarische Krone verlor er an Otto von Bayern.
Er konzentrierte seinen Herrschaftsanspruch nun auf die polnischen Gebiete. Er heiratete Viola Elisabeth von Teschen aus der Piasten-Dynastie, verband sich mit einigen deutschen Ordensrittern, die ihn bei den Verhandlungen mit den Polen unterstützten. Gleichzeitig begann er mit Vorbereitungen zu einem Kriegszug, mit dem er seine Macht stärken wollte. Am 4. August 1306 wurde er im Hause des Olmützer Domdekans ermordet. Der Mörder ist bis heute unbekannt.[1]
Nachfolge
Wenzel III. war mit Viola Elisabeth von Teschen verheiratet. Mit ihm erloschen die Přemysliden im Mannesstamm. In Böhmen entflammte erneut eine Welle der Gewalt, als die mächtigen Adeligen während des Machtvakuums versuchten, ihre Ländereien und Vermögen auszuweiten. Es kam zu Usurpationen kirchlicher Vermögenswerte. Gleichzeitig versuchte man Ungerechtigkeiten, die man erfahren hatte, auszugleichen. Diese Situation nutzten die Luxemburger aus und übernahmen den böhmischen Thron.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Přemysliden
Die Přemysliden (tschechisch Přemyslovci) waren ein böhmisches Herrschergeschlecht. Sie waren vom Ende des 9. Jahrhunderts bis 1306 mit Unterbrechungen um 1000 in Böhmen an der Macht. Anfangs regierten sie nur in Teilen Böhmens. Eine frühere Herrschaft ist historisch nicht belegt.[1]
Herrschaftsbereich
Die Přemysliden herrschten seit dem Ende des 9. Jahrhunderts als Herzöge von Böhmen. Erster König von Böhmen wurde 1158 Vladislav II., mit Ottokar I. wurde das Königtum 1198 erblich. 1212 wurden die Länder der böhmischen Krone zum Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches erhoben. Ab dieser Zeit wurde auch die dynastische Thronfolge festgelegt. Zum Machtbereich der Přemysliden gehörten von Anfang an bzw. kamen später hinzu:
• Das Glatzer Land und weite Teile Schlesiens gehörten bereits im 9. Jahrhundert zum Großmährischen Reich und im 10. Jahrhundert zum Herrschaftsbereich des böhmischen Fürsten Slavnik. Sie verblieben auch nach dem Pfingstfrieden von Glatz bei Böhmen;
- • weitere Teile Schlesiens und Kleinpolens fielen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts vorübergehend an Böhmen.
- • 1019 bis 1027 Mähren;
- • 1266 Eger und Umgebung;
- • 1289 bis 1292 das Gebiet um Teschen (entspricht dem östlichen Teil des späteren Österreichisch-Schlesien);
- • 1156 bis 1253 das Land Budissin, später Oberlausitz genannt
Geschichte
Bis zum 10. Jahrhundert
Nach den Ausführungen in der Chronica Boemorum des Cosmas von Prag sind die Přemysliden Nachkommen des sagenhaften Stammvaters Přemysl der Pflüger, eines eingeheirateten Stammesführers, und seiner Frau Libussa. Cosmas überlieferte auch die Namen weiterer vorchristlicher Přemysliden: Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan und Hostivít.[2] Die nur von Cosmas überlieferte Aufzählung weist auf eine ältere Familientradition hin. Ob einige der acht Herrschernamen historischen Persönlichkeiten entsprechen, kann aus ihr aber nicht zweifelsfrei geschlossen werden.
Im 9. Jahrhundert zählten die Přemysliden zu den böhmischen Lokalfürsten (duces). Ihr Sitz war die mittelböhmische Burgstätte Levý Hradec. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts verlegten sie ihren Sitz auf die neu gegründete Prager Burg und gewannen nachfolgend Autorität über die Lokalfürsten des Moldautals. Zwischen 882 und 885 wurde der erste historisch belegte Přemyslide Bořivoj I. mit seiner Frau Ludmilla im benachbarten Großmährischen Reich von Method getauft.
Nach Bořivojs Tod um 889 wurde Böhmen bis 894 unter Fürst Sventopluk aus der Dynastie der Mojmiriden vorübergehend Großmähren angeschlossen. Nach Sventopluks Tod übernahm von 894 bis 915 Bořivojs Sohn Spytihněv I. die Herrschaft und ging auf Distanz zum Großmährischen Reich. 895 musste er dem Kaiser Arnulf von Kärnten Treue schwören. Nach seinem Tod setzte sein Bruder Vratislav I. von 915 bis 921 die Politik Bořivojs fort.
929 oder 935 wurde Wenzel der Heilige, Sohn Vratislavs I., der seit 921 herrschte, von seinem Bruder Boleslav I. und dessen Gefolgsleuten ermordet. Da Wenzel seit der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts als heiligmäßig verehrt und bereits im 11. Jahrhundert zum Landespatron erhoben wurde, galten danach sämtliche Fürsten Böhmens als Wenzels irdische Stellvertreter. Auch die für die Krönung von Karl IV. im 14. Jahrhundert angefertigte böhmische Königskrone wurde als Wenzelskrone bezeichnet.
Die Regierungszeit von Boleslav I. (929 oder 935-972[3]) markiert die Begründung eines einheitlichen böhmischen Zentralstaates, wozu auch 973 die Errichtung des Bistums Prag unter Boleslav II. (972-999) beitrug. Die letzten nicht přemyslidischen Lokalfürsten wurden meistens gewaltsam beseitigt. Als entscheidende Widersacher wurden von den Gefolgsleuten Boleslavs II., den Vršovci, 995 die Slavnikiden in Libice ermordet, womit die Vereinigung Böhmens vollzogen war. Nach 955 beherrschten die Přemysliden auch weitere Gebiete Schlesiens und Kleinpolens bis weit hinter Krakau, wie der jüdische Gesandte Ibrahim ibn Jaqub seinem Kalif Abd ar-Rahman III. 965 berichtete. Dazu kam das ehemalige Reich Großmähren [4] und äußerst umstritten und nach herrschender Meinung eher unwahrscheinlich bleibt die zusätzliche Besetzung der Westslowakei (wenn, dann die Slowakei wohl zwischen 955 und um 975).
11. Jahrhundert
Seit Ende des 10. Jahrhunderts verschärften sich die Spannungen gegenüber Polen. Im Zuge der Thronkämpfe zwischen Boleslavs Söhnen um 1000 gab es Interventionen Polens (Bolesław I. Chrobry) und des römisch-deutschen Reiches, bei denen Polen Mähren, Schlesien und Kleinpolen eroberte. 1019 beendete Oldřich (Udalrich) die polnische Besetzung Mährens, das damit auf Dauer Böhmen angeschlossen wurde.
Udalrichs Sohn Břetislav I. führte erfolgreich Krieg gegen Polen und war nach militärischen Auseinandersetzungen mit König Heinrich III. Verbündeter des Heiligen Römischen Reiches gegen Ungarn. Seine Nachfolge regelte Břetislav 1055 durch die Senioratsordnung, wonach der jeweils älteste Přemyslid die Herrschaft ausüben sollte. Während seine ältesten Söhne Spytihněv II. und Vratislav II. nacheinander herrschten und Jaromír-Gebehard Bischof von Prag wurde, regierten die jüngeren Söhne als Teilfürsten in Mähren: Konrad I. erhielt Brünn und Znaim, Otto I. († 1087) und seine Nachfolger herrschten in Olmütz; ihre Ansprüche auf den Prager Thron verloren sie dadurch dennoch nicht.
1085-1086 erhob der römisch-deutsche König Heinrich IV. Vratislav II. als Belohnung für seine Hilfe gegen die Sachsen zum König (noch nicht erblich). Seine Nachfolger Konrad I. von Brünn und Břetislav II. mussten sich mit dem Herzogstitel begnügen.
Seit dem 12. Jahrhundert
1099 erreichte Břetislav II. die Anerkennung seines Halbbruders Bořivoj II. (1101-1107 sowie 1117-1120) als Nachfolger, womit er erstmals gegen das Senioratsgesetz verstoßen hat. Versuche, das Seniorat durch die Primogenitur zu ersetzen, verschärften am Anfang und gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Thronkämpfe. Die Gegnerschaft der beiden Prager Hauptlinien, die von den Brüdern Vladislav I. (1109-1117 sowie 1120-1125) und Soběslav I. (1125-1140), abstammten, hatte schwerwiegende Folgen. Die Auseinandersetzungen zwischen dem Zweig des Vladislav I. (Vladislav II., Friedrich, Vladislav Heinrich, Ottokar I. Přemysl) und dem Zweig des Soběslav I. (Soběslav II., Wenzel I.) verschärften sich durch Interventionen der mährischen Přemysliden (Ulrich von Brünn, Konrad II. von Znaim, Konrad III. Otto von Znaim) und anderer Thronanwärter (Děpold, Heinrich Břetislav III. und andere). Die nicht aus Prag stammenden Přemysliden wurden auch einige Male Herrscher in Prag (Svatopluk II. 1107-1109, Konrad III. Otto 1189-1191, Heinrich Břetislav III. 1193-1197), doch ihre Bemühungen trafen auf hartnäckigen Widerstand des Prager Hofs. Zudem mischte sich bei den Thronstreitigkeiten auch das römisch-deutsche Reich ein, wobei insbesondere Lothar von Supplinburg 1126 in der Schlacht bei Chlumec eine vernichtende Niederlage gegen Herzog Soběslav I. erlitt und gefangen genommen wurde. Vladislav II. (1140-1172) erhielt 1158 den Königstitel, der jedoch nicht auf seine Nachfolger überging (vergleiche Vratislav II.). Im 12. Jahrhundert schlossen die Přemysliden Ehen mit den polnischen Piasten, den ungarischen Árpáden, den Wettinern und Babenbergern, aber auch mit den Familien der bayerischen Grafen von Bogen, von Berg und den Wittelsbachern.
Mit Herzog Wenzel II. († um 1192) erlosch der Zweig Soběslavs I., und um 1200 starben die meisten mährischen Přemysliden aus. Ihr letzter Vertreter war Siffrid († 1227, Kanoniker in Olmütz). Der Herzog Ottokar I. Přemysl (1192-1193 sowie 1197-1230) vom anderen Zweig erhielt hingegen vom römisch-deutschen Reich 1198 den Titel König von Böhmen. Dieser wurde ihm und seinen Nachfolgern samt aller erworbenen Privilegien, dank seiner geschickten Politik gegenüber Philipp von Schwaben, Otto IV. und Friedrich II., schließlich durch die Goldene Bulle von Friedrich II. 1212 zuerkannt. Nach dem Tod seines kinderlosen Bruders Vladislav Heinrich († 1222), Markgraf von Mähren, und nach der Vertreibung der Theobalde (um 1223), die später im Exil ausstarben, waren die Nachkommen von Ottokar I. Přemysl die einzigen Repräsentanten der Přemysliden, so dass bereits 1216 Ottokar I. Přemysl seinen Sohn Wenzel I. 1228 krönen lassen konnte.
Unter Wenzel I. (1230-1253), der mit Kunigunde von Schwaben, der Tochter von Philipp von Schwaben und Enkelin des ungarischen Königs Béla IV. verheiratet war, begann die Expansionspolitik der Přemysliden. Diese erreichte ihren Höhepunkt unter Ottokar II. Přemysl (1253-1278), dessen Ehe mit Margarethe von Babenberg die Erwerbung Österreichs ermöglichte; später schlossen sich auch die Steiermark, das Egerland, Kärnten und Krain an. Přemysl musste sich mit einer starken Adelsopposition in Böhmen, Österreich und den Alpenländern auseinandersetzen. Im Kampf mit Rudolf von Habsburg wurde er 1276 besiegt und in der Schlacht von Dürnkrut 1278 getötet. Wenzel II. (1278/1283-1305), der Sohn Ottokars II., nutzte das infolge der Kämpfe der Adelsopposition in Böhmen entstandene Chaos, um die Zentralmacht wieder zu konsolidieren. Von 1278 bis 1283 regierten für den noch nicht erwachsenen Wenzel Otto von Brandenburg in Böhmen und Rudolf von Habsburg in Mähren. 1300 gewann Wenzel kurzfristig die polnische Krone und 1301 die ungarische Krone (die allerdings für seinen Sohn Wenzel III.). Doch die Unzufriedenheit des polnischen und ungarischen Adels sowie die Feindschaft des römisch-deutschen Kaisers bewirkten den baldigen Verlust der beiden Kronen: Wenzels Sohn Wenzel III. (1305-1306) musste 1304 Ungarn verlassen, da er nur in Westungarn von den Grafen von Güssing aus dem Geschlecht der Héder und in der heutigen Slowakei von Matthäus Csák (Matúš Čák) unterstützt wurde. Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters 1305 wurde er böhmischer König. Am 4. August 1306 wurde er jedoch auf einem Feldzug gegen Polen in Olmütz ermordet. Man konnte sich nicht auf einen der vielen přemyslidischen Verwandten als Nachfolger einigen. Prädestiniert dafür wäre Heinrich von Leipa gewesen, dessen Nachkomme Hynek Ptáček von Pirkstein erst mehr als 100 Jahre später zum Böhmischen König gewählt, aber als Hussitenführer weder vom Haus Habsburg noch vom Papst anerkannt wurde. Erst dessen Schwiegervater Georg von Podiebrad wurde 1456 als Böhmischer König inthronisiert.
Die Heirat von Wenzels II. Tochter Elisabeth mit Johann von Luxemburg im Jahre 1310 war die Grundlage für die Thronbesteigung der Luxemburger in Böhmen und Mähren.
Troppauer Zweig der Přemysliden
Der Troppauer přemyslidische Herzogslinie wurde 1269 begründet als Ottokar II. Přemysl die Provinz Troppau seinem natürlichen Sohn Nikolaus I. als ein eigenständiges Herzogtum Troppau zuwies. Es blieb bis 1462 bei dessen Nachkommen. Die von Nikolaus II. von Troppau 1337 begründete Herzogslinie Troppau-Ratibor starb 1521 in männlicher Linie mit Herzog Valentin aus. Das 1377 von Johann I. von Troppau-Ratibor begründete Herzogtum Troppau blieb – mit einer Unterbrechung 1474–1490 – bis 1493 in přemyslidischer Hand.
Literarische Verarbeitung
- • Wenzel II. hat selbst einige Minnelieder verfasst.
- • Ulrich von Etzenbach hat für Ottokar II. Přemysl eine Alexanderdichtung verfasst, und für seinen Sohn Wenzel II. den Wilhelm von Wenden geschrieben, der als Ursprungslegende der Herrscher gelten kann.
- • Adalbert Stifter hat in seinem Roman Witiko einen Ausschnitt der Streitigkeiten im 12. Jahrhundert literarisch gestaltet.
- • Das Drama „König Ottokars Glück und Ende“ von Franz Grillparzer beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung Ottokars II. und Rudolf von Habsburgs.
Literatur
- • Sommer, Petr; Třeštík, Dušan; Žemlička, Josef, et al: Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 779 S. ISBN 978-80-7106-352-0.
- • Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 658 S. ISBN 80-7106-138-7.
Einzelnachweise
- ↑ Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Nakladatelství lidové noviny, 1998, ISBN 80-7106-138-7.
- ↑ Kosmova Kronika česká. Paseka, Praha-Litomyšl 2005, ISBN 80-7185-515-4.
- ↑ 929 lebte noch sein Bruder Wenzel von Böhmen, den er 935 ermorden ließ. Auch über seine Kriegszüge, ein weiteres Indiz für seine Herrschaft, wird erst seit 936, als er gegen Otto I. zog, berichtet
- ↑ Großmähren dürfte eher unbestritten sein, da bereits Boleslav I. begonnen hatte, dort ein Bistum zu errichten, welches ein Jahr nach seinem Tod gegründet wurde. Quelle: Michal Lutovský, Zdeněk Petráň: Slavníkovci ISBN 80-7277-291-0
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Władysław I. Ellenlang
Władysław I. Ellenlang (polnisch Władysław I Łokietek, lateinisch Ladislaus; * 1260; † 2. März 1333 in Krakau, Polen), war als Władysław IV. ab 1306 Princeps von Polen (dux Regni Poloniae), und ab 1320, als Władysław I., König von Polen (rex Poloniae); aus der Dynastie der kujawischen Piasten.
Vor seiner Krönung zum polnischen König 1320 stand Herzog Władysław mit anderen männlichen Vertretern der Piastenlinie und dem böhmischen Königshaus der Přemysliden bei der Einigung des Königreichs Polen in Konkurrenz. Den Beinamen Ellenlang oder der Ellenlange (polnisch Łokietek, Diminutiv von łokieć, zu deutsch Elle oder Ellenbogen) erhielt er aufgrund seiner kurzen Statur.
Biografie
Wladyslaw war der Sohn von Herzog Kasimir von Kujawien. Seit 1267 befand sich der minderjährige Władysław unter der Vormundschaft seiner Mutter Euphrosyne, dann der älteren Brüder Leszek und Siemomysław. Bei seiner Volljährigkeit, 1275, erhielt Władysław Südkujawien mit Brześć Kujawski als Teilherzogtum. 1288 erbte Władysław nach dem Tod des Halbbruders Leszek, der seit 1279 die Seniorherzogswürde trug, das Land von Sieradz und nahm am Krieg um Kleinpolen gegen Heinrich IV., Herzog von Schlesien-Breslau, auf der Seite Bolesławs, des Herzogs von Masowien-Płock teil. 1289 besetzte Władysław vorübergehend Krakau, musste in Kleinpolen schließlich Heinrich IV. weichen, behielt aber das Land von Sandomir. Nach dem Tod Heinrichs IV., 1290, begann der Kampf um Krakau erneut. König Wenzel II. von Böhmen besetzte 1291 Kleinpolen, verdrängte 1292 Władysław aus Sandomir und zwang ihn zur Lehnshuldigung. Als 1294 Kasimir II., Herzog von Łęczyca, starb, erbte Wladyslaw sein Herzogtum.
Die Ermordung des Königs Przemysław von Polen, des Herrn über die Herzogtümer Großpolen und Pommerellen, Anfang 1296, verursachte Kämpfe um die Nachfolge in Polen. Władysław wurde zwar zum Herzog und Nachfolger dieser Gebiete gewählt, verlor aber im Abkommen von Krzywin vom 10. März 1296 einen Teil Großpolens an der Netze mit den Hauptburgen Santok, Drezdenko und Wałcz an die Mark Brandenburg, während die südwestlichen Gebiete Großpolens zwischen Międzyrzecz und Gostyń an Herzog Heinrich von Glogau fielen. 1297 verzichtete Władysław auf seine Ansprüche auf Krakau und huldigte 1299 in Kłęka erneut König Wenzel II., der ihn nach seiner Krönung zum polnischen König, 1300, aufgrund der ständigen Vertragsbrüche ganz aus Polen vertrieb.
1304 kehrte Wladyslaw mit Hilfe des ungarischen Magnaten Aba zurück in die Heimat. Mit dem Tod Wenzels II. 1305 und der Ermordung seines Sohns Wenzel III. 1306, war das böhmische Königsgeschlecht der Přemysliden im erbberechtigten Mannesstamm erloschen. Der Tod beider böhmischer Herrscher erleichterte nun die Durchsetzung von Władysławs Herrschaft in Kleinpolen, im Land von Sieradz und Łęczyca, sowie in Kujawien und Pommerellen, während man in Großpolen Heinrich von Glogau herbeirief. Władysław konnte 1308 Pommerellen nicht vor einem Angriff der Markgrafen von Brandenburg schützen, die bestrebt waren, von einer im Dezember 1231 in Ravenna durch Kaiser Friedrich II. (HRR) erfolgten Belehnung mit Pommern Gebrauch zu machen, die noch 1295 in Mühlhausen bestätigt worden war. Er bat den Deutschen Orden um Hilfe gegen Entgelt. Das Ausbleiben der für den Hilfsdienst vereinbarten Entschädigung führte zur Übernahme von Danzig durch den Deutschen Orden, und 1309 von ganz Pomerellen. Im Vertrag von Soldin (1309) kaufte der Orden den Markgrafen ihre Rechte ab, die sie außerdem noch aus dem Vertrag von Arnswalde geltend machen konnten. Die Übernahme Pommerellens einschließlich Danzigs durch den Deutschen Orden verursachte langwierige Auseinandersetzungen mit Polen, die das deutsch-polnische Verhältnis für mehrere Jahrhunderte belastete. Im Winter 1311 führten Interessenunterschiede zwischen Krakau, im Bündnis mit einigen anderen kleinpolnischen Städten, und dem Adel zum sog. Aufstand des Vogtes Albert, den Władysław niederschlug. Seine Niederlage verhinderte langfristig die Realisierung der politischen Ansprüche insbesondere des deutschsprachigen Bürgertums in Polen. 1314 rebellierte der großpolnische Adel gegen die Herrschaft der Herzöge von Glogau und rief Władysław zu Hilfe, der diese Provinz seinem Reich angliederte. Im Jahr 1315 schloss Polen mit den slawischen Herrschern von Mecklenburg und Pommern, sowie den skandinavischen Mächten Dänemark und Schweden, ein gegen die Mark Brandenburg gerichtetes Bündnis. Es brach ein Krieg aus, der allerdings ohne Erfolg für Władysław endete und in der brandenburgischen Neumark nur ein verwüstetes Gebiet hinterließ. In der nun eingeleiteten Wiedervereinigung Polens errang der Adel eine dominierende Stellung. Obwohl Johann von Luxemburg, der neue König von Böhmen, Ansprüche auf den polnischen Thron erhob, erlangte Władysław die Zustimmung Papst Johannes' XXII. in Avignon zu seiner Krönung am 20. Januar 1320 in Krakau. 1321 verurteilte ein Kurialgericht in Inowrocław und Brześć Kujawski den Deutschen Orden zur Herausgabe Pommerellens und zur Zahlung einer Entschädigung; der Urteilsspruch blieb jedoch wirkungslos.
Die polnisch-ungarische Allianz wurde 1320 durch die Heirat Elisabeths, einer Tochter Władysławs, mit Karl Robert von Anjou bekräftigt. 1323 setzten polnisch-ungarische Hilfstruppen den Sohn des Piasten Trojden, Herzog von Masowien-Czersk, Bolesław-Trojdenowicz (als Fürst der westlichen Rus, Georg bzw. Jurij II. genannt), auf den Thron von Halytsch-Wolhynien, der über seine Mutter Maria, Prinzessin und Erbin von Halytsch-Wolhynien, aus dem Haus Roman, einer männlichen Seitenlinie der Rurikiden, abstammte. 1325 führte der Bündnisvertrag mit Gedimin, Großfürst von Litauen, zur Heirat von dessen Tochter Aldona-Anna mit dem polnischen Thronfolger Kasimir. 1326 verwüstete Władysław mit litauischer Unterstützung die Neumark. Im Winter 1327 zog König Johann von Böhmen gegen Krakau. Zwar kehrte er unter ungarischem Druck zurück, doch huldigten ihm viele Piasten-Herzöge Schlesiens, und bis 1329 erkannten fast alle Herzöge die böhmische Lehnshoheit über Schlesien an. Im Sommer 1327 brachen offene Kämpfe Władysławs mit dem Deutschen Orden aus, der mit König Johann verbündet war. Die gegnerischen Truppen besetzten das Land von Dobrin, währenddessen sah sich Herzog Wenzel von Masowien-Płock gezwungen dem böhmischen Herrscher für sein Teilherzogtum 1329 zu huldigen (böhmische Lehnsabhängigkeit bis 1351). Bei neuen Kämpfen 1330 und 1331 verwüsteten Truppen des Deutschen Ordens Großpolen und besetzten trotz einer unentschiedenen Schlacht bei Plowce am 27. September 1331 im folgenden Jahr ganz Kujawien. Während des Waffenstillstands, der im Sommer 1332 auf Vermittlung des päpstlichen Legaten Peter von Alvernia für ein Jahr zustande kam, starb König Władysław. Er hinterließ seinem Sohn und Nachfolger Kasimir nur zwei alte Herrschaftsregionen der Piasten, Großpolen mit der Hauptburg Posen und Kleinpolen mit der Hauptstadt Krakau, sowie einige mittelpolnische Länder um Sieradz und Łęczyca.
Machtbereich des Władysław Ellenlang in den Jahren 1267–1333
Der Machtbereich Władysławs unterlag in seinem Kampf um die politische Selbstbehauptung gegen konkurrierende Zweige der Piastendynastie, das böhmische Königshaus, sowie den Deutschen Orden einem stetigen Wandel. Es war eine Zeit in der sich die neuen Grenzen des erneuerten polnischen Königreichs herausbildeten.
- 1267–1300 Herzog von Kujawien in Brześć Kujawski und Dobrin, bis 1275 unter Vormundschaft der Mutter, 1275–1288 gemeinsam mit seinen Brüdern, ab 1288 allein in Brześć Kujawski;
- 1288–1300 Herzog in Sieradz;
- 1289–1292 Herzog von Kleinpolen in Sandomir;
- 1294–1300 Herzog in Łęczyca;
- 1296–1300 Herzog von Großpolen und Pommerellen;
- 1300–1304 durch König Wenzel von Böhmen entmachtet, dem er 1292 und 1299 huldigte, im Exil bis 1304;
- 1304–1333 Herzog von Kleinpolen in Wiślica;
- 1305–1333 Herzog von Kleinpolen in Sandomir, Herzog in Sieradz und Łęczyca;
- 1305–1332 Herzog von Kujawien in Brześć Kujawski, 1332 Annexion durch den Deutschen Ritterorden;
- 1306–1333 Herzog von Kleinpolen in Krakau;
- 1306–1309 Herzog von Pommerellen, 1309 Annexion durch den Deutschen Ritterorden;
- 1306–1329 Herzog von Dobrin, 1329 Annexion durch den Deutschen Ritterorden;
- 1306–1332 Herzog von Kujawien in Inowrocław, 1332 Annexion durch den Deutschen Ritterorden;
- 1314–1333 Herzog von Großpolen;
Piastische Gebiete außerhalb der Grenzen des Königreichs Polen unter König Władysław I. Ellenlang
- Schlesische Herzogtümer, Verlust bis de facto 1945;
- Herzogtum Masowien-Płock bis 1351, dann direkter Anschluss ins Königreich;
- Herzogtum Masowien-Warschau bis 1351, dann Lehen der polnischen Krone, direkter Anschluss ins Königreich 1526;
Nachkommen
König Władysław war seit 1293 mit der Prinzessin Hedwig von Kalisch verheiratet. Das Paar hatte insgesamt fünf Kinder:
- • Kunigunde (ca. 1295–1331/33), Prinzessin von Polen, verheiratet ca. 1310 mit dem schlesischen Herzog Bernard von Schweidnitz, ab 1328 mit Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg
- • Stefan (1296/1300–1306), Prinz von Polen
- • Władysław (1297–1311/1312), Prinz von Polen
- • Elisabeth (1305–1380), Prinzessin von Polen, als Gattin von König Karl I., Königin von Ungarn
- • Hedwig (1306/1309–1320/1325), Prinzessin von Polen
- • Kasimir (1310–1370), Prinz von Polen, ab 1333 König von Polen
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Ludwig I. (Ungarn)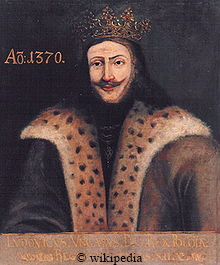
Ludwig der Große (ung. Lajos I. Nagy – Ludwig der Große, pol. Ludwik Węgierski (Andegaweński) – Ludwig der Ungar oder von Anjou; * 5. März 1326 in Visegrád; † 10. September 1382 in Trnava) war ab 1342 König von Ungarn, und ab 1370 König von Polen.
Ludwig als König von Ungarn
Ludwig I. war Sohn des Königs Karl-Robert von Ungarn aus dem Haus Anjou und seiner Gemahlin Elisabeth geb. Prinzessin von Polen, Schwester des letzten Piasten, König Kasimir des Großen. Nach dem Tod seines Vaters folgte Ludwig diesem 1342 als König und wurde in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) gekrönt.
Ludwig war bestrebt, die Position Ungarns als eine europäische Großmacht auszubauen und die Königsmacht zu stärken. In seiner Innenpolitik stützte er sich auf die Magnaten, die vom Hofe abhängig waren und auf die Würdenträger der Kirche, war jedoch gleichzeitig bedacht, das Gleichgewicht zwischen den Magnaten und der Masse des Kleinadels beizubehalten. So erneuerte er 1351 die von Andreas II. gewährte Goldene Bulle und bestätigte dadurch die Rechte des Klein- und Mitteladels. Durch Verwaltungsreformen beschnitt er die Rolle des Reichstags und verlegte das Hauptgewicht auf Komitate (Grafschaften), die statt Militärzentren zu Organen der Administration und des Justizwesens wurden. 1367 ließ Ludwig die Universität von Fünfkirchen gründen. Die Macht des Königs wurde in seinem gesamten Herrschaftsgebiet dadurch geschwächt, dass er über keinen männlichen Erben verfügte.
Im Jahr 1343 wurde er zum Oberherrn der Walachei, 1344/45 beteiligte er sich an einem Kriegszug des Deutschen Ordens und Johanns von Böhmen gegen Litauen.[1] 1356 unterwarf er Bosnien. In zwei Kriegen gegen die Republik Venedig (1356–58 und 1378–81) gewann er Dalmatien und die Schutzherrschaft über die Republik Ragusa (Dubrovnik).
Ludwig als König von Polen
Da sein Onkel König Kasimir I. von Polen keine männlichen Nachkommen hatte, hatte er bereits 1351 Ludwig als Erben der polnischen Krone eingesetzt.[2] Nach Kasimirs Tod 1370 wurde Ludwig dann am 17. November 1370 in Krakau von Erzbischof Jaroslaw I. Bogoria von Gnesen zum König von Polen gekrönt. Schon vor seinem Herrschaftsantritt gewährte Ludwig dem polnischen Adel aber 1355 im Privileg von Buda das Königswahlrecht, verzichtete zudem auf das Recht, außerordentliche Steuern zu erheben, auf kostenlose Gastung und auf den Kriegsdienst polnischer Adliger außerhalb Polens ohne Entschädigung. Dadurch verfügte Ludwig nach seiner Krönung zum König von Polen über eine wesentlich schwächere Position als seine Vorgänger. Er bemühte sich auch nicht intensiv um die Herrschaftsdurchsetzung in Polen, sondern er zog sich nach Ungarn zurück und übertrug die Regentschaft in Polen seiner Mutter Elisabeth.
Das ungarische Regime wurde in Polen von den kleinpolnischen Magnaten unterstützt, während die großpolnischen Anhänger des Piasten Ziemowit IV. von Masowien, ständig Unruhen stifteten. Gleichzeitig bemühte Ludwig sich, einzelne Randprovinzen, etwa die Ländereien um Lemberg aus dem polnischen Staatsverband herauszubrechen und in Ungarn zu integrieren. In anderen Gebieten übernahmen lokale Fürsten die Macht, ohne dass Ludwig sich um eine Durchsetzung seiner Herrschaft bemühte.
Am restlichen Polen war Ludwig nur soweit interessiert, als er es als Mitgift für seine aus seiner 1353 geschlossenen zweiten Ehe (seine erste Ehefrau Margarethe von Luxemburg starb noch als Kind) mit Elisabeth (Jelisaveta), der Tochter des Banus von Bosnien, Stjepan II., stammenden Töchter Maria und Hedwig nutzen wollte. Allerdings stand dies im Widerspruch zu der 1339 geschlossenen Vereinbarung, dass lediglich männliche Nachkommen in Polen erbberechtigt sein sollten. 1374 gelang es Ludwig mit dem Privileg von Kaschau (von Wladislaus II. von Oppeln), beim polnischen Adel die Einwilligung in die weibliche Erbfolge zu erlangen. Das Privileg senkte die Steuerlast des Adels erheblich ab, verbat die Einsetzung von Ausländern in Verwaltungsämter und verpflichtete den König, Polen als eigenständiges Königreich zu erhalten und sich für die Rückgewinnung verlorener Gebiete einzusetzen. Das Privileg wurde zur Grundlage der späteren Adelsdemokratie in Polen. Wegen seiner ständigen Abwesenheit und der Konzentration auf dynastische Pläne blieb Ludwig in Polen unbeliebt, kümmerte sich jedoch um die Entwicklung des Handels und der Städte.
Trotz seiner Zugeständnisse konnte Ludwig schließlich einen Adelsaufstand nicht verhindern. Der großpolnische Adel hatte bereits vor Ludwigs Herrschaftsantritt mehrfach versucht, verschiedene Mitglieder von piastischen Seitenlinien auf den polnischen Thron zu heben, war damit, wenn überhaupt nur in einzelnen Regionen erfolgreich gewesen. Nach Plünderungen durch Litauer 1376, gegen die Ludwig kaum etwas unternommen hatte, wuchs auch in Kleinpolen der Unmut. Im Dezember des Jahres kam es in Krakau zu einem Aufstand, bei dem die ungarische Besatzung erschlagen und die Statthalterin Elisabeth vertrieben wurde. Nun reagierte Ludwig und begann die von Litauern besetzten Gebiete zurückzuerobern, betrieb jedoch gleichzeitig weiter die Herauslöung Rotreußens aus dem polnischen Reichsverbund und seine Eingliederung nach Ungarn. Dadurch brachen auch in Großpolen offene Aufstände aus, in deren Verlauf Ludwig 1382 starb. Er wurde in Székesfehérvár bestattet.
Familie
Ludwig heiratete 1342 Margarete (* 1335; † 1349), die älteste Tochter von Kaiser Karl IV. und Blanca Margarete von Valois.
In zweiter Ehe heiratete er 1353 Elisabeth von Bosnien (* 1340; † 1387), Tochter des Bans von Bosnien Stjepan II. Kotromanić und Elisabeth von Kujawien. Mit ihr hatte er vier Kinder:
- Maria (* 1365; † 1366)
- Katharina (* 1370; † 1377), 1374 verlobt mit Ludwig von Frankreich (* 1372; † 1407), Sohn des französischen Königs Karl V. und Johanna von Bourbon
- Maria (* 1371; † 1395), Königin von Ungarn ∞ 1385 Kaiser Sigismund (* 1368; † 1437)
- Hedwig (* 1373; † 1400), Königin von Polen ∞ 1386 Jogalla (* 1351; † 1434), Großfürst von Litauen
Einzelnachweise
- ↑ Werner Paravicini: Die Preußenreisen des europäischen Adels. Teil 1, Thorbecke, Sigmaringen 1989, ISBN 3-7995-7317-8, S. 147 (Beihefte der Francia, Band 17/1).
- ↑ Vgl. Paul W. Knoll: The rise of the Polish monarchy. Piast Poland in East Central Europe, 1320-1370. University of Chicago Press, 1972. ISBN 0-226-44826-6, S. 197
Quellen
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Władysław II. Jagiełło
Jogaila (weißrussisch Ягайла; * 1348; † 1. Juni 1434 in Gródek) war ab 1377 bis 1401 Großfürst von Litauen und ab 1386, als Władysław II. Jagiełło, König von Polen (bis 1399 gemeinsam mit Jadwiga). Zusammen mit seinem Vetter Vytautas (polnisch Witold, weißrussisch Вітаўт / Witaut), dem neuen litauischen Großfürsten (1401–1430)[1] begründete er die polnisch-litauische Union.
Leben
Sein Vater Algirdas († 1377) hatte als Großfürst mit seinem Bruder Kęstutis (poln. Kiejstut) die Regierung geteilt. Jogaila überwarf sich nach 1379 in einem bewaffneten Konflikt mit seinem Onkel Kęstutis, schloss im Mai 1380 den geheimen Vertrag von Daudisken mit dem langjährigen litauischen Kriegsgegner, dem Deutschen Orden, der ein gegen Kęstutis gerichteter Nichtangriffspakt war, wurde aber 1381 gefangen und abgesetzt. Er kam jedoch wieder frei und konnte 1382 seinerseits seinen Onkel bei einem persönlichen Treffen gefangennehmen. Kęstutis wurde im Gefängnis getötet, während dessen Sohn Vytautas fliehen konnte.
Schließlich einigte sich Jogaila 1384 halbwegs mit Vytautas, so dass er sich um die Hand der Königin Jadwiga von Polen und damit die polnische Krone bewerben konnte. Am 4. März 1386 wurde Jogaila, ab jetzt polnisch Jagiełło genannt, in Krakau zum König gekrönt und war damit seiner Frau rechtlich gleichgestellt. In der Folge musste er allerdings die Macht in Litauen stückweise an Vytautas abgeben (1392–1401), obwohl er und sein Bruder Skirgaila ernsthaft versuchten, diesen zu entmachten. Dabei kam Vytautas zugute, dass insbesondere die orthodoxe weißrussische Bevölkerung die Übernahme des katholischen Glaubens durch Jagiełło im Zuge der Königswahl ablehnte. Nach dem Tod von Hedwig heiratete Władysław noch dreimal: Anna von Cilli, Elisabeth von Pilitza und Sophie Holszańska.
Ungeachtet dieser familiären Rivalität entstand die polnisch-litauische Union, da auch Vytautas ihre Vorteile erkannte und sie im Vertrag von Horodło am Bug im Oktober 1413 akzeptierte. In Zukunft wurden die Großfürsten von Litauen und die Könige von Polen nur mit Zustimmung beider Unionspartner gewählt. Der litauische Adel wurde in den polnischen Adel aufgenommen und schickte seine Söhne zur Ausbildung dorthin. In Litauen begann sich die polnische Kultur zu verbreiten.
Man betrieb eine gemeinsame Außenpolitik, die beachtliche Erfolge erzielte. Sie richtete sich in erster Linie gegen den Deutschen Orden und gipfelte in der Schlacht bei Tannenberg 1410, in der sich Jagiełłos taktisches Geschick mit Vytautas Mut paarte. Der Orden verlor dabei den Nimbus der Unbesiegbarkeit, konnte sich jedoch noch einige Zeit halten. Erst 1422 kam es im Frieden vom Melnosee zu einer dauerhaften Regelung.
In der Folge versuchte besonders der deutsche Kaiser Sigismund die Union zu spalten, woraufhin 1423 und 1429 zwei große Fürstentreffen stattfanden. In letzterem versprach Sigismund Vytautas die Königskrone, was in Polen Widerspruch herausforderte.
Im Jahr 1430 legte Władysław II. Jagiełło im Privileg von Jedlno auch seinen Streit mit demjenigen Teil des polnischen Adels bei, der ihn nach dem Tod Jadwigas (17. Juli 1399) gern losgeworden wäre. Es ging um die Zustimmung des Adels zur Steuerfestsetzung, Ausübung des Münzrechtes und eine Rechtssicherheit des Adels gegenüber dem König. Gegen Anerkennung des Wahlkönigtums und der geforderten Rechtssicherheit von Seiten des Königs wurden seine Söhne als Nachfolger anerkannt. In dem Streit hatte ein Teil des polnischen Adels sogar schon Vytautas die polnische Krone angeboten.
Erwähnenswert ist noch ein neuer Konflikt in Litauen. 1430 setzte Władysław II. Jagiełło dort seinen Bruder Swidrygello als neuen Großfürsten ein. Der kam aber über der Rückgabe von Vytautas persönlichen Lehen in Konflikt mit Jagiełło und wurde in einem bewaffneten Konflikt durch Vytautas Bruder Zygimantas (ermord. 1440) ersetzt, welcher die Union erneuerte.
Nachkommen
- ∞ 1386 Hedwig von Anjou (Jadwiga) (1373–1399)
- Ihr einziges Kind starb ebenso wie Hedwig kurz nach der Geburt.
- ∞ 1402 Anna von Cilli (1386–1416)
- Hedwig von Litauen (1408–1431)
- ∞ 1417 Elisabeth von Pilitza (1372–1420)
- ∞ 1422 Sophie Holszańska (1405–1444)
- Władysław von Warna (1424–1444)
- Kasimir († als Kleinkind)
- Kasimir IV. Jagiełło (1427–1492)
Einzelnachweise
- ↑ unter dem nominellen Supremat von Jogaila
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann II. Kasimir
Johann II. Kasimir (auch Johann II. Kasimir Wasa[1], polnisch Jan II Kazimierz Waza, litauisch Jonas Kazimieras Vaza, lateinisch Ioannes Casimirus; * 21. März 1609 in Krakau; † 16. Dezember 1672 in Nevers) war ab 1648, als König von Polen und Großfürst von Litauen, der gewählte Herrscher des Staates Polen-Litauen, sowie bis 1660 Titularkönig von Schweden. Johann entstammte der schwedischen Wasa-Dynastie und war auch Mitglied im Orden vom Goldenen Vlies.
Königliche Titulatur
- Titulatur auf Latein: „Ioannes Casimirus, Dei Gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russie, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque, nec non Suecorum, Gothorum, Vandalorumque haereditarius rex, etc.“
- Deutsche Übersetzung: „Johann Kasimir, durch Gnaden Gottes König von Polen, Großfürst von Litauen, Rus, Preußen, Masowien, Samogitien, Livland, Smolensk, Sewerien, Czernihów, ebenso Erbkönig der Schweden, Goten und Vandalen.“
Leben
Johann Kasimir trat als zweiter Sohn Sigismunds III. zunächst 1640 in den Jesuitenorden ein und wurde wenig später von Papst Innozenz X. zum Kardinalpriester ernannt. Nach dem Tod seines Halbbruders König Władysław IV. Wasa bestieg er am 20. November 1648 den polnischen Thron. Wenig später heiratete er dessen Witwe, Marie Luise von Nevers-Gonzaga.
Noch vor seinem Amtseintritt kam es 1648 mit Unterstützung der Krimtataren im ukrainischen Teil des Reiches zum Aufstand der Saporoger Kosaken unter ihrem Ataman Bohdan Chmelnyzkyj. In den besetzten Gebieten wurden blutige Massaker an den katholischen Polen und an Juden verübt, wobei die Zahl der Opfer auf ein Viertel Million geschätzt wird. Der Aufstand dauerte bis 1654 an, dem Jahr des Vertrages von Perejaslaw, infolge dessen es zu einem Krieg zwischen Polen und Russland kam.
Als die schwedische Königin Christina I. am 16. Juni 1654 abdankte, machte Johann II. (trotz des Widerspruchs seiner höchsten Würdenträger) als Urenkel Gustav I. Wasas Ansprüche auf den schwedischen Thron geltend. Diese Erbauseinandersetzung diente Karl X. Gustav als Vorwand zum Krieg, der als Schwedische Sintflut in die polnische Geschichte einging. Das damals arme Schweden verfügte ab dem 17. Jahrhundert über die erste Wehrpflicht- und Berufsarmee Europas, die zwar im Gegensatz der zumeist gegnerischen Söldnerarmeen hochmotiviert war, jedoch auch durch die Ausplünderung anderer Länder (u. a. Deutschland im Dreißigjährigen Krieg) unterhalten wurde.
Den Krieg führte Johann II. mit wechselvollem Erfolg. So gab er bereits zu Anfang des Krieges die Schlacht bei Warschau, 1656 gegen Karl X. Gustav und den mit ihm verbündeten Friedrich Wilhelm von Brandenburg für verloren, der für das Herzogtum Preußen formell ein Vasall des polnischen Königs war und ihn durch den Seitenwechsel, also einen Lehensbruch, hinterging. Außerdem kam der ungarische Siebenbürgerfürst Georg II. Rákóczi dem Schwedenkönig zur Hilfe, indem er im Bündnis mit Chmelnyzkyj weite Teile Polens durch seine siebenbürgisch-kosakische Reiterei mit 40.000 Mann verheeren und plündern ließ. Dass es nicht zu einem völligen Zusammenbruch des Königreichs kam, ist nur dem Hetman Stefan Czarniecki und seiner Guerillataktik, sowie einer kurzlebigen Allianz mit dem Krimkhanat unter İslâm III. Giray zu verdanken. Johann II., von einem Teil des Adels im Stich gelassen und verraten (Verträge von Ujście und Kėdainiai), flüchtete 1655 vor den Angreifern nach Schlesien. Der erhoffte militärische Beistand durch die katholischen Habsburger, mit denen er verwandt war, blieb allerdings zu Beginn des Krieges aus.
Nach des Königs Rückkehr aus dem schlesischen Exil, 1656, konnte er in den folgenden Kriegsjahren zwar sein Reich halten, musste jedoch im Vertrag von Wehlau auf die Lehnshoheit über das Herzogtum Preußen verzichten, um Friedrich Wilhelm zu einem (erneuten) Seitenwechsel zu bewegen. Dieser Vertrag sollte sich später als eine der entscheidenden Wegmarken in der Entwicklung Brandenburg-Preußens zu einer europäischen Großmacht erweisen. Der schwedisch-polnische Krieg endete schließlich im Frieden von Oliva am 3. Mai 1660. Der polnische König war darin gezwungen, auf alle seine Ansprüche auf den schwedischen Thron, Livland mit Riga und Estland zu verzichten, während Schweden seinen Status als Großmacht im westlichen Ostseeraum ausbauen und im Baltikum gegen Polen und Russland behaupten konnte.
Im Russisch-Polnischen Krieg 1654–67 konnte Johann II. bis 1660 das Gebiet des Großfürstentums Litauen von russischen Truppen befreien. Vor dem Hintergrund erneuter Kämpfe mit Kosaken und Krimtataren im Süden des Königreichs war er jedoch im Vertrag von Andrussowo gezwungen, auf weite Teile des heutigen Westrusslands mit Smolensk und der Ostukraine mit Kiew bis an den Dnepr 1667 zu verzichten.
Die 20 Jahre dauernde Regierungszeit Johanns II., in der es nur zu Kriegen kam, gilt als der Anfang vom Ende des polnisch-litauischen Staates. Das einst wohlhabende Land wurde regelrecht ausgeplündert (in Stockholm sind bis heute die damals gestohlenen Kulturgüter zu besichtigen) und ausgeblutet: durch die Verwüstungen von sechs Invasionstruppen – Kosaken, Schweden, Moskowiter-Russen, Siebenbürger-Ungarn und Brandenburger – und die daraus folgenden Seuchen und Hungersnöten ging die Bevölkerungszahl von 11–12 Millionen (bis 1648) auf ungefähr 8 Millionen Einwohner zurück (um 1668), es kam zu einer massiven Verarmung aller Bevölkerungsschichten und schließlich zu einem Wirtschaftskollaps. Da der durch Jesuiten erzogene König den Katholizismus massiv förderte, war auch der soziale Frieden im multiethnisch und -religiösen Vielvölkerstaat und die bis dato gelebte religiöse Toleranz bedroht. Die Folge der katholischen Konfessionalisierung war eine Abwanderung großer Teile der protestantischen Bevölkerung, wodurch weiteres wirtschaftliches sowie kulturelles Potential verloren ging. Die Verarmung der Unter- und Mittelschicht (v.a. des kleinen und mittleren Adels) hatte eine Verringerung ihres politischen Bewusstseins und Verantwortung zur Folge und degenerierte dauerhaft die „Adelsdemokratie“. Einzig die größten Adelshäuser, die Magnaten, konnten ihre Macht und Einfluss auf ihre sowie des Königs Kosten ausbauen, was langfristig die Entstehung autarker Oligarchiestrukturen innerhalb des Königreichs begünstigte.
Aufgrund der außenpolitischen Niederlagen und seiner ungeschickten Innenpolitik, verfügte Johann II. Kasimir über so wenig persönliche Autorität, dass er durch das Liberum Veto seiner Gegner keinen seiner Reformvorschläge in Sejm durchsetzen konnte. Nach der Magnatenrebellion 1665–66 unter Fürst Jerzy Sebastian Lubomirski gegen die Beschneidung der Goldenen Freiheit (Privilegien des Adels), gab Johann II. den Kampf gegen seine innenpolitische Gegner endgültig auf und dankte im September 1668 ab. Vier Jahre später starb er als Abt von St. Germain-des-Prés im französischen Exil.
Als Staatsoberhaupt von Polen und Litauen folgte ihm der Magnat Michael Wiśniowiecki nach. Mit dieser Wahl wollte die Masse des Kleinadels weitere Verwicklungen in dynastische Erbkriege mit auswärtigen Mächten ausschließen.
Johann II. Kasimir begleitet eine schwarze Legende. Größenwahnsinnig und arrogant führte er eine Politik, die von einer massiven Selbstüberschätzung und despotischen Tendenzen geprägt war. Bereits zu seinen Lebzeiten galt er als der unfähigste polnische König und wurde als einziger zum Abdanken gezwungen. Seine Initiale "Ioannes Casimirus Rex" deutete man oft als "Initium Calamitatis Regni" – Anfang vom Niedergang des Reiches.
Literatur
- Gottfried Lengnich: Geschichte der Preußischen Lande (t. 7)/ Königlich=Polnischen Antheils, Unter der Regierung Johannis Casimiri. Danzig: gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochweis. Raths und des löbl. Gymnasii Buchdrucker 1734
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Bohdan Chmelnyzkyj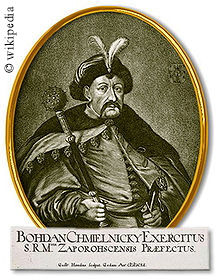
Bohdan Chmelnyzkyj (ukrainisch: Богдан Хмельницький, wiss. Transliteration: Bohdan Chmel'nyc'kyj; russ. Богдан Хмельницкий, wiss. Transliteration: Bogdan Chmel'nickij; polnisch: Bohdan Chmielnicki; * 1595 vermutlich in Schowkwa/ möglicherweise auch in Subotiw; † 6. August 1657 in Tschyhyryn) war ein ukrainischer Kosakenhetman und der Gründer des ersten Kosakenstaates. Er ist bekannt für einen erbitterten Kampf gegen die Herrschaft Polen-Litauens und den Anschluss seines Staates an das Zarentum Russland.
Leben
Chmelnyzkyj war der Sohn eines wahrscheinlich kleinadligen polnischen Unterstarosten und einer Kosakenfrau. Er wurde wahrscheinlich in Schowkwa (poln. Żółkiew) bei Lemberg geboren. Seine Ausbildung erhielt er in einem Jesuitenkolleg in Tschyhyryn. Im Jahr 1620 nahm er unter dem Hetman der Krone Stanisław Żółkiewski am Feldzug gegen die Türken teil und geriet in deren Gefangenschaft. Nach seinem Loskauf machte er Karriere im Kosakenheer; als später die Kosaken von der polnischen Regierung viele Rechte aberkannt bekamen, verhielt er sich dieser gegenüber loyal und führte ein ruhiges Familienleben auf seinem Gut bei Tschyhyryn. Erst ab 1646, nahm er Rechtsstreitigkeiten, die ihn persönlich betrafen und ihm seine Rechtlosigkeit vor Augen führten, zum Anlass, sein Gut und seine Familie zu verlassen und den Kampf gegen Polen aufzunehmen.
Für die ukrainischen Kosaken war er ein Held im Kampf um Kosakenrechte. In diesem Kampf handelte es sich um die juristische Anerkennung der traditionellen Privilegien der Kosaken, darunter Steuerfreiheit und Erhalt der paramilitärischen Strukturen. Des weiteren wurde verlangt, die vom polnischen König direkt besoldete Kosakentruppe auf die bereits zugesicherten 40.000 Mann zu erweitern. 1648 und 1649 besiegte Chmelnyzkyj ein polnisches Heer bei Zboriv (Zborów). 1648 wandte er sich an den russischen Zaren Alexei I. und bat ihn darum, den ukrainischen Kosakenstaat unter russische Herrschaft zu stellen. 1654 musste dies der Semski Sobor genehmigen. Am 8. Januar 1654 kam es in Perejaslaw zur Unterzeichnung eines Vertrages über die territoriale Angliederung des Kosakenstaates an das Zarenreich.
Bohdan Chmelnyzkyj heiratete später Hanna Somkiwna, Tochter eines reichen Kosaken aus Perejaslawl. Das Paar zog nach Subotiw, einem Dorf sieben Kilometer nordöstlich von Tschyhyryn.
Aus der Ehe gingen zuerst drei Töchter und später zwei Söhne hervor:
- Stepandia,
- Olena,
- Kateryna,
- Tymofiej Chmelnyzkyj (* 1632, † 5./15. September 1653 in Suceava),
- Yuri Chmelnyzkyj (* 1641 † 1685)
Seine beiden Söhne Tymofiej und Yuri setzten mit ihm die Kämpfe gegen Polen-Litauen, die Krimtataren und die Moskowiter fort.
Chmelnyzkyj und der Aufstand unter seiner Führung bleiben wegen judenfeindlicher Exzesse in Erinnerung. Schätzungen gehen von einer jüdischen Population von rund 50.000 auf dem Gebiet der damaligen Ukraine aus, von denen während der jahrelangen Kämpfe bei Pogromen über 10.000 ums Leben gekommen sein sollen.[1]
Nachwirkung
In der Regierungszeit des Ukrainers Nikita Chruschtschow wurde die Krim 1954 unter Bruch sowjetischer Gesetze an die Ukraine übergeben. Der Anlass dazu war das 300-jährige Jubiläum der Rada von Perejaslaw von 1654 und der Vereinigung der Ukraine mit Russland. Die Feier war in den Medien sehr präsent. Aus demselben Grund wurde die ukrainische Stadt Proskuriw 1954 in Chmelnyzkyj umbenannt. Ihm zu Ehren wurde am 10. Oktober 1943 der Bogdan-Chmelnizki-Orden geschaffen.
In Russland und der Sowjetunion hatte Chmelnyzkyj Hochkonjunktur, davon zeugen z. B. die Feierlichkeiten 1954 und der während des Krieges geschaffene Orden. Gleichzeitig zerstörte man die alten Überreste der kosakischen Kultur, u. a. die Burganlage auf der Insel Chortyca (auch unter Stalin gegründete Institute für primitive Kultur).
Der Roman Mit Feuer und Schwert (poln. Ogniem i mieczem) des polnischen Literatur-Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz handelt vom Kosakenaufstand unter Chmelnyzkyj. Die Verfilmung des polnischen Regisseurs Jerzy Hoffman aus dem Jahre 1999 ist in Polen der erfolgreichste Kinofilm der Nachwendezeit (über 7 Millionen Zuschauer).
Literatur
↑ Stampfer, Shaul: What actually happened to the Jews of Ukraine in 1648?; in: Jewish History 17 (2003); pp. 207–227.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Alexei I. (Russland)
Alexei Michailowitsch, "der Sanftmütigste" (russ. Алексей Михайлович; * 19. März 1629 in Moskau; † 29. Januar 1676 in Moskau) war von 1645 bis 1676 Zar und Großfürst von Russland.
Leben
Festigung der Dynastie
Der zweite Zar aus der wachsenden Dynastie Romanow bestieg als Jugendlicher den Thron, er war vier Monate vor dem Tod seines Vaters Michael I. erst sechzehn Jahre alt. Da sein Vater ihn schon am Neujahrstag 1643 der Öffentlichkeit als Nachfolger präsentierte und in seiner Sterbenacht noch die Herrschaft übergab, war die Nachfolge gesichert und es folgte nun wieder ein Sohn dem Vater auf den Zarenthron.
Regentschaft
In den ersten Jahren seiner Herrschaft lag die Regierungsgewalt faktisch in den Händen seines Erziehers und Schwagers Boris Morosow.
Mit der Einrichtung des Prikas für geheime Staatsangelegenheiten schuf er ein wichtiges Kontrollorgan, das ihn in die Lage versetzte, die Regierungsgewalt weitgehend selbstständig auszuüben. Seine Regierung ist durch verstärkte Unterdrückung der Bauern und Erhöhung der Steuerlasten gekennzeichnet, was ab 1648 zu Stadtaufständen führte (Moskau, Tomsk, Pskow und Nowgorod). Dadurch sah sich Alexei gezwungen, die Landesversammlung (Semski Sobor) einzuberufen und 1649 ein neues Reichsgesetzbuch, das Sobornoje Uloschenije, zu erlassen, das die Leibeigenschaft zementierte.
Alexeis wichtigster Berater wurde 1651 der Patriarch Nikon. Durch geschicktes Taktieren konnte Alexei den 1648 begonnenen Chmelnyzkyj-Aufstand für sich ausnutzen und übernahm 1654 mit dem Vertrag von Perejaslaw die Schutzherrschaft über das ukrainische Hetmanat. Im daraufhin beginnenden Russisch-Polnischen Krieg 1654-1667 konnten russische Truppen 1654 Smolensk erobern. Nach weiteren russischen Erfolgen im folgenden Jahr griff Schweden in den Krieg ein und Russland konnte das gesamte Großfürstentum Litauen an sich bringen. Ende 1655 schloss Russland mit Polen einen Waffenstillstand und wandte sich gegen Schweden (siehe Russisch-Schwedischer Krieg 1656-1658). Die Belagerung Rigas blieb indessen erfolglos und nachdem der neue Hetman Iwan Wyhowski sich 1658 mit dem Vertrag von Hadjatsch auf die Seite Polen-Litauens gestellt hatte einigte sich Russland mit Schweden auf den Waffenstillstand von Valiesar (1658). Der nunmehr wiederaufgenommene Krieg gegen Polen verlief wechselhaft (Litauen ging wieder verloren), letztlich konnte sich Russland aber 1667 im Friede von Andrussowo Smolensk, Kiew und die Ostukraine sichern. In östlicher Richtung dehnte Alexei sein Reich mit der Eroberung Ostsibierens bis an die Grenze Chinas aus. Das internationale Ansehen in seiner Regierungszeit stieg beträchtlich.
1658 überwarf sich Alexei mit Nikon über der Frage der von diesem eingeleiteten kirchlichen Reformen, der Sitz des Patriarchen blieb danach für acht Jahre unbesetzt. Der Konflikt führte 1666 zur Spaltung der russisch-orthodoxen Kirche.
Alexei gelang es auch, die Rechte der Landesversammlung nach und nach wieder auszuschalten. Durchgreifend waren seine Reformen im Militär und in der Wirtschafts- und Handelspolitik. Seine wichtigsten Berater in späteren Jahren waren Afanasi Lawrentjewitsch Ordin-Naschtschokin und Artamon Sergejewitsch Matwejew.
Währenddessen hatte sich 1662 die Moskauer Bevölkerung erneut zum Aufstand erhoben. Der Kampf der unterdrückten Bauern entlud sich schließlich im Bauernkrieg unter Stepan Rasin von 1670/71, der allerdings rasch niedergeworfen wurde. Die über ihn verhängte Todesstrafe wurde noch am Tage der Urteilsverkündung vollstreckt, der Mythos aber ließ „Stenka“ Rasin zum Helden eines sehr bekannten Volksliedes werden.
Nachkommen
1647 vermählte er sich als 18-Jähriger in erster Ehe mit Maria Miloslawskaja (* 1626 † 1669) , die ihm zahlreiche Kinder schenkte. Schwer traf den Zaren 1670 der Tod des fast 16-jährigen Zarewitsch Alexei, zumal der zweite lebende Sohn Fjedor schwächlich und der dritte Sohn Iwan gar geistesschwach war. Während ihrer einundzwanzigjährigen Ehe mit Alexei hatte Maria Miloslawskaja dreizehn Kinder, fünf Söhne und acht Töchter, geboren, bevor sie kurz nach der Geburt des vierzehnten Kindes starb.
- Dimitri (* 22. Oktober 1648; † 6. Oktober 1649), Zarewitsch von Russland,
- Jewdokija (18. Februar 1650; † 10. Mai 1712), Großfürstin von Russland,
- Marfa (* 26. August 1652; † Juli 1707), Großfürstin von Russland,
- Alexei (* 5. Februar 1654; † 17. Januar 1670), Zarewitsch von Russland,
- Anna (* 23. Januar 1655; † 9. Mai 1659), Großfürstin von Russland,
- Jewdokija (* 19. Februar 1656; † 10. Mai 1718), Großfürstin von Russland,
- Sofia (* 5. September 1657; † 3. Juli 1704), Großfürstin und Regentin von Russland,
- Katharina (* 26. November 1658; † 1. Mai 1718), Großfürstin von Russland,
- Maria (* 18. Januar 1660; † 20. März 1723), Großfürstin von Russland,
- Fjodor III. (* 30. Mai 1661; † 27. April 1682), Zar von Russland,
- Feodossija (* 28. Mai 1662; † Dezember 1713), Großfürstin von Russland,
- Simeon (* April 1665; † 19. Juni 1669), Großfürst von Russland,
- Iwan V. (* 27. August 1666; † 20. Januar 1696), Zar von Russland und
- Jewdokija (*/† 18. Februar 1669), Großfürstin von Russland.
1671 heiratete er, in der Hoffnung einen gesunden Zarewitsch zu zeugen, in zweiter Ehe Natalja Naryschkina (1651–1694), die ihm drei Kinder gebar:
- Peter I. (* 30. Mai 1672; † 28. Januar 1725), Zar von Russland,
- Natalja (* 25. August 1673; † 18. Juni 1716), Großfürstin von Russland, und
- Feodora (* 4. April 1674; † November 1675), Großfürstin von Russland.
Literatur
- Vallotton, Henry: Peter der Große.Eugen Diederichs-Verlag, München 1978, ISBN 3-424-01315-3.
- Massie, Robert K.: Peter der Große. Sein Leben und seine Zeit. Fischer, Frankfurt/M. 1992, ISBN 3-596-25632-1
- Hans-Joachim Torke (Hrsg.), Die russischen Zaren 1547 - 1917, Verlag C.H. Beck, München, 1999, ISBN 3-406-42105-9
- Fedorowski, Wladimir: Die Zarinnen - Rußlands mächtige Frauen, Serie Piper, München 2002, ISBN 3-492-23700-2
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Karl X. Gustav
Karl X. Gustav (* 8. November 1622 in Nyköping; † 13. Februar 1660 in Göteborg) war König von Schweden nach der Abdankung seiner Cousine Christina von 1654 bis 1660 und von 1655 bis 1660 Herzog vom Herzogtum Bremen und Verden.
Im Dreißigjährigen Krieg (1618–48) errang er den Protestanten in Nordeuropa militärische Erfolge und danach im Konflikt gegen Dänemark.
Leben
Karl X. Gustav war der zweite Sohn von Johann Kasimir von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg und dessen Gemahlin Katharina Wasa, Tochter des Königs Karl IX. von Schweden.
Karl wurde an der dänischen Militärakademie Sorö ausgebildet und wurde ein herausragender Soldat, der als schwedischer General im Dreißigjährigen Krieg in Deutschland kämpfte und 1647 zum Generalissimus der schwedischen Truppen in Deutschland ernannt wurde. Als seine Cousine, Königin Christina, ihre Absicht signalisierte, ihn zu heiraten, erreichte sie 1649 seine Ernennung zum Thronfolger und Erbprinzen von Schweden durch den Reichstag. 1650 erklärte Christina kategorisch, niemals heiraten zu wollen (wohl auch weil Karl im März 1649 ein unehelicher Sohn geboren worden war), und am 16. Juni 1654 dankte sie ab. Schon am folgenden Tage wurde Karl ihr Nachfolger.
Am 24. Oktober 1654 heiratete er Hedwig Eleonora von Schleswig-Holstein-Gottorf, die ihm am 4. Dezember 1655 den Sohn Karl XI. gebar.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg versuchte er als erstes, die Staatsfinanzen zu sanieren. Im Zweiten Nordischen Krieg gelang es ihm, die polnischen Thronansprüche zurückzuschlagen und mit einem Bündnis zwischen Schweden und Russland das derzeit im Chaos und Kosakenaufständen versinkende Polen-Litauen sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und territorial zu schwächen. Der polnische König Johann II. Kasimir Wasa war Sohn des schwedischen Königs Sigismund III. Und obwohl die polnische Armee um 1658 die Schweden endlich besiegen und mit großer Mühe vertreiben konnte, konnte Karl XI., da Karl X. Gustav bereits vor Vertragsunterzeichnung verstorben war, nach dem Zweiten Nordischen Krieg im Vertrag von Oliva den Besitz Livlands mit Riga endgültig für Schweden sichern. Vom Kurfürsten von Brandenburg ließ er sich die Oberherrschaft über Preußen anerkennen (Vertrag von Königsberg 1656). Im Krieg gegen Dänemark 1657 eroberte er große Teile des Nachbarstaates. Sein Angriff über das Eis des Kleinen und Großen Belt gilt als eine der wagemutigsten Taten der Militärgeschichte. Schweden erreichte unter seiner Herrschaft seine größte territoriale Ausdehnung. Am 13. Februar 1660 starb König Karl X. Gustav während des Ständereichstag in Göteborg.
Er war der Vater des unehelichen Sohnes Gustav (* 13. März 1649; † 11. Januar 1708), Graf von Börring.
Literatur
- Marlis Zeus: Ein Pfälzer in Stockholm: Johann Casimir von Pfalz-Zweibrücken, Schwager und Vertrauter Gustavs II. Adolf im Dreißigjährigen Krieg, 2. Auflage, Helmesverlag Karlsruhe, 2004, ISBN 3-9808133-7-1
- Michael Busch: Absolutismus und Heeresreform: Schwedens Militär am Ende des 17. Jahrhunderts; Europa in der Geschichte, Band 4; Winkler, Bochum, 2000. Ktn. ISBN 978-3-930083-58-9, Ln. ISBN 978-3-930083-62-6
- Gerstenberg: Karl X. Gustav. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 15. Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 360–364.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Georg II. Rákóczi
Georg II. Rákóczi (ungarisch II. Rákóczi György; * 30. Januar 1621 in Sárospatak; † 7. Juni 1660 in Nagyvárad) war ab 1648 mit Unterbrechungen Fürst von Siebenbürgen aus dem ungarisch-kalvinistischen Adelsgeschlecht der Rákóczi.
Leben
Er war der älteste Sohn von Fürst Georg I. Rákóczi aus der Ehe mit Zsuzsanna Lórántffy und wurde am 19. Februar 1642, noch während der Regierungszeit seines Vaters, zum (Mit-)Fürsten von Siebenbürgen gewählt. Am 3. Februar 1643 heiratete er Zsófia Báthory, die auf Druck ihrer zukünftigen Schwiegermutter vom Katholizismus zum Kalvinismus konvertierte.
Nach dem Tod seines Vaters, 1648, war er Alleinherrscher und verfolgte dessen Pläne, die Krone Polens für seine Dynastie zu gewinnen. Hierfür schloss er jeweils Bündnisse mit dem Ataman der Saporogerkosaken, Bogdan Chmielnicki und den Fürsten von Moldawien und der Walachei, Vasile Lupu und Matei Basarab. Doch erst im Januar 1657 führte er als Bündnispartner des schwedischen Königs Karl X. Gustav, der 1655 in Polen militärisch einfiel und den Zweiten Nordischen Krieg auslöste, ein 40.000 Mann starkes, siebenbürgisch-kosakisches Heer gegen den polnischen König Johann II. Kasimir an und verwüstete große Teile Polens ohne dabei seine politischen Ziele zu erreichen. Ganz im Gegenteil, bedingt durch die Grausamkeit seines multinationalen Heeres, das er nie vollständig zu kontrollieren vermochte, wuchs bei den Polen der Widerstand gegen die Aggressoren und der Hass auf seine Person im Besonderen.
In Krakau schloss er sich den Schweden an, nahm Brest am 2. Juli ein, dem Warschau am 16. Juli folgte, aber als sich seine Verbündeten aus Polen zurückzogen, brachen auch seine Pläne wie ein Kartenhaus zusammen. Die siebenbürgisch-kosakische Vorhut mit dem Tross wurde am 20. Juni 1657 durch die polnische Armee in der Schlacht bei Czarny Ostrów in Podolien eingekreist und geschlagen. Seines Trosses verlustig und durch die Flucht seiner kosakischen Verbände im Stich gelassen, sah er sich schließlich zur Kapitulation gezwungen. In den darauf folgenden Friedensgesprächen mit den Polen vom 21. bis 23. Juni 1657, löste er die Allianz mit Schweden, zudem verpflichtete er sich Kriegskontribution an Polen und die polnischen Heerführer zu leisten, sowie die besetzten polnischen Städte Krakau und Brest zu verlassen. Im Anschluss ließen ihn die Polen mit dem Rest seiner Armee in sein Fürstentum heimkehren. Auf dem Rückweg geriet jedoch ein Großteil seiner Streitkräfte in eine Razzia der Krimtataren, die das siebenbürgische Heer zersprengten und anschließend auf die Krim verschleppten (bis zu 11.000 Mann). Die Reste mit dem Anführer kehrten wenig ruhmreich nach Siebenbürgen zurück.
Am 3. November 1657 setzten ihn die siebenbürgischen Stände auf Druck der Hohen Pforte für sein eigenmächtiges Handeln gegen Polen ab, denn sein Feldzug fand ohne Abstimmung mit dem Suzerän des Fürstentums, dem Osmanischen Reich statt. Er wurde durch Franz Rhédey ersetzt, der sich bis zum 9. Januar 1658 auf dem Fürstenthron hielt. Georg versuchte die Macht im Fürstentum zwischen 1658 und 1660 erneut zu behaupten, musste sich aber gegen den neuen Kandidaten des osmanischen Großwesirs Mehmed Köprülü, Ákos Barcsay auseinandersetzen. Es kam zum Bürgerkrieg. Durch kluges Taktieren gewann er die Krone Siebenbürgens wieder zurück, doch überspannte er damit den Bogen endgültig. Die Osmanen beließen es nicht mehr bei Drohungen. Eine osmanische Armee griff das autonome Fürstentum an und verwüstete systematisch das Land. In den folgenden Kämpfen verstarb Georg II. Rákóczi in Nagyvárad an den Wunden, die er sich während der Schlacht von Gyalu am 22. Mai 1660 zugezogen hatte.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Jagiellonen
Die Jagiellonen waren eine im Mannesstamm aus Litauen stammende Nebenlinie des Hauses Gediminas und eine europäische Dynastie, die von 1386 bis 1572 die polnischen Könige und die Großfürsten von Litauen stellte. Auch waren sie ab dem 15. Jahrhundert ungarische, kroatische und böhmische Könige.
Als Gründer dieser Dynastie gilt der litauische Großfürst Jogaila (polnisch: Jagiełło), der als Władysław II. Jagiełło im Jahr 1386 durch Heirat mit der polnischen Königin Hedwig von Anjou den polnischen Thron zu Krakau bestieg.
Jogaila war viermal verheiratet, zuletzt seit 1422 mit Sofia aus dem litauisch-ruthenischen Fürstenhaus Holszański. Sie gebar ihm zwei Söhne, Władysław III. und Kasimir IV.. Den polnischen Thron erbte Władysław, der nach seiner Wahl zum ungarischen König 1444 bei der Rettung von Konstantinopel in der Türkenschlacht bei Varna fiel. Kasimir (IV.), seit 1440 Großfürst von Litauen, wurde 1447 auf den polnischen Thron berufen. Seiner Ehe mit Elisabeth von Habsburg, Tochter des deutschen Königs Albrecht II., entstammten dreizehn Kinder. Er knüpfte mit vielen europäischen Dynastien Heiratsverbindungen.
Auch in Ungarn, Kroatien und Böhmen konnten sich jagiellonische Prinzen als Könige etablieren, zuerst in Konkurrenz, dann (nach dem Zwischenspiel Matthias Corvinus) in Zusammenarbeit mit den Habsburgern. Vladislav II. von Böhmen, Ungarn und Kroatien herrschte in drei Ländern, ebenso sein Sohn Ludwig II.. Nach dessen unglücklichem Tod 1526 in der Schlacht bei Mohács wurde er vom Habsburger Ferdinand I. und vom Magnaten Johann Zápolya (Schwager Sigismunds I. und Vladislavs II., sowie Onkel und Regent Ludwigs II.) beerbt. Zapolya heiratete 1539 zudem Sigismunds Tochter Isabella und vermachte beider Sohn die ungarische Krone mit dem Fürstentum Siebenbürgen.
Mit Sigismund II. August, dem König von Polen und Großfürst von Litauen, starb das Geschlecht der Jagiellonen im Mannesstamm aus, worauf in Polen und Litauen das Erbkönigtum durch ein Wahlkönigtum abgelöst wurde. Beide Länder verschmolzen zur Rzeczpospolita, einer Adelsrepublik unter der „Präsidentschaft“ eines Wahlkönigs an der Staatsspitze.
Die Jagiellonen beherrschten dank ihrer vielfältigen Verbindungen mit den Adelsfamilien Europas um 1500 das Königreich Polen, das Großfürstentum Litauen, das Königreich Böhmen, das Königreich Ungarn und das Königreich Kroatien. Sie strebten nach der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts mit dem römisch-deutschen Kaisertum, dem Osmanischen Reich und der Festigung des Besitzstandes an der Ostflanke auf dem Gebiet der ehemaligen Kiewer Rus gegen das Großfürstentum Moskau. Deshalb überließ 1515 Sigismund I. im Wiener Vertrag die Kronen Ungarns, Kroatiens und Böhmens den Nachkommen aus der Eheverbindung Ludwigs II. mit dem Haus Habsburg. In der Ostpolitik konnten die Jagiellonen das Kräftegleichgewicht angesichts der wachsenden Macht des Großfürstentums Moskau bewahren. Dieser Konflikt, in den sich auch das Königreich Polen in Folge der Moskowitisch-Litauischen Kriege und der Lubliner Union von 1569 hineingezogen sah, wurde erst nach langdauernden Kriegen unter der Herrschaft König Stephan Báthorys gelöst. Die Nachkommen Jagiełłos, die den größten Staat im Mitteleuropa während des 14., 15. und 16. Jahrhunderts schufen, legten auch den Grund der jagiellonischen Idee, die noch im 20. Jahrhundert in der Vorstellung von 'Polen von Meer zu Meer', das heißt von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, weiterlebte.
20. Jahrhundert
Als „Jagiellonen“ bezeichneten sich auch die Anhänger des polnischen Politikers Józef Piłsudski, die nach der Wiederherstellung Polens 1918 unter Rückgriff auf die Geschichte im Osten den Anschluss Litauens sowie weiterer vor 1772 an Russland verlorener Gebiete anstrebten. Dieser Richtung der polnischen Zwischenkriegszeit standen die Anhänger Roman Dmowskis entgegen, die Gebietsansprüche im Westen unter Rückgriff auf die frühere polnische Dynastie der Piasten begründeten.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Władysław III. (Polen und Ungarn)
Władysław von Warna (auch Wladislaus von Warna, Wladislaus III. von Polen und Ungarn; polnisch Władysław III. Warneńczyk, ungarisch I. Ulászló, kroatisch Vladislav I., litauisch Vladislovas III Varnietis, lateinisch Ladislaus; * 31. Oktober 1424 in Krakau; † 10. November 1444 bei Warna, Osmanisches Reich, heute Bulgarien) war ab 1434, als Władysław III., König von Polen und ab 1440, als Ulászló I./Vladislav I., König von Ungarn und Kroatien. Er war der älteste Sohn Władysław II. Jagiełłos und der ruthenischen Prinzessin Sophie Holszańska.
Leben
Nach dem Tod seines Vaters wurde er im Alter von 10 Jahren zum König von Polen gekrönt, wobei er unter der Vormundschaft adeliger Herren und des Kardinals Zbigniew Oleśnicki blieb. Erzogen wurde er von Gregor von Sanok. Während seiner Herrschaft bis zur Volljährigkeit war Kardinal Oleśnicki der tatsächliche Regent.
Das vom Osmanischen Reich bedrohte Königreich Ungarn bot König Władysław den ungarischen Thron an, in der Hoffnung, dass die politische Bindung an die Jagiellonen, Ungarn in dieser Situation absichern könne. Der junge, hitzige Władysław ließ sich vom päpstlichen Legaten überreden und führte eine nicht gut vorbereitete Armee gegen die osmanische Armee an.
Zu einer entscheidenden Schlacht kam es am 10. November 1444 bei Warna im heutigen Bulgarien. Die Schlacht bei Warna endete mit einer vernichtenden Niederlage der von Władysław angeführten antitürkischen Koalition. Er selbst fiel auf dem Schlachtfeld.
Der Überlieferung nach wurde sein Leichnam nie gefunden. Das Grabmal im Krakauer Wawel ist leer.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Kasimir IV. Jagiełło
Kasimir der Jagiellone (als Herzog Kasimir IV., als Großfürst von Litauen Kasimir I., als König von Polen Kasimir II., genannt Jagellonicus, litauisch Kazimieras Jogailaitis, polnisch Kazimierz IV Jagiellończyk?/i; * 30. November 1427 in Krakau, Polen; † 7. Juni 1492 in Grodno, damals Großfürstentum Litauen, heute Weißrussland) war ab 1440 Großfürst von Litauen und ab 1447 bis zu seinem Tode König von Polen. Als Sohn Jogailas stammte er aus dem Adelsgeschlecht der Jagiellonen.
Leben
Kasimir war der Sohn des litauischen Großfürsten und polnischen Königs Jogaila, auf polnisch Władysław II. Jagiełło, und war der jüngere Bruder Władysławs von Warna. Nach dessen Tod im letzten Kreuzzug 1444 und einem dreijährigen Interregnum folgte er seinem Bruder auf den polnischen Thron. Da Kasimir bereits Großfürst von Litauen war, wurden mit diesem Akt beide Staaten in einer Personalunion vereinigt. Während seiner 45-jährigen Herrschaft erreichte das Land den Status einer Großmacht. Auch wirtschaftlich und kulturell folgt eine Blütezeit, die in Polen das "Goldene Zeitalter" genannt wird.
Am 10. Februar 1454 vermählte sich Kasimir mit Elisabeth von Habsburg, der Tochter König Albrechts II. und Enkeltochter Kaiser Sigismunds. Diese Heirat ermöglichte Ansprüche der Jagiellonen auf Kronen von Ungarn und Böhmen und verstärkte die Verbindungen zwischen dem Haus Habsburg und den Jagiellonen. Elisabeth wurde später als die Mutter der Könige bekannt.
Im Rahmen der Hochzeitsfeiern haben Vertreter des Preußischen Bundes um Hilfe gegen den Deutschen Orden geworben. Der König versprach Hilfe, und die Preußen rebellierten. Polnische Feldtruppen erlitten in der Schlacht von Konitz eine Niederlage und griffen danach kaum aktiv in den Dreizehnjährigen Krieg 1453–1466 zwischen dem Preußischen Bund und dem Deutschen Orden ein. Der Krieg endete mit dem Zweiten Frieden von Thorn zugunsten des Bundes und somit auch des Königs. Der Thorner Friedensvertrag wurde zwar weder vom römisch-deutschen Kaiser noch vom Papst anerkannt, war aber wirksam. Der Orden musste den westlichen Teil seines Herrschaftsgebietes an die polnische Krone abtreten (Preußen königlichen Anteils) und sich mit dem ihm verbleibenden östlichen Teil als Vasall der polnischen Krone unterordnen.
Im Jahr 1480 schloss Kasimir ein Bündnis mit Akhmat Khan, dem Führer der Goldenen Horde, gegen das Großfürstentum Moskau unter Iwan III. Da es aber im gleichen Zeitraum zum Preußischen Pfaffenkrieg kam, konnte Kasimir seine Verpflichtungen gegenüber Akhmat Khan nicht erfüllen. Dies trug maßgeblich zum Rückzug beider Parteien im Großen Stehen an der Ugra bei.
Kasimir und Elisabeth hatten viele Kinder. Eine Tochter, Hedwig, wurde mit Georg dem Reichen von Bayern-Landshut verheiratet. Delegaten wurden nach Krakau geschickt, um die Heirat auszuhandeln. Die Landshuter Hochzeit wurde im Jahre 1475 in Bayern mit viel Pomp gefeiert. Ein anderer Sohn, der wie sein Vater Kasimir hieß, war ausersehen, die Tochter des Kaisers Friedrich III. zu heiraten. Er wählte jedoch ein geistliches Leben und wurde später als St. Kasimir kanonisiert. Ein weiterer Sohn war Sigismund I., Großfürst von Litauen und König von Polen, mit dem das Goldene Zeitalter Polens einen Höhepunkt erreichte.
Nachkommen [1]
- • Wladyslaw (1456–1516), König von Böhmen und Ungarn
- • Hedwig (1457–1505), verheiratet mit Georg dem Reichen, Herzog von Bayern-Landshut
- • Kasimir (1458–1484), Heiliger und Schutzpatron von Polen und Litauen
- • Johann I. (1459–1501), König von Polen
- • Alexander (1461–1506), Großfürst von Litauen und König von Polen
- • Sofia (1464–1512), verheiratet mit Markgraf Friedrich V. von Brandenburg-Ansbach, Mutter von Herzog Albrecht von Preußen
- • Elisabeth I. (1465–1466)
- • Sigismund (1467–1548), Großfürst von Litauen und König von Polen
- • Friedrich (1468–1503), Bischof von Kraków, Erzbischof von Gniezno, Kardinal-Presbyter
- • Elisabeth II. (1472–nach 1480)
- • Anna (1476–1503), verheiratet mit Herzog Bogislaw X. von Pommern
- • Barbara (1478–1534), verheiratet mit Herzog Georg dem Bärtigen von Sachsen
- • Elisabeth III. (1483–1517), verheiratet mit Friedrich II. von Liegnitz und Brieg
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann I. (Polen)
Johann I. Albrecht (polnisch Jan I Olbracht, litauisch Jonas Albrechtas; * 27. Dezember 1459 in Krakau; † 17. Juni 1501 in Thorn) war ab 1492 bis zu seinem Tod König von Polen. Er entstammte der Dynastie der Jagiellonen.
Der zweite der Söhne von Kasimir des Jagiellonen, bestieg den Thron im Jahre 1492 nach dem Tod seines Vaters, während sein jüngerer Bruder Alexander über das Großfürstentum Litauen herrschte. Er führte Reformen durch, die den Adel in seiner Position stärkte. Im Statut von 1496 wurde festgelegt, dass der Zutritt zur höheren kirchlichen Ämtern nur den Adligen vorbehalten war, dass der Erwerb von Landgütern den Bürgerlichen untersagt war und schränkte die Freiheit der Bauern ein. In der Außenpolitik konzentrierte er sich auf die türkischen Angelegenheiten und versuchte die polnische Situation zu verbessern, indem er die Donaufürstentümer kontrollierte.
Die südlichen Teile Polens und Litauens wurden durch Razzien der Krimtataren verwüstet, die von den Osmanen dazu angeregt wurden, die die Festungen Kilija und Białogród am Schwarzen Meer 1484 eroberten. König Jan Olbracht unternahm 1497 einen Feldzug gegen die osmanische Herrschaft in diesen beiden Städten, hatte allerdings keinen Erfolg, da sich sein nomineller Vasall, Ştefan cel Mare, gegen ihn wandte.
Während seiner Herrschaft legte sich seit dem Jahre 1493 ein Versammlungsbrauch des Zweikammerreichstages fest, der aus Abgeordneten und Senat bestand.
1491 übertrug ihm sein Bruder, der böhmische König Vladislav II., die Pfandherrschaft über das schlesische Herzogtum Glogau, die er bis 1496 behielt.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
Alexander (Polen)
Alexander der Jagiellone (polnisch Aleksander Jagiellończyk, litauisch Aleksandras Jogailaitis; * 5. August 1461 in Krakau; † 19. August 1506 in Wilna) war ab 1492 Großfürst von Litauen und ab 1501 König von Polen aus der Dynastie der Jagiellonen.
Der vierte Sohn von Kasimir IV. wurde nach dessen Tod zum Großfürsten von Litauen gewählt. Nach dem Tod seines Bruders Jan I. Olbracht wurde er 1501 polnischer König. Er war seit 1495 mit Helena von Moskau, der Tochter des russischen Großfürsten, Iwan III., verheiratet. Trotzdem kam es mehrmals zu militärischen Konflikten mit dem Großfürstentum Moskau, in Folge derer Litauen 1503 beträchtliche Territorien an Iwan abtreten musste.
Seine Herrschaft begann er mit einem Sonderrecht, in dem er die Entscheidungsmacht ausschließlich in die Hände des Senats legte, in dem der Monarch den Vorsitz hatte.
Im Jahre 1505 wurde in einer Senatssitzung zu Radom der Staatsverfassung das Recht Nihil Novi hinzugefügt. Das bedeutete eine Einschränkung der Herrschaftsgewalt des Königs, der fortan nur noch mit Zustimmung des Sejms Entscheidungen treffen konnte. Polen wurde somit bereits in der Zeit der Renaissance de facto zu einer konstitutionellen Monarchie und es bildete sich ein politisches System, das man heute als Adelsrepublik bezeichnet.
Alexander starb im Alter von 45 Jahren in Wilna und wurde in der Kathedrale Sankt Stanislaus beigesetzt.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Sigismund I. (Polen)
Sigismund der Alte (poln. Zygmunt I Stary, lit. Žygimantas Senasis; * 1. Januar 1467 in Kozienice, Polen; † 1. April 1548 in Krakau, Polen), war ab 1506 als Sigismund I. König von Polen und als Sigismund II. Großfürst von Litauen, aus dem Adelsgeschlecht der Jagiellonen.
Leben
Er war bereits ab 1499 Herzog von Glogau im Heiligen Römischen Reich, als er im Jahre 1506 König von Polen und Großfürst von Litauen wurde.
Sigismund I. war der Sohn von Kasimir IV. und der Elisabeth von Habsburg. Er folgte seinen Brüdern Johann Albrecht und Alexander auf den polnischen Thron. Sein ältester Bruder Vladislav herrschte als König von Böhmen und Ungarn.
Seine Mutter Elisabeth war eine Enkelin des römisch-deutschen Kaisers Sigismund von Luxemburg.
Unter der Herrschaft von Sigismund I. erreicht Polen seine größte Machtfülle. Allerdings waren die innenpolitischen Machtbefugnisse des Königs stark eingeschränkt, seit auf dem Reichstag von Radom die Rechte der Szlachta gestärkt worden waren („Nihil Novi“).
Um die Bedrohung der östlichen Grenzen durch das Großfürstentum Moskau und der südlichen Grenzen durch das Osmanische Reich und dessen Vasallen, das Khanat der Krim, abzuwehren, schloss Sigismund zusammen mit seinem Bruder Vladislav auf dem Wiener Fürstentag 1515 ein Freundschaftsbündnis mit dem römisch-deutschen Kaiser Maximilian I.
Nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Orden erkannte der Hochmeister, sein Neffe Albrecht von Brandenburg-Ansbach, 1525 die Lehnshoheit der polnischen Krone an. Albrecht wurde der erste Herzog von Preußen.
Ein großer Helfer in Sigismunds Kampf gegen die Tataren war der Schlesier Bernhard von Prittwitz, auch genannt „Terror Tartarorum“, später Starost von Bar. Weil Prittwitz für seinen überaus erfolgreichen Einsatz das Amt des Starosts und große Ländereien erhielt, sagte man Sigismunds Ehefrau Königin Bona ein Liebesverhältnis mit Prittwitz' Vater nach.
Sein Sohn Sigismund August wurde 1529 per Vivente Rege, noch zu Lebzeiten des Vaters, vom Sejm zum Großfürsten von Litauen und König von Polen gewählt, daher rührt der Beiname „Der Alte“ für Sigismund I.
Durch seine zweite Frau verbreiteten sich in Polen die Ideen der Renaissance. Wissenschaft und Kultur blühten auf. Die Königin Bona ist bis heute unvergessen geblieben, allerdings auch, weil sie eine erbitterte Gegnerin der Reformation war (Quelle: Hans v. Gizycki 1913, Chronik der Familie Gizycki des Wappens Gozdawa).
Nach dem Tode von Sigismund I. wurde sein Sohn Sigismund August, der schon 1544 selbständig Amtsgeschäfte übernahm, der letzte erbliche König von Polen und Großfürst von Litauen aus dem Geschlecht der Jagiellonen.
Sigismund war auch Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies.
Nachkommen
Mit seiner ersten Frau Barbara Zápolya (1495–1515), einer Tochter des ungarischen Palatins Stephan Zápolya, die er 1512 ehelichte, hatte er zwei Töchter:
- • Hedwig (1513–1573); verheiratet seit 1535 mit Joachim II. Hector, Kurfürst von Brandenburg
- • Anna (1515–1520);
Im Jahr 1518 heiratete Sigismund Bona Sforza, die Nichte der verstorbenen Kaiserin Bianca Maria Sforza. Mit ihr hatte er sechs Kinder.
- • Isabella (1519–1559); verheiratet seit 1539 mit dem ungarischen König Johann Zápolya
- • Sigismund August (1520–1572); Großfürst von Litauen, König von Polen
- • Sophia (1522–1575); verheiratet seit 1556 mit Heinrich II., Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel
- • Anna (1523–1596); verheiratet seit 1576 mit dem polnischen König Stephan Báthory
- • Katharina (1526-1583); verheiratet seit 1562 mit dem schwedischen König Johann III.. Ihr Sohn Sigismund regierte später das Land 45 Jahre als Wahlkönig.
- • Albrecht Jagiełło (*/† 20. September 1527), Prinz von Polen und Litauen
Aus seiner nichtehelichen Beziehung mit der böhmischen Mätresse Katharina de Thelnicz (?–1528) hatte er drei Kinder:
- • Jan(usz) de Thelnicz (1499–1538); Bischof von Vilnius und Posen
- • Regina Szafraniec (1500–1526); verheiratet mit dem Starost, Großgrundbesitzer und königlichen Sekretär Hieronim Szafraniec
- • Katharina Gräfin von Montfort (1503–1548); verheiratet mit Graf Georg III. von Montfort
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann III. Sobieski
(Weitergeleitet von Jan III. Sobieski)
Johann III. Sobieski (polnisch Jan III Sobieski, litauisch Jonas Sobieskis; * 17. August 1629 in Olesko, heute Oblast Lwiw, Ukraine; † 17. Juni 1696 in Wilanów) war ein polnischer Adeliger, Staatsmann, Feldherr und ab 1674, als König von Polen und Großfürst von Litauen, der gewählte Herrscher des Staates Polen-Litauen, aus dem Adelsgeschlecht der Sobieskis. Er gilt als der Retter Wiens während der Belagerung durch die Türken 1683.
Leben
Johann (Jan) entstammte dem polnischen Hochadelsgeschlecht der Sobieskis, das der Wappengemeinschaft Janina angehörte. Er war Sohn des Kastellans von Krakau Jakub Sobieski und der Sofia-Teofila aus dem Haus Daniłowicz, was ihn zu einem Urenkel des Stanisław Żółkiewski machte.
Seine Kindheit verbrachte er in ritterlicher Tradition. Viele seiner ruhmreichen Vorfahren hatten bereits gegen die Osmanen gekämpft, und er wurde bereits in frühen Lebensjahren in die Kriegskunst eingewiesen. So brachte ihm sein Vater das Reiten, Fechten und Kämpfen bei. Von 1640 bis 1647 studierte er an der Krakauer Akademie.
Von 1646 und 1648 unternahm er mit seinem Bruder Marek eine Grand Tour durch mehrere europäische Länder. Bleibende Eindrücke hinterließ bei Jan vor allem der Aufenthalt in Frankreich. In dieser Zeit interessierte sich Jan Sobieski zunehmend für Kriegsführung, Politik und Literatur. Zwischen 1648 und 1653 kämpfte er gegen die Saporoger Kosaken des Bogdan Chmielnicki und krimtatarische Truppen aus dem Krimkhanat, bevor es ihm 1654 gelang, als Geheimbotschafter in die heutige Türkei einzureisen. Dort lernte er die Türkische Sprache und Kultur kennen. 1655 lernte er seine spätere Frau (∞ 1665), die Französin Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien, kennen, die zu dieser Zeit zum Hofstaat der französischstämmigen polnischen Königin Ludwika Maria gehörte. Diese Ehe eröffnete ihm später den Zugang zum französischen Hochadel.
Nach Stefan Czarnieckis Tod, 1665, wurde er zum Feldhetman der Krone befördert. Nach seinem Sieg gegen die vereinten kosakisch-tatarischen Truppen bei Podhajce 1667 wurde er 1668 Großhetman der Krone (Feldmarschall der Polnischen Krone).
Während eines erneuten Einsatzes gegen das Osmanische Reich besiegte er am 11. November 1673 das Heer des Großwesirs Köprülü Fazıl Ahmed unweit der Stadt Chotyn auf aufsehenerregende Weise, wodurch seine Popularität so stark anwuchs, dass er am 21. Mai 1674 auf den polnischen Thron gewählt wurde. Nicht zuletzt hatte ihm seine profranzösische Haltung und seine ehrgeizige Ehegattin Marysienka mit guten Beziehungen zum französischen Königshof zur Königskrone verholfen. Der Polen 1672 durch die „Hohe Pforte“ aufgezwungene Krieg verlief dennoch mit wechselvollen Erfolgen, bis schließlich beide Kriegsparteien 1676 im Vertrag von Żurawno die Waffen niederlegten.
In seinen ersten Regierungsjahren versuchte Jan Sobieski einige wichtige Reformen durchzusetzen, die der Festigung der Königsmacht dienen sollten. Darüber hinaus beabsichtigte er eine Allianz zwischen Frankreich und Polen gegen Brandenburg-Preußen zu besiegeln, da er das Herzogtum Preußen, das 1660 durch den Vertrag von Oliva Polen verlorenging, erobern und zur Stärkung seiner dynastischen Ziele und Hausmacht annektieren wollte (Polen war zur Zeit Sobieskis eine Wahlmonarchie, der Besitz der polnischen Krone daher stets unsicher und nicht vererbbar). Zudem verfolgte er das Ziel, die Macht Polen-Litauens über das Baltikum zu festigen, indem er seinen Sohn Jakob Louis Heinrich Sobieski dort anzusiedeln beabsichtigte. Aufgrund der ablehnenden Haltung der Franzosen, besonders nach dem ungünstig verlaufenden Krieg der Schweden gegen das Heer des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, war er jedoch gezwungen, seine Absichten hinsichtlich Allianzen zu ändern und sich enger an die katholischen Habsburger zu binden, mit denen er das Osmanische Reich gemeinsam zum Feinde hatte.
Als ihm die Berichte einer türkischen Belagerung der kaiserlichen Residenz Wien zu Ohren kamen, entschied er sich einzugreifen, ein Adelsaufgebot zu verkünden und die bedrohte Reichshauptstadt zu befreien [1]. Schon am 31. März des Jahres 1683 hatte er, da die Osmanen für beide Staaten eine Gefahr darstellten, auf Drängen von Papst Innozenz XI. ein Defensivbündnis mit Kaiser Leopold I. geschlossen, dies für den Fall, dass die Türken entweder Wien oder Krakau angreifen würden.
Am 4. September 1683 hielt er gemeinsam mit Karl V., Herzog von Lothringen Kriegsrat im Hardeggischen Schloss Juliusburg in Stetteldorf am Wagram. Diese Tat von Sobieski, die er mit Hilfe von 27.000 königlich-polnischen, 19.000 kaiserlichen, 10.500 bayrischen, 9000 sächsischen und 9500 Soldaten südwestdeutscher Fürstentümer durchführte, zerschlug mit dem Sieg am 12. September 1683 über die osmanische Armee unter Großwesir Kara Mustafa die türkischen Pläne, die habsburgischen Länder einzunehmen - in der folgenden Gegenoffensive konnte das Königreich Ungarn den Osmanen entrissen werden. Sobieski war offizieller Hauptbefehlshaber des vereinigten Entsatzheeres, dies auch aufgrund seiner hervorragenden Siege gegen die Türken und Tataren – die Schlachtpläne wurden vollständig von ihm und seinen Generälen entwickelt, nach dem Einspruch Karls von Lothringen durften die Österreicher aber auf dem linken Flügel kämpfen, statt wie ursprünglich geplant in der Mitte; das gesamte türkische Lager fiel nach der Schlacht in die Hände des Entsatzheeres, und Sobieski zog unter dem Jubel der Bevölkerung als Türkenbefreier in Wien ein.
König Jan III. Sobieski beherrschte mehrere Sprachen, war ein großer Kunstliebhaber und Mäzen. Sein Palast in Wilanów wird für eine der größten Errungenschaften des polnischen Barockstils gehalten. Eine weitere Residenz hatte er im Schloss von Schowkwa. Seine Briefe an seine Frau Marie sind ebenfalls große Zeugnisse polnischer Epistolografie.
Er starb 1696 in der königlichen Residenz in Wilanów bei Warschau und ist auf dem Wawel in Krakau begraben. Es folgte ihm nicht sein Sohn Jakob Louis Heinrich Sobieski auf dem Thron, sondern August der Starke, der Kurfürst von Sachsen. Seine Tochter Therese Kunigunde war mit dem Kurfürsten Maximilian II. Emanuel von Bayern verheiratet.
Bezug zur Gegenwart
- Das Sternbild Schild hieß zu Ehren des Königs ursprünglich Scutum Sobiescii (Schild des Sobieski).
- Die anhaltende Anerkennung seiner Leistungen, besonders in der Schlacht am Kahlenberg, zeigt sich in Polen auch in der Popularität der Zigarettenmarke Jan III Sobieski und dem Wodka Sobieski Wodka.
- Die amerikanische Schauspielerin Leelee Sobieski ist eine seitliche Nachfahrin des polnischen Königs, dessen direkte Nachfahren männlicher Linie ausgestorben sind.
Schlachten geschlagen durch die Polen unter der Führung von Johann Sobieski
- Podhajce (1667)
- Bracław (1671)
- Mohylów (1671)
- Kalnik (1671)
- Krasnobród (1672)
- Niemirów (1672)
- Komarno (1672) Kałusz (1672)
- Chotyn (1673)
- Bar (1674)
- Lemberg (1675)
- Trembowla (1675)
- Wojniłów (1675)
- Żurawno (1676) Wien (1683)
- Parkany (1683)
- Jazłowiec (1684)
- Żwaniec (1684)
- Jassy (1686)
- Suczawa (1691)
Literatur
- Gerda Hagenau: Jan Sobieski. Der Retter Wiens. Amalthea, Wien 1983, ISBN 3-85002-158-0 (Taschenbuchausgabe: Ullstein, Frankfurt am Main und Berlin 1991, ISBN 3-548-22400-8)
- Zbigniew Wójcik: Jan Sobieski. 1629–1696. Warszawa 1994
- Joachim Zeller (Hrsg.): Jan Sobieski - Briefe an die Königin. 2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-518-04525-3
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
August II. (Polen) - August der Starke
Friedrich August I. von Sachsen, häufig genannt August der Starke (* 12. Mai 1670 in Dresden; † 1. Februar 1733 in Warschau) war ein aus der albertinischen Linie des Fürstengeschlechts der Wettiner stammender Kurfürst von Sachsen (als Friedrich August I.) sowie ab 1697 König von Polen und Großfürst von Litauen (als August II.) in Personalunion.
Er gilt als eine der schillerndsten Figuren höfischer Prachtentfaltung des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts und begründete als Prototyp absolutistischer Selbstdarstellung durch seine rege Bautätigkeit und sehr ausgeprägte Sammelleidenschaft im Wesentlichen den Ruf Dresdens als prunkvolle barocke Metropole, der bis heute nachwirkt. Unter ihm erlebte der Kurstaat eine enorme wirtschaftliche, infrastrukturelle und kulturelle Blüte. Gleichzeitig verwickelte er seine Untertanen jedoch in den glücklosen Nordischen Krieg, in dessen Verlauf er zwar die polnische Krone endgültig für sich gewinnen konnte, aber bald darauf durch seine Unfähigkeit zu inneren Reformen den Weg für weitere Kriege und die Stärkung des russischen Einflusses in Polen bereitete.
Leben
August wurde am 12. Mai 1670 als zweitältester Sohn Johann Georgs III. von Sachsen und der Prinzessin Anna Sophie von Dänemark und Norwegen in Dresden geboren und zeitweise in der Lichtenburg zu Prettin erzogen. Schon früh genoss er eine standesgemäße Ausbildung, zu der 1676 u. a. die folgenden Erzieher berufen wurden:
- v. Knoch für die Fremdsprachen Italienisch, Französisch und Spanisch
- Bernhardi für die Musik
- v. Klengel für das Militärwesen, Zeichnen, Fortifikationswesen und die Mathematik
Darüber hinaus erhielt er Unterricht in Theologie und Geschichte, vor allem der regierenden Häuser Europas. Anschließend folgte dann die obligatorische Grand Tour, die August am 19. Mai 1687, wenige Tage nach seinem 17. Geburtstag, incognito als Graf von Meißen antrat. Es war eine geplante „Reise auf drey Jahr“, die von Dresden über Frankfurt am Main, Straßburg, Paris, Spanien, Portugal, England, Holland, Dänemark, Schweden, Nürnberg, Augsburg, München, Innsbruck, Mailand, Venedig (wo er auf den Grafen Königsmarck traf) und Wien zurück nach Dresden führte, wo er auf Befehl seines Vaters am 28. April 1689 wieder eintraf. Begleitet wurde August von seinem Hofmeister v. Haxthausen, der ihn auch im Reiten, Fechten und Schießen unterrichtete, dem Pfarrer Dr. Anton, dem Stallmeister von Einsiedel, dem Kammerjunker von Thielau sowie den Ärzten Dr. Pauli und Dr. Bartholomaei, der 1708 zum Arkanisten wurde und dem August die Überwachung und Aufsicht der Böttgerschen Goldversuche und Porzellangewinnung mit übertrug.
In den folgenden drei Jahren nahm er am Krieg gegen Frankreich am Oberrhein teil, hielt sich anschließend eine Zeit lang am kaiserlichen Hof in Wien auf und beteiligte sich an einem Feldzug in den Spanischen Niederlanden. August wurde nach dem Tod seines Bruders, zu dem er immer nur ein gespanntes Verhältnis hatte, 1694 unerwartet neuer Kurfürst von Sachsen, womit in der sächsischen Geschichtsschreibung das sog. Augusteische Zeitalter begann, das seine Regierungszeit und die seines Sohnes zusammenfasst. Vom Juli 1695 bis September 1696 nahm er als Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres in Ungarn mit wechselndem Erfolg am Großen Türkenkrieg teil. In der Schlacht an der Bega 1696, die unentschieden ausging, erlitten die Deutschen erhebliche Verluste, woran jedoch zum großen Teil der Widerstand des alten kaiserlichen Generals gegen das Oberkommando des jungen Kurfürsten schuld war.
Regierung im sächsischen Kurstaat
Versuche zur Etablierung des Absolutismus
In Sachsen drängte August den Einfluss des alteingesessenen Adels zurück und regierte mittels des 1706 geschaffenen Geheimen Kabinetts als zentrale Schaltstelle exekutiver Befugnisse, dessen bedeutendste Minister und Offiziere v. Beichlingen, v. Flemming, v. Zech, v. Schöning, A. M. G. v. Hoym, C. H. v. Hoym, H. F. v. Friesen, O. H. v. Friesen, v. Werthern, v. Löwendal, Wicardel, v. Wackerbarth, v. Manteuffel, A. F. v. Pflugk und O. H. v. Pflugk waren. Das Geheime Kabinett wurde durch beständige Erweiterung seiner Befugnisse zur obersten Zentralbehörde gemacht und der Beamtenapparat unter einem Kammerpräsidenten mit loyalen Bürgerlichen besetzt. Ein Bergratskollegium, ein Geheimer Kriegsrat und ein Generalkriegsgericht wurden errichtet. Zu einem wirklichen Absolutismus kam es aber nie. Dies wurde noch 1717 im Streit des Kurfürsten einerseits und dem sächsischen Adel sowie des aufstrebenden Bürgertums andererseits deutlich, wobei Anlass der Revolte der Übertritt des Kurprinzen zum Katholizismus war. Der 1724 erstmals in Leipzig gedruckte „Codex Augusteus“ löste die „Konstitutionen“ von 1572, das bis dahin umfangreichste sächsische Werk für Gesetze, Verordnungen, Mandate und Landtagsabschiede, ab und die neue Landtagsordnung von 1728 führte zu einer weiteren Einschränkung der Rechte der Stände. Die Herausgabe eines Staatshandbuches in Gestalt des Hof- und Staatskalenders erfolgte erstmals 1728. Für die Zeit seiner Abwesenheit von Sachsen ernannte August, ohne Bestätigung durch die Stände, 1697 bis 1706 den schwäbischen Reichsfürsten Anton Egon von Fürstenberg-Heiligenberg, seit 1698 auch Präsident des Generalrevisionskollegiums für die Abstellung von Missständen im Steuerwesen, zu seinem Statthalter ebenda. August der Starke war es auch, der den Juden erstmals seit ihrer Vertreibung 1430 wieder die Ansiedlung in Sachsen gestattete; eine große Rolle spielte hierbei auch sein Hofjude Lehmann, den er 1696 aus Halberstadt nach Dresden holte, wo in der Folge eine jüdische Gemeinde von einiger Bedeutung entstand.
Finanzwesen und Wirtschaftspolitik
Im Oktober 1694 ließ er eine landesweite statistische Erfassung aller Amtsregalien, Einkünfte und Nutzungen nach einem einheitlichen Schema durchführen. August wollte entsprechend seinem absolutistischen Machtbewusstsein finanziell unabhängig von den Ständen agieren, da diesen die Bewilligung direkter Steuern zustand, weshalb er sich um die Einführung indirekter, d.h. verbrauchsorientierter Steuern bemühte, was ihm mit Schaffung der völlig neuen Generalkonsumtionsakzise (samt oberster Steuerbehörde) 1703 gegen Widerstände auch gelang. Zur Rechnungsprüfung und Ordnung der Staatsfinanzen wurde 1707 eine Oberrechenkammer und das Oberrechnungskollegium als zentrale Revisionsbehörde aller landesherrlichen Kassen eingerichtet. Seit 1712 stand der Ökonom Marperger in sächsischen Diensten und war mit seinem Rat maßgeblich an vielen der progressiven Reformen beteiligt. Die sächsische Wirtschaft wurde nach den Grundsätzen des Merkantilismus staatlich gefördert und auf Export orientiert (Leipziger Messe), wobei sich August zur Effektivierung dieser Anstrengungen auch um die Gründung eines Kommerzkollegiums bemühte, was jedoch erst zwei Jahre nach seinem Tod umgesetzt wurde. Als wirtschaftlich bedeutsam erwiesen sich auch die Gründung der ersten Staatsbank im deutschen Raum 1698 (Sitz: Leipzig), die Errichtung einer Landeslotterie 1715, die Einführung des Gregorianischen Kalenders 1700 und der schriftlichen Messrelationen (ab 1729) sowie die Landesvermessung und Reform der sächsischen Post um 1722, die damals die schnellste im Deutschen Reich wurde. Bekannt ist zudem die Nacherfindung des Porzellans durch Tschirnhaus, Böttger, v. Ohain und v. Schönberg, die 1710 zur Gründung der Meißner Porzellanmanufaktur führte. Neben dieser Errungenschaft betätigte er sich auch selbst als Unternehmer, z. B. mit der Olbernhauer Waffenschmiede sowie der Fayence-Manufaktur von 1708 in der Neuen Königsstadt. Insgesamt wurden in Augusts Regierungszeit in Sachsen 26 Manufakturen geschaffen, so auch für die Produktion von Spiegeln, Gewehren, Tuch, Gold- und Silbergespinste (sog. „Leonische Waren“), Damast, Blaufarben und Tapeten.
Auswärtige Beziehungen, kriegerische Auseinandersetzungen und Politik in Polen
Glaubenswechsel, Gewinnung der polnischen Krone und konfessionspolitische Folgen
August konvertierte heimlich am 1. Juni 1697 in der katholischen Hofkapelle zu Baden bei Wien und später öffentlich in Deutsch-Piekar zum katholischen Glauben, indem er das vorgeschriebene Apostolische Glaubensbekenntnis vor seinem Großcousin Prinz Christian August von Sachsen-Zeitz, dem Bischof von Raab, ablegte, der ihn auch geheim im neuen Glauben unterrichtet hatte und nach erfolgter Konversion eine Bescheinigung ausstellte, die vom päpstlichen Internuntius beglaubigt wurde. Nach reichlichem Alkoholgenuss und den üblichen Bestechungsgeldern, großenteils aufgebracht durch seinen Hofjuden Lehmann, konnte er am 26./27. Juni in Warschau-Wola gewählt und am 15. September 1697 in Krakau gekrönt auch den polnischen Thron als August II. Mocny gewinnen, auf den er nach der Niederlage gegen die Schweden im Großen Nordischen Krieg wieder verzichten musste (Friede zu Altranstädt 1706), den er aber 1709 wiedergewann. Dem sächsischen Gesandten in Warschau, Graf Flemming, war es zuvor gelungen, die Konkurrenz durch das Aufstellen immer neuer Bewerber völlig zu zersplittern. Die Bemühungen des Neffen von Papst Innozenz XI., des Fürsten Livio Odescalchi, Herzogs von Bracciano und Ceri, des Sohnes des vormaligen Königs Johann III. Sobieski, Prinz Jakob Ludwig Heinrich, des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, des Herzogs Leopold von Lothringen, des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, des Kurfürsten Max II. von Bayern und zwölf weiterer Kandidaten waren daher hoffnungslos. Der aus Frankreich zur Königswahl angereiste Fürst Franz Ludwig von Bourbon-Conti konnte sogar eine größere Stimmenzahl als August auf sich vereinigen, musste jedoch, von sächsischen Truppen genötigt, ohne Erfolg in seine Heimat zurückkehren – was jedoch Fragen zur Legalität von Augusts Wahl unter den polnischen Magnaten aufkommen ließ.
Mit dem Übertritt Augusts zum Katholizismus verlor Sachsen die Führungsrolle unter den evangelischen Reichsständen an Brandenburg-Preußen. August verzichtete jedoch auf die Anwendung des Instrumentariums cuius regio, eius religio, das ihm eine Rekatholisierung Sachsens oder zumindest eine Emanzipation der römischen Religion ermöglicht hätte und versicherte stattdessen seinen sächsischen Untertanen im Religionsversicherungsdekret von 1697 (1734 von seinem Sohn erneuert), dass sein Übertritt zum Katholizismus keine Folgen für sie habe. Dennoch entfremdete der Glaubenswechsel, der nur aus machtpolitischem Kalkül heraus geschehen war, den Landesherren von seinen protestantischen Untertanen. Die Funktion des Oberhauptes der evangelischen Landeskirche in Sachsen übertrug August zunächst dem Geheimen Rat und bezüglich einiger Befugnisse seinem ernestinischen Vetter Friedrich von Sachsen-Gotha-Altenburg. Ab 1724 lenkte das Oberkonsistorium unter den verschiedenen Sächsischen Oberhofpredigern die Geschicke der Landeskirche weitgehend selbstständig. Dennoch blieben die katholischen Kurfürsten und Könige von Sachsen bis 1918 nominell Oberhäupter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens sowie Direktoren des Corpus Evangelicorum und „Hüter des Protestantismus“ im Reich. Papst Clemens XII. versuchte die Sachsen zur Rückkehr in die katholische Kirche zu bewegen, indem er ihnen in der Bulle Sedes apostolica von 1732 den Besitz der früheren Kirchengüter in Aussicht stellte.
Das „polnische Abenteuer“ ihres Landesherren kam die Sachsen teuer zu stehen. Aus der sächsischen Staatskasse flossen Unsummen an Bestechungsgeldern an den polnischen Adel und an kirchliche Würdenträger Polens (in der Regierungszeit Augusts etwa 39 Mio. Reichstaler), um sich diese geneigt zu machen. August veräußerte hierfür sogar einige nicht unbedeutende sächsische Ländereien und Rechte. So verzichtete er 1689 gegen 733.333 Taler und 6 Pfennige (entspricht 1,1 Mio. Gulden) auf seinen Anspruch auf Sachsen-Lauenburg nach dem Aussterben der hiesigen Askanier und verkaufte 1698 die Erbvogtei über das Reichsstift Quedlinburg für 300.000 Taler an die brandenburgischen Hohenzollern, denen er ebenfalls die Ämter Lauterberg, Sevenberg, Gersdorff und Petersberg sowie 1707 das Reichsschulzenamt über Nordhausen überließ. Den Grafen von Schwarzburg wurden 1699 landeshoheitliche Rechte gegen Geld eingeräumt. Das Herzogtum Sachsen-Zeitz konnte jedoch nach dem Aussterben einer verwandten Seitenlinie 1718 wieder in den Kurstaat integriert werden.
Herrschaft in Polen und Nordischer Krieg
Nach einer militärischen Kampagne in Moldawien schlug seine polnische Armee 1698 eine Expedition der Tataren bei Pidhajzi in der Schlacht von Podhajce – ein Sieg, der das Osmanische Reich wesentlich zur Unterzeichnung des Vertrags von Karlowitz 1699 zwang.
August stützte sich als Wahlkönig Polens hauptsächlich auf Sachsen; denn seine Beamten, die Kronarmee und die Staatskasse unterstanden in Polen dem Sejm, dessen Politik von den mächtigen Magnatenfamilien und der Szlachta bestimmt wurde. Ihre Neigung zur Bildung von Konföderationen verwandelte das Königreich in ein Pulverfass. Der Reichstag Polens war durch diese Privatinteressen relativ handlungsunfähig (Liberum Veto); die Krone selbst hatte nur beschränkte Einkünfte, die dem Kronschatzmeister Przebendowski unterstanden. Residiert wurde bis 1700 im Palais Wilanów.
Nach dem Großen Nordischen Krieg strebte er daher die Entmachtung des Reichstages in einem Staatsstreich an. Seine Vertreter forderten dort die Verschmelzung der sächsischen Truppen mit der polnischen Kronarmee, nachdem man schon 1713 sämtliche polnische Festungen besetzt, Lager anlegen und Verhaftungen hatte vornehmen lassen. Da dies ein erster Schritt zur Errichtung einer absolutistisch orientierten Erbmonarchie in Polen bedeutet hätte, provozierte es 1715/16 den Aufstand der Konföderation von Tarnogrod, angeführt von Marschall Ledóchowski und Graf Branicki, wodurch August seinen Thron riskierte. Es war hauptsächlich ein Aufstand des Kleinadels gegen den König; bedeutende Magnaten wie z. B. Litauens Hetman Ludwik Pociej (ein Freund Peters des Großen) versuchten eher zu vermitteln. Die sächsischen Truppen blieben zwar in allen größeren Gefechten siegreich, konnten den Aufstand aber nicht beenden, so dass die Kassen knapp wurden. August akzeptierte die von den Konföderierten ins Spiel gebrachte Vermittlung des Zaren und erreichte im Frieden von Warschau 1716 bzw. im Stummen Sejm 1717 nur Teilerfolge. Die sächsische Armee musste im Gegenzug das Land verlassen.
Nach 1716 zeichnete sich jedoch eine gewisse Stabilisierung seiner Regierung in Polen ab, wodurch zwar einige Reformen möglich wurden – aber für solche im Sinne des Absolutismus bestand keine Aussicht. Mehrere Reichstage platzten, und August bemühte sich ergebnislos, dem Kurprinzen die Nachfolge zu sichern. Wenigstens erholte sich Polen in den 20er Jahren wirtschaftlich von den Auswirkungen des großen Nordischen Krieges. Der Gutsadel produzierte intensiv, der Warenaustausch zwischen Polen und Sachsen, durch die Leipziger Messe gefördert und Zollabkommen erleichtert, stieg. Vorzugsweise kamen dabei die Rohstoffe aus Polen und Fertigprodukte aus Sachsen. Paläste, Parks und zahlreiche neue Kirchen zeugten davon, dass Polen nach wie vor über Ressourcen verfügte. Nur fehlte es in der, sich ständig in innerer Blockade und Ohnmacht befindlichen, Adelsrepublik am Willen, etwas daraus zu machen. Eine zentrale Wirtschafts- und Finanzpolitik war in Polen nicht durchsetzbar, ein großer Teil der Steuern (bis zu 20%) blieben auf dem Einzugswege hängen und merkantilistisches Denken beschränkte sich auf das Eigeninteresse der Magnatenfamilien.
In seine Regentschaft fiel auch das aufsehenerregende „Blutgericht zu Thorn“ von 1724.
Gegen Ende des Nordischen Krieges sicherte sich August seine Polenpolitik gegenüber Russland und Preußen im Wiener Allianzvertrag 1719 mit dem Kaiser und Großbritannien ab.
Großmachtträume und militärische Ambitionen
August hatte bereits 1704 den Plan gefasst, seinen Sohn mit der österreichischen Erzherzogin zu vermählen, um sich damit besser gegen das immer stärker werdende Preußen behaupten zu können. Zudem erhoffte er sich davon im Falle eines Aussterbens des Hauses Habsburg die Möglichkeit zum Gewinn der Kaiserkrone für sich selbst oder seinen Sohn – diese Absichten mussten jedoch bald wieder aufgegeben werden. Nach dem Tode Kaiser Josephs I. 1711 nahm August bis zur Wahl des Nachfolgers das mit der sächsischen Kurwürde verbundene Amt des Reichsvikars wahr. In der Habsburgischen Erbfolgefrage nahm er gleichzeitig eine scheinbar neutrale Position im Reich ein. August plante zwar insgeheim, Kaiser Karl VI. beiseite zu setzen, aber ihm fehlten dazu die Mittel; auch machte seine angeschlagene Gesundheit nach 1726 weitere Schritte in diese Richtung unmöglich. Auch scheiterten Pläne, das Königreich Polen in eine Erbmonarchie umzuwandeln und so der wettinischen Familie dauerhaft zu sichern.
1722 verschärfte sich der seit 1721 schwelende Zollkrieg mit Preußen. 1725 übertrug der Kaiser Kursachsen die Vertretung der Interessen der Magdeburger Ritterschaft gegen deren Lehnsherrn, König Friedrich Wilhelm I. in Preußen.
August ließ das, bereits seit 1682 bestehende, sächsische stehende Heer um 1700/01 erheblich verstärken und 1706 reorganisieren. 1712 wurde ein Ingenieurkorps und 1723 zu Dresden die Ritterakademie zur Offiziersausbildung gegründet. Letzterer Schritt mündete dann in die Augusteischen Heeresreform, die auf Grund steigender Wirtschaftskraft bis 1732 nach preußischem Vorbild angegangen werden konnte und mit der sich August auf die Auseinandersetzung mit Habsburg und Preußen im drohenden Österreichischen Erbfolgekrieg vorzubereiten suchte.
Im Sommer 1730 führte August II. im Zeithainer Lustlager, dem „Spektakel des Jahrhunderts“, unter dem Motto Sic fulta manebit. Sic pax („Auf solches (gemeint ist die Armee) gestützt, bleibt der Friede“) 48 geladenen europäischen Fürsten und deren Militärs eine starke, 30.000 Mann umfassende Armee in Manöveraktionen vor. Diese großartigen Festlichkeiten, abgeschlossen mit einem Feuerwerk, stellten nicht nur die militärische Leistungsfähigkeit, sondern auch den hohen Stand der sächsischen Kunst und Kultur zur Schau. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. in Preußen, notierte hierzu anerkennend: „Die drei Regimenter Kronprinz gut, Weissenfeld gut, sehr gut. Pflugk sehr miserabel, schlecht. Befehlsgebung gut. Von der Kavallerie habe ich Kommandos gesehen, die finde ich sehr propre“ – Bemerkungen, aus denen bereits das Interesse spricht, Auskunft über die militärischen Schwachstellen des südlichen Nachbarn zu gewinnen. Der ebenfalls anwesende preußische Kronprinz Friedrich erfuhr damals auf dem diplomatischen Parkett einige Kränkungen, die zu seiner Abneigung gegen Sachsen und seinem rücksichtslosen Vorgehen gegen das Land im Siebenjährigen Krieg beigetragen haben dürften.
Am Reichskrieg gegen Frankreich beteiligte sich Kursachsen 1703 mit einem Regiment unter Graf Schulenburg in der Oberpfalz und am Oberrhein.
Titulatur
August bezeichnete sich selbst als „Von Gottes Gnaden König in Polen, Großfürst in Litthauen, Reußen, Preußen, Masovien, Samogitien, Kyovien, Volhynien, Podolien, Podlachien, Lieffland, Smolenscien, Sewerien und Tschernikovien, erblicher Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westphalen, des heiligen Römischen Reichs Erzmarschall und Churfürst, Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen auch Ober- und Unterlausitz, Burggraf zu Magdeburg, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark, Ravensberg und Barby, Herr zu Ravenstein etc.“. Eine derartige Fülle von Titeln war typisch bei Monarchen dieser Zeit und hatte eher dekorativen Stellenwert – sie resultierte vorwiegend aus Ansprüchen auf Territorien, die sie nicht mehr oder niemals in ihrem tatsächlichem Besitz hatten bzw. umstrittenen Charakter aufwiesen oder aber aus vorherigen Belehnungen der Wettiner zu gesamter Hand, die es jedem Familienmitglied ermöglichte, bestimmte Titel von Ländereien zu tragen, deren Regierungsausübung oder zumindest Ansprüche auf selbige in den Händen anderer Linien des Gesamthauses lagen.
Legendäre Kraft und Tod des Herrschers
Sein Beiname „der Starke“ bezieht sich auf die mitunter zur Schau gestellte körperliche Kraft. So soll er am 15. Februar 1711 ein Hufeisen mit den bloßen Händen zerbrochen haben. Darüber ließ er ein Zertifikat anfertigen und Hufeisen sowie Zertifikat in der Kunstkammer aufbewahren. Das Volk war begeistert und jubelte seinem „sächsischen Herkules“ enthusiastisch zu. (Zitiert nach Katja Doubek: August der Starke, S. 82 f.) Seine Körpergröße von 1,76 Metern war für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich. Seine Stärke wird auch auf seine Vorfahrin Cimburgis von Masowien zurückgeführt.
August litt unter Diabetes mellitus – weshalb ihm bereits eine Zehe amputiert werden musste –, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und wog zuletzt über 110 Kilogramm. Er starb am 1. Februar 1733 um 4 Uhr nach einem Schwächeanfall im Alter von 62 Jahren in Warschau und wurde am 25. Januar 1734 im Beisein seines Sohnes in der Königskrypta der Wawelkathedrale des Schlosses zu Krakau feierlich beigesetzt. Seine Eingeweide wurden separat in einer Urne in der Warschauer Kapuzinerkirche zur Verklärung des Herrn bestattet.
Sein Herz kam auf eigenen Wunsch in einer silbernen, innen vergoldeten Kapsel nach Dresden, wo es zunächst in der alten katholischen Hofkirchenkapelle zwischen Schloss und Taschenbergpalais aufbewahrt wurde, bis es dann in einer Mauernische der 1755 fertig gestellten Stiftergruft der Katholischen Hofkirche seinen endgültigen Platz fand (Herzbestattung).
Sein Tod zog eine Flut an Trauer- und Lobgedichten von den dazu verpflichteten Hofpoeten nach sich. Größere Bekanntheit erlangte darunter die durch den in Hamburg akkreditierten sächsisch-polnischen Gesandten sowie den Hamburger Rat kommissionierte Arbeit des Theologiestudenten Zimmermann, die von Telemann für Unsterblicher Nachruhm Friederich Augusts von 1733, fälschlich auch Serenata eroica genannt, die Trauermusik für August den Starken, verwendet wurde.
Eine Büste von ihm wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in der Bayerischen Walhalla aufgestellt.
Blüte von Kunst, Kultur und höfischen Vergnügungen
August ließ seine Residenzen in Dresden (daher der Beiname „Elbflorenz“) und Warschau – allerdings zulasten anderer sächsischer Städte und Regionen – zu den prächtigsten Europas ausbauen. Das Konzept seiner Baumaßnahmen lag aber nach ersten fehlgeschlagenen Planungen nicht in einem zweiten Versailles oder Schönbrunn, sondern in einer Kette von kleineren Schlössern und Palais mit ihrem jeweiligen Zweck:
In Dresden nutzte man den Zwinger und den Großen Garten für rauschende Hoffeste – residiert wurde hingegen weiterhin im barock umgestalteten Dresdner Residenzschloss. Das Japanisches Palais war als Porzellanschlösschen vorgesehen, Moritzburg diente der Jagd, Pillnitz den Wasserfesten auf der Elbe, dem sog. „Canal Grande“, und der Barockgarten Großsedlitz den Festlichkeiten zur Verleihung des polnischen Adlerordens. In die Hoflößnitz lud August seine Jagdgesellschaften ein, um dort Tanzfeste mit Weinausschank zu veranstalten. Eigens für den Zweck der Parforcejagd, an der August großen Gefallen gefunden hatte, wurde der wildreiche Wermsdorfer Wald nach französischem Vorbild durch ein Wegenetz umgestaltet und der Bau des Neuen Jagdschlosses Hubertusburg veranlasst. In Warschau verzeichnet man den Umbau des Königsschlosses, den Bau des Sächsischen Palais (1944 zerstört) und ebenfalls eine städtebauliche Neuordnung (sog. „Sächsische Achse“). Der König pachtete in Polen auch Schlösser, da das Bauen durch die Verhältnisse in dem Land erschwert wurde, so dass sein Werk hier nicht übermäßig über das großer Magnaten hinausragte.
Neue Bauvorschriften (wie die 13 „Flemmingschen Baupunkte“ von 1708, Karchers Bauordnung von 1710 sowie eine weitere von 1720) regelten die städtebauliche Umwandlung der einstigen Renaissance-Stadt Dresden in eine Barockstadt (dabei verschwanden viele der schmalen Giebelhäuser der Gotik und Renaissance), forderten die ausschließliche Steinbauweise und schrieben die Anzahl und Höhe der Stockwerke sowie eine Vereinheitlichung der Verputzfarbe vor. Sie kam vor allem beim barocken Wiederaufbau der Neuen Königsstadt zur Anwendung, aber auch im Bereich des Neumarktes entstanden neue Straßenzüge mit einheitlichem Erscheinungsbild.
Als eine der ersten deutschen Städte besaß Dresden damals öffentlich zugängliche Museen, die zum Vorbild vieler anderer (z. B. in Wien und München) wurden. 1705 wurde eine Malerschule gegründet, aus der die Dresdner Kunstakademie hervorging. Die Dresdner Kunstsammlungen, vor allem die Porzellansammlung, die Pretiosensammlung im Grünen Gewölbe, die Gemäldegalerie, die Antikensammlung, das Kupferstichkabinett, das Münzkabinett und der Mathematisch-Physikalische Salon wurden entsprechend dem Zeitgeschmack ausgebaut und gehören, dank der Sammelwut Augusts und seines Sohnes, seitdem zu den reichsten und größten Europas. So kann man im Zwinger heute noch Vasen und andere Gefäße aus chinesischem Porzellan der Kangxi-Ära bewundern, von denen August 1717 151 Stück in einem Tauschgeschäft mit dem Soldatenkönig erhielt, in dem er diesem 600 sächsische Landeskinder inklusive Pferden und Ausrüstung als Dragoner-Regiment überließ.
Künstler am Hofe Augusts des Starken
Am sächsischen Hof waren bedeutende Künstler aus vielen Ländern Europas tätig, und alles in allem konnte er als Mäzen Dresden zur führenden deutschen Kulturmetropole des Barock gestalten (Dresdner Barock). Unter seiner Herrschaft wirkten unter vielen anderen:
- die Komponisten Benda, Buffardin, Hasse, Hebenstreit, Heinichen, Lotti, Pisendel, Quantz, Ristori, Schmidt, Veracini, Volumier, v. Westhoff, Weiss, Zelenka sowie mehrere Mitglieder der Familie Bach in der kurfürstlich-sächsischen und königlich-polnischen Kapelle
- die Dichter, Philosophen, Juristen und Ärzte Beckh, C. H. v. Berger, J. G. v. Berger, J. H. v. Berger, J. W. v. Berger, v. Besser, Dedekind, Glafey, Gribner, Günther, v. Heucher, v. König, Mencke, Schirmer, Trömer und v. Zinzendorf,
- der Kartograf Zürner,
- die Bildhauer, Baumeister, Holzschnitzer und Gebäudekünstler Bähr, de Bodt, Coudray, Dietze, Eigtved, Fäsch, Fritzsche, v. Göthe, Grone, Hase, v. Jauch, Jentzsch, Karcher, Kirchner, v. Klengel, Knöffel, Kretzschmar, Longuelune, v. Naumann d. Ä., Permoser, le Plat, M. D. Pöppelmann, Schumann, Schwarze und Thomae
- die Maler und Tapetenkünstler Bottschildt, Ertel, Fehling, Grone, Mercier, J. A. Pöppelmann, Rossi und de Silvestre,
- der Orgelbauer Silbermann,
- der Kupferstecher Zucchi,
- der Glasschneider Noor,
- die Goldschmiede, Steinschneider, Juweliere und Emailleure Bolt, G. F. Dinglinger, J. M. Dinglinger, Ertel, Döring, Heermann, Hübner, Irminger, Köhler, Lücke d. Ä., Meyer und Triquet,
- die Glaskünstler und Erfinder des Porzellans in Europa Böttger und Tschirnhaus sowie
- die Porzellangestalter Höroldt und Kändler.
Seine legendären und fast ständig stattfindenden Bälle, Jahrmärkte, Tierhetzen, Maskeraden und Schützenfeste (etwa 60 im Jahr), wie die zu seinem Amtsantritt 1694 und den Jahrestagen zur Erlangung der polnischen Krone, die überschwängliche Begehung des Karnevals nach venezianischem Vorbild oder das ritterliche „Karussell der vier Teile der Welt“ mit Triumphwagen und verkleideten Protagonisten anlässlich des Besuches des Dänenkönigs Friedrich 1709, zu dessen Anlass sich August eigens eine goldene Sonnenmaske anfertigen ließ und bei dem sich der Hof u. a. in bäuerlichen Kostümen und mit August als französischem Schankwirt an der Spitze ausgelassenen Zerstreuungen hingab, waren dagegen wohldurchdachte Staatsaktionen, verschlangen jedoch Unsummen (weit mehr als 25.000 Taler pro Jahr). Sie dienten wie seine neuen Schlösser und Kunstsammlungen der königlichen Selbstdarstellung nach dem Vorbild Ludwigs XIV. von Frankreich.
Hochzeit des Sohnes Augusts des Starken
Die 4 Mio. Taler teure Hochzeit des Kurprinzen mit der Kaisertochter 1719 ging besonders opulent vonstatten: Die Braut, die am 2. September Pirna erreichte, ging an Bord des Bucentauro, einer Replik der venezianischen Staatsgondel, und fuhr mit dieser, begleitet von anderen Prunkschiffen und -gondeln sowie mit Musik von Hebenstreit, Buffardin, Weiss, 6 Oboisten und 2 Hornbläsern, in Dresden ein. Das Brautpaar traf sich anschließend mit August auf der mit türkischen Zelten dekorierten Vogelwiese und hielt mit über 100 geschmückten Kutschen Einzug ins Dresdner Residenzschloss. Die prunkvolle Parade wurde mit Trompeten- und Paukenmusik von den Triumphbögen und Kirchentürmen aus begleitet. Am 3. September besuchte der Hof ein feierliches Te Deum mit Musik des Hoftrompetencorps in der Katholischen Hofkapelle. Während des Stückes wurden 330 Salutschüsse abgefeuert, gefolgt von einer Festtafel im Schloss, begleitet mit Hofkapellmusik und Singeinlagen sowie dem Besuch von Lottis Opera seria pastorale „Giove in Argo“ im neuen Opernhaus am Abend. Am 4. September folgten ein Tanzabend mit 94 Musikern im Riesensaal des Schlosses sowie französische („Ariane“), ferner italienische Theaterstücke am 5. und 6. September. Außerdem fand ein sog. „Kampf-Jagen“ statt: begleitet von Horn-, Trompeten- und Paukenklängen sowie über 4000 Besuchern wurden in einem hölzernen Amphitheater verschiedene wilde Tiere (2 Löwen, 1 Panther, 1 Pavian, 6 Bären, Wildschweine und Auerochsen) aufeinander losgelassen und dann von August und dem Brautpaar abgeschossen. Am 7. September wurde Antonio Lottis Oper „Ascanio overro Gli odi delusi dal sangue“ sowie ein italienisches Theaterstück aufgeführt. Am 8. und 9. September fanden im Innenhof des Marstalls „Damen-Rennen“ und „Ringspiele“ sowie am Abend italienische Komödien und französische Tragödien („l'Inconnue“) statt. Am 10. September, dem Tag des Sonnenfestes, wurden Heinichens Festoratorium „La gara degli dei“ und später ein Feuerwerk, begleitet von 64 Trompeten, 8 Pauken und Tafelmusik, aufgeführt. Die Aufführung des französischen Theaterstücks „Hypermnestre“ folgte am 11. September. Am 12. September fand das Marsfest statt: Wettkämpfe zu Pferde und zu Fuß sowie am Abend Theater. Am 13. und 15. September wurde „Teofane“ im Opernhaus und „Li quattro elementi accompanimenti“ (beide von Antonio Lotti) im Schlossgarten aufgeführt – ergänzt durch französisches Theater am 14. September. Am 15. September dann das Fest des Jupiters mit einem „Karussell der vier Elemente“ – einer Pferdevorführung mit Militärmusik und italienischem Theater am Abend. Am nächsten Tag war Tanzabend, und am Tag darauf fand das Fest zu Ehren der Erdgöttin Erda statt, bei dem eine Aufführung von 300 Janitscharen mit 24 Mohren und 12 Heiden (deutschen und polnischen Lakaien) in türkischen Gewändern stattfand – am Abend „Nacht-Schießen“.
Die Serenate „Diana sul' Elba“ von Johann David Heinichen zu Ehren der Jagdgöttin wurde am 18. September auf einem aufwändig dekorierten Schiff, in der Form einer riesigen Muschelschale, mit 4 „Nymphen“ an Bord und gezogen von 4 „Seepferdchen“, aufgeführt. In der anschließenden Wasser-Jagd wurden 400 Hirsche, Rehe und Wildschweine in die Elbe getrieben, um danach abgeschossen zu werden – am Abend italienisches Theater. Am 20. September fand das Merkurfest statt, das einen festlichen Umzug, die Aufführung einer italienischen Kantate, einen großen „Jahrmarkt der Nationen“, eine Messe und eine Lotterie im Zwinger umfasste – die Braut wurde in einem prächtigen Muschelwagen ins Festgelände eingefahren. Am folgenden Tag war Theater. Unter den vielen anderen Aktivitäten waren auch die Aufführung des französischen Divertissements „Les quatres saisons“ mit einem Text von Poisson und der Musik des Kapellmeisters Schmidt am Tage des Venusfests (23. September) unter freiem Himmel im Großen Garten, bei dem auch über 100 Angehörige des Hofes im Venustempel neben dem Palais selbst tanzten und zu der auch Georg Friedrich Händel aus London und Georg Philipp Telemann angereist waren – sicher auch, um das neue Opernhaus am Zwinger, das größte und prunkvollste seiner Zeit, zu sehen. Zuletzt fand am 26. September im Plauenschen Grund das Fest des Saturns statt, das einen Festumzug der Bergmänner, ein üppiges Festbankett, eine Jagd, Vokalmusik und eine italienische Komödie umfasste. August gab ein aufwendiges Buch mit Kupferstichen von diesem Fest in Auftrag. Anschließend fand noch ein „Klopf-Jagen“ statt. Die Feierlichkeiten fanden mit weiteren Aufführungen von Antonio Lottis Oper „Ascanio“ am 24. und 29. September sowie von italienischem Theater am 28. September ein Ende.
Rangordnung und Intrigen prägten auch Augusts Hof, der dazu durch den polnischen Adel ein fast exotisches Flair bekam. Berühmt wurde auch sein Hofnarr und -taschenspieler Joseph Fröhlich.
Ehe, Mätressen und Nachkommen
Am 20. Januar 1693 heiratete er in Bayreuth
- Christiane Eberhardine (* 29. Dezember 1671 in Bayreuth; † 5. September 1727 in Pretzsch), Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth. Sie hatten zusammen nur ein Kind:
- Friedrich August II./August III. (* 17. Oktober 1696 in Dresden; † 5. Oktober 1763 in Dresden), Kurfürst von Sachsen und König von Polen ∞ (am 20. August 1719 in Wien) mit Maria Josefa Benedikta Antonia Theresia Xaveria Philippine (* 8. Dezember 1699 in Wien; † 17. November 1757 in Dresden), Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Ungarn und Böhmen etc.
Dieser folgte seinem Vater auf die Throne von Sachsen und Polen.
Christiane Eberhardine, die protestantisch blieb und daher nie Königin von Polen wurde, sondern in Polen nur die Gemahlin des Königs war, zog sich später, wohl aus Verbitterung über den Übertritt ihres Mannes zum Katholizismus, auf Schloss Pretzsch an der Elbe zurück, wo sie auch starb.
August wurde vor allem bekannt durch seine, zur damaligen Zeit jedoch nicht ungeläufige, Mätressenwirtschaft:
- 1694-1696 mit Gräfin Maria Aurora von Königsmarck
- 1696-1699 mit Gräfin Johanna Theresia (od. Maximiliane?) von Lamberg (geb. Gräfin Hi(es)serle/Esterle und Chodau)
- 1701-1706 mit Fatima, spätere Maria Anna von Spiegel
- 1698-1704 mit Ursula Katharina von Altenbockum, spätere Fürstin von Teschen
- 1704-1713 mit Gräfin Anna Constantia von Brockdorff, spätere Gräfin von Cosel
- 1706-1707 mit Henriette Rénard-Duval (Wirtin, Tochter eines französisch-polnischen Weinhändlers)
- 1708 mit Angélique Duparc (französische Tänzerin und Schauspielerin)
- 1713-1719 mit Maria Magdalena Bielinska (* 1693), verh. Gräfin von Dönhoff, später verh. Fürstin Lubomirska
- 1720-1721 mit Ermuthe Sophie von Dieskau, verh. von Loß
- 1721-1722 mit Freiin Henriette von Osterhausen, verh. von Stanislawski
So wurden ihm von Wilhelmine von Bayreuth die übertriebene Zahl von über „354 Kindern“ angedichtet. Überliefert und von ihm anerkannt sind jedoch diese acht weiteren Nachkommen:
- mit Maria Aurora (* 28. April 1662 in Stade; † 16. Februar 1728 in Quedlinburg), Gräfin von Königsmarck und Pröpstin zu Quedlinburg:
- Hermann Moritz (* 28. Oktober 1696 in Goslar; † 30. November 1750 in Chambord), Graf von Sachsen ∞ (am 12. März 1714 zu Moritzburg; geschieden am 26. März 1721) mit Johanna Victoria Tugendreich (* 8. Februar 1699; † 1747), Gräfin von Löben
- mit Ursula Katharina von Altenbockum (* 25. November 1680 in Warschau; † 4. Mai 1743 in Dresden), Reichsfürstin von Teschen, Herrin von Hoyerswerda, vorm. verh. Fürstin Lubomirska, nachm. verh. Prinzessin von Württemberg-Winnental
- Johann Georg (* 21. August 1704 in Dresden; † 25. Februar 1774 in Dresden), Ritter von Sachsen
- mit Fatima alias Maria Anna, verh. von Spiegel
- Friedrich August (* 19. Juni 1702 in Warschau od. Dresden; † 16. März 1764 in Pillnitz), Graf Rutowski ∞ (am 4. Januar 1739) mit Ludovika Amalia (* 3. Mai 1722; † 27. Juli 1778), Prinzessin Lubomirska
- Maria Anna Katharina (* 1706; † vor 1750), Gräfin Rutowska ∞ (1. 1728, um 1732 geschieden) mit Michał († 22. Mai 1746), Graf Bieliński, Wojewode von Chełmiński; ∞ (2. 1732) mit Claude Marie Noyel (*1700; † 26. Februar 1755), Graf von Bellegarde und Entremont
- mit Anna Constantia von Brockdorff (* 17. Oktober 1680 in Depenau; † 31. März 1765 in Stolpen), vorm. verh. Freiherrin von Hoym, Reichsgräfin von Cosel (mit der ihn zeitweise ein Ehekontrakt verband)
- Augusta Anna Constantia (* 24. Februar 1708; † 3. Februar 1728), Gräfin von Cosel ∞ (am 3. Juni 1725) mit Heinrich Friedrich (* 25. August 1681; † 8. Dezember 1739 in Zette oder Montpellier), Graf von Friesen
- Friederike Alexandrine (* 1709; † 1784), Gräfin von Cosel ∞ (am 18. Februar 1730) mit Johann Xantius Anton († 14. September 1737), Graf Moczynski
- Friedrich August (* 27. August 1712; † 15. Oktober 1770), Graf von Cosel ∞ (am 1. Juni 1749) mit Friederike Christiane (* 1723; † 1793), Gräfin von Holtzendorff
- mit Henriette Renárd/Duval
- Anna Karolina (* 23. November 1707 in Warschau; † 27. September 1769 in Avignon), Gräfin Orzielska ∞ (am 10. August 1730; geschieden 1733) mit Karl Ludwig Friedrich (* 18. September 1690; † 22. September 1774 in Königsberg), Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
- mit Henriette von Osterhausen, verh. von Stanislawski
- Albrecht Siegmund von Zeiguth-Stanislawski (1688 – 1768)
Trivia
Die erste filmische Darstellung des Herrschers erfolgte 1935/1936 in dem Film August der Starke mit Michael Bohnen in der Titelrolle und Lil Dagover als seine Mätresse Aurora von Königsmarck. Regie führte Paul Wegener.
In der Filmreihe Sachsens Glanz und Preußens Gloria wurde er vom Schauspieler Dietrich Körner verkörpert. Außerdem wurde er 1984 in dem Fernsehspiel August der Starke von Gert Fröbe schauspielerisch dargestellt.
Literatur
Sachbücher
- Monika Rosner, Glummie Riday: August der Starke. Eine Biografie für Kinder. Sandstein Verlag, Dresden 2008. ISBN 978-3-940319-31-9
- Heinrich Theodor Flathe: Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 7. Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 781–784.
- Manfred Alexander: Kleine Geschichte Polens. Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-010522-6
- Karl Czok: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Piper, München 2006, ISBN 3-492-24636-2
- Reinhard Delau: August der Starke und seine Mätressen. Edition Sächsische Zeitung, Dresden 2005, ISBN 3-938325-06-2
- Katja Doubek: August der Starke. Rowohlt, Reinbek 2007, ISBN 978-3-499-50688-8
- Alexander Gieysztor u. a.: History of Poland. PSP, Warschau 1979
- Karl C. Gretschel: Geschichte des Sächsischen Volkes und Staates. Verlag Orthaus, Leipzig 1847/62 (Bd. 1–3)
- Reiner Groß (Hrsg.): Sachsen und die Wettiner. Chancen und Realitäten. Kulturakademie, Dresden 1990, ISBN 3-910055-04-4
- Johannes Kalisch u. a. (Hrsg.): Um die polnische Krone Sachsen und Polen während des Nordischen Krieges 1700–1721. Rütten & Loening, Berlin 1962
- Christine Klecker (Hrsg.): August der Starke und seine Zeit. Beiträge des Kolloquiums vom 16./17. September 1994 auf der Festung Königstein. (Saxonia; Bd. 1). Dresdner Druck- und Verlagshaus Dresden 1995.
- Christine Klecker (Hrsg.): Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765. Beiträge der wissenschaftlichen Konferenz vom 26. bis 28. Juni 1997 in Dresden. (Saxonia; Bd. 4/5). Dresdner Druck- und Verlagshaus, Dresden 1998.
- Kühnel, Klaus: August der Starke und das schwache Geschlecht. Die Liebschaften des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen. Dreikastanienverlag, Wittenberg 2005. ISBN 3-933028-92-2.
- Hans-Peter Lühr (Red.): Polen und Sachsen. Zwischen Nähe und Distanz. Geschichtsverein, Dresden 1997, ISBN 3-910055-40-0
- Kurt Milde (Hrsg.): Matthäus Daniel Pöppelmann (1662–1736) und die Architektur der Zeit August des Starken. Verlag der Kunst, Dresden 1991, ISBN 3-364-00192-8
- Georg Piltz: August der Starke. Träume und Taten eines deutschen Fürsten, Biographie. Verlag Neues Leben, Berlin 1994, ISBN 3-355-01422-2
Nekrolog online
- Voltaire: Leben und Thaten Friedrich Augusti II. Des Grossen, Königs von Pohlen – Und Churfürstens zu Sachsen. Frankfurt und Leipzig 1733, 158 Seiten, online.
Belletristik
- Józef Ignacy Kraszewski: König August der Starke. Historischer Roman. Aufbau, Berlin 2005 ISBN 3-7466-1309-4
- Eva Verma: West-östlicher Diwan. In: „…wo du auch herkommst.“ Binationale Paare durch die Jahrtausende. Dipa, Frankfurt 1993 ISBN 3-7638-0196-0 S. 57–67 (über Fatima, auch Tatsachenbericht)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Friedrich I. (HRR) - Barbarossa
Friedrich I., Barbarossa (* um 1122, vielleicht im Kloster Weingarten bei Altdorf; † 10. Juni 1190 im Fluss Saleph nahe Seleucia, Armenisches Königreich von Kilikien) aus dem Adelsgeschlecht der Staufer war von 1147 bis 1152 als Friedrich III. Herzog von Schwaben, von 1152 bis 1190 römisch-deutscher König und von 1155 bis 1190 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.
Den Beinamen „Barbarossa“ („Rotbart“) erhielt er in Italien wegen seines rötlich schimmernden Bartes.
Leben
Geburt
Geburtsjahr und Geburtsort des Staufers sind ungesichert. Die Welfin Judith, so der einzige urkundliche Nachweis, gebar ihr „erstes Kind“ auf einer Burg bei Altdorf, dem heutigen Weingarten. Da es zur damaligen Zeit üblich war, dass die Mütter ihre Kinder in ihrem Stammland zur Welt brachten, liegt es nahe, dass Friedrich in der Heimat seiner Mutter geboren wurde. Allerdings ist nicht gesichert, ob dieses erste Kind tatsächlich Friedrich war, da die Sterblichkeit der Neugeborenen damals sehr hoch war.
Herzog von Schwaben und Zweiter Kreuzzug
Als Sohn des Staufers Friedrich II., des Einäugigen, Herzog von Schwaben, und der Welfin Judith, Tochter Heinrichs des Schwarzen von Bayern, stammte Friedrich von den beiden im Heiligen Römischen Reich seinerzeit dominierenden, miteinander verfeindeten Adelsgeschlechtern ab. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1147 wurde er als Friedrich III. dessen Nachfolger als Herzog von Schwaben. Er scheint die Konzentration seines Vaters auf die staufische Hausmachtpolitik fortgesetzt zu haben, während sich sein Onkel Konrad III. als deutscher König vor allem um die Steigerung der Königsmacht bemühte. In den rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Konrad und den Welfen scheint Friedrich eine neutrale Stellung eingenommen zu haben oder sogar ein Vorgehen Konrads gegen die Welfen behindert zu haben.
Am 27. Dezember 1146 hatte Friedrichs Onkel Konrad III. im Dom zu Speyer seine Teilnahme am Zweiten Kreuzzug erklärt. Auch Friedrich gelobte kurz darauf, sich dem Kreuzzug anzuschließen, obwohl Friedrichs Vater ihm bereits, im Angesicht seines baldigen Todes, die Verwaltung des Herzogtums sowie den Schutz seiner zweiten Frau und ihrer Kinder übertragen hatte. Sein Vater starb im April 1147 und so brach Friedrich nur wenige Tage später als neuer Herzog von Schwaben in das Heilige Land auf. Während des gesamten Kreuzzugs blieb Friedrich als enger Vertrauter König Konrads dicht an dessen Seite. Im September 1148 kehrte er an Konrads Seite von Akkon zunächst nach Konstantinopel zurück, wo man überwinterte. Im Frühling 1149 kehrte Friedrich nach Schwaben zurück.
Die ersten Jahre
Die Umstände der Königswahl
Nach dem plötzlichen Tod Konrads III. am 15. Februar 1152 in Bamberg wurde der Schwabenherzog Friedrich bereits am 4. März 1152 in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt und vom Kölner Erzbischof Arnold II. von Wied am 9. März in der Pfalzkapelle in Aachen gekrönt. Dieser ungewöhnlich schnelle Ablauf wird durch heutige Historiker damit erklärt, dass die Termine bereits von Konrad III. im Vorfeld seines Italienzuges zur Kaiserkrönung in Rom geplant waren, allerdings in der Absicht, seinen eigenen Sohn als Nachfolger wählen und krönen zu lassen - eine Vorgehensweise, die vor größeren Reisen, die mit Gefahren verbunden waren, durchaus zur Sicherung der dynastischen Nachfolge üblich war. Nach dem Bericht Ottos von Freising habe Konrad im Angesicht seines nahenden Todes jedoch entschieden, das Gemeinwohl über das dynastische Erbrecht zu stellen, und seinen Neffen Friedrich anstelle seines eigenen Sohnes Friedrich zur Wahl zu empfehlen. Er befürchtete angeblich, eine Regentschaft seines eigenen erst 6-jährigen Sohnes würde angesichts des herrschenden Konfliktes mit Heinrich dem Löwen nicht den ersehnten Frieden bringen. Ob dies so stimmt, konnte die Forschung bisher nicht klären; für diese Darstellung spricht, dass es Konrad wirklich nicht gelungen war, die Autorität seines Königtums in den 14 Jahren seiner Regentschaft gegen seine welfischen Feinde durchzusetzen, obwohl er im Gegensatz zu seinem minderjährigen Sohn in der Blüte seiner Kraft stand. Allerdings hielten solche Überlegungen Könige in der Regel nicht davon ab, ihre eigenen Söhne zu Nachfolgern küren zu lassen. Giselbert von Mons bietet zudem eine von Ottos Schilderung stark abweichende Darstellung, die aber den Nachteil hat, dass sie erst Ende des 12. Jahrhunderts verfasst wurde.
Strittig ist der Standpunkt, dass Barbarossa die Reichsinsignien auf dem Sterbebett oder kurz vor dessen Tod von Konrad III. erhalten habe. Denn als einzige Quelle für diese Darstellung steht Barbarossa selbst zur Verfügung. Auch die Tatsache, dass Otto von Freising die Königswahl über das Erbkönigtum in seiner Bedeutung stellt, muss kritisch betrachtet werden. Denn in der Regel wurde der Nachfolger, den der König designierte, zwar vom Gremium der Großen gewählt, jedoch handelte es sich dabei meist um den eigenen Sohn. Insofern handelt es sich bei Barbarossas Wahl eher um einen Sonderfall, denn hier wurde ein Königsspross übergangen und direkt der Neffe gewählt. Otto von Freising hat seinen Bericht über die Umstände der Königswahl erst fünf Jahre später niedergeschrieben, als Friedrich bereits fest etabliert und hochgeachtet war. Heutzutage wird unter Historikern eher vermutet, dass Friedrich von Schwaben es mit diplomatischem Geschick verstanden hat, zwischen den an der Wahl beteiligten und zum Teil verfeindeten Fürsten einen Interessenausgleich herzustellen, der aller Interessen, Rang und Ansehen (honor) zufriedenstellend berücksichtigte, wodurch er selbst deren Unterstützung bei seiner Wahl zum König erhielt.
Diese Vermutungen werden gestützt durch Berichte über Treffen während der Thronvakanz zwischen Friedrich und anderen Großen des Reiches. Aus Entscheidungen Friedrichs nach seiner Wahl kann man vermuten, dass hierbei verschiedenen Fürsten Ämter und Ländereien versprochen und sie so zur Unterstützung seiner Thronansprüche bewogen wurden. Dies betraf v.a. Anhänger seines Vetters Heinrich des Löwen, woraus jetzt geschlossen wird, dass er möglicherweise ein weiterer Gegenkandidat war. Unter anderem erhielt ihr gemeinsamer Onkel Welf VI. nach Friedrichs Herrschaftsantritt Titel über verschiedene Herrschaften und dazu Besitz in Italien (die Mathildischen Güter, das Herzogtum Spoleto, die Markgrafschaft Toskana und die Inseln Sardinien und Korsika). Welfs Verbündeter Graf Konrad II. von Dachau erhielt den Titel eines Herzogs von Meranien. Dem Schwager Heinrich des Löwen, Berthold IV. von Zähringen, wurden die Vertretung des Königs als Rektor in Burgund bestätigt und Zusagen für Rechte im Jura. Außerdem erhielt er die Zusicherung Barbarossas, in gemeinsamer Heerfahrt diese Rechte auch durchzusetzen, wenn er sich selbst mit 1.000 Panzerreitern dabei beteiligte. Um sich zuletzt auch noch mit seinem Vetter Heinrich den Löwen zu versöhnen, anstatt seine Regierung durch dessen Feindschaft zu vergiften, erhielt dieser als Lohn für seine Wahlzustimmung das von ihm beanspruchte Herzogtum Bayern mit zeitlicher Verzögerung endgültig 1156, nachdem es den Babenbergern auf dem Hoftag zu Goslar 1154 durch Fürstenspruch entzogen worden war. Der von seinem Halbbruder Konrad III. als Herzog in Bayern eingesetzte Heinrich II. Jasomirgott, der selbst der Königswahl ferngeblieben war, wurde für den Verlust des Herzogtums Bayerns durch die Abtrennung und Erhebung seiner Markgrafschaft Österreich zum eigenständigen Herzogtum entschädigt. So wurde verhindert, dass er wieder ein Vasall des Bayernherzogs wurde und er den Herzogstitel behielt. Außerdem erhielt er zusätzliche Sonderrechte wie die unbeschränkte Erbfolge in weiblicher Linie (s. Privilegium Minus). (Genaueres hierzu weiter unten in: Weitere Entwicklung und strukturelle Veränderungen im Reich). Nach der Kaiserkrönung wurde Herzog Vladislav von Böhmen 1158 als Belohnung für seine Leistungen im 1. Italienzug und als Vorgriff auf zukünftige Dienstleistungen zum König von Böhmen ernannt.
Zudem dürften die Fürsten in Friedrich einen Kandidaten gesehen haben, der durch seine Verwandtschaft mit beiden Häusern den Konflikt zwischen Staufern und Welfen beilegen würde: mütterlicherseits (cognatisch) war er mit den Welfen verwandt, da seine Mutter Judith eine Tochter des Bayernherzogs Heinrich des Schwarzen und Schwester Welfs VI. war; väterlicherseits war er ein Staufer, nämlich ein Neffe von Konrad III., sowie ein Neffe von Heinrich II. Jasomirgott und des Bischofs Otto von Freising. Von daher bezeichnet ihn Otto von Freising auch als den Eckstein: „lapis angularis“.
Aus der von Wibald, Abt von Stablo-Malmedy und Corvey, verfassten Wahlanzeige an Papst Eugen III. geht die Programmatik Barbarossas hervor: Oberstes Prinzip war die Wiederherstellung der Privilegien der Kirche und der Erhabenheit des Reiches (honor imperii und sacrum imperium). Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen neuen Gedanken. Passagen der Wahlanzeige finden sich nahezu gleichlautend auch in Diplomen Konrads III. und in einem päpstlichen Mahnschreiben vom Januar 1152.
Erste Schritte in der Reichspolitik
Zunächst konzentrierte Friedrich sich auf die Befriedung des Reiches und stellte die Bewerbung um die Kaiserkrone zurück. Einen ersten Hoftag hielt Friedrich nach Ostern 1152 in Dortmund, wobei der Kölner Erzbischof Arnold II., Sachsenherzog Heinrich der Löwe, Herzog Welf VI. und Albrecht der Bär anwesend waren. Der König präsentierte sich hier erstmals als Herrscher im sächsischen Teil des Reiches. Ein weiterer Hoftag wurde im Juni desselben Jahres während des Königsumritts nach Merseburg einberufen. Auf ihm wurde der Konflikt zwischen dem Bremer Erzbischof Hartwig und Heinrich dem Löwen verhandelt, bei dem es um die Erbschaft der Grafschaft Stade sowie das Recht zur Bistumsgründung an der Ostseeküste ging. Erst auf dem Hoftag von Goslar 1154 wurde endgültig vereinbart, dass Heinrich in seinem Herrschaftsbereich Bistümer einrichten durfte. In Merseburg entschied Barbarossa auch den dänischen Thronfolgestreit zu Gunsten Svens III. und gegen Knut, der mit den Welfen verbündet war. Das bedeutendste Problem der Reichspolitik, der Konflikt zwischen Heinrich dem Löwen und Heinrich Jasomirgott um das Herzogtum Bayern, wurde zwar angesprochen, aber noch nicht gelöst. Dadurch wurde die Expansion der Welfen in den norddeutschen Raum umgeleitet.
Auf Merseburg folgte Regensburg als nächste größere Station des Umritts. Dort empfing Friedrich die Huldigung des bayerischen Adels und rief zu einem Feldzug gegen Ungarn auf, den die Fürsten aber durch Verweigerung ihrer Gefolgschaft verhinderten. Vermutlich wollte der König durch diesen Feldzug die Babenberger in ihrem Kampf gegen die Welfen in Bayern entlasten, weshalb diese Verweigerung heutzutage auch als deutliche Stellungnahme gegen den babenbergerfreundlichen Kurs seines Onkels Konrad III. und Aufforderung zu einem Ausgleich mit den Welfen gedeutet wird.
Vorbereitung auf die Kaiserkrönung
Im Oktober 1152 setzte Barbarossa auf dem Hoftag in Würzburg den Herbst 1154 als Termin für seine Romfahrt fest. Die Wahl eines so späten Termins wird meist damit erklärt, dass Barbarossa zuvor den Streit um die bayerische Herzogswürde zwischen Babenbergern und Welfen klären wollte. Nach der Bekanntgabe des Termins für die Romfahrt begannen Verhandlungen zwischen Barbarossa und der römischen Kurie, um die Bedingungen für die Kaiserkrönung festzulegen. Ergebnis war der Vertrag von Konstanz, so benannt nach dem Ort seiner Beeidung durch Friedrich im März 1153. In ihm versprach Barbarossa, die aufständische Römische Kommune zu unterwerfen, die Stadt wieder der Herrschaft des Papstes zu übergeben und ohne päpstliche Zustimmung keinen Frieden mit Römern oder Normannen zu schließen, für den Papst die Herrschaft über die römische Kirche wieder herzustellen und zu sichern sowie byzantinischen Besitzansprüchen in Italien entgegen zu treten. Im Gegenzug versprach der Papst, Friedrich zum Kaiser zu krönen und ihn bei der Herrschaftsausübung zu unterstützen, den Bann gegen Umstürzler im Reich zu verhängen und sich an der Vertreibung der Byzantiner aus Italien zu beteiligen. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen erreichte Friedrich I. darüber hinaus, dass der Papst den Erzbischof von Mainz sowie die Bischöfe von Minden, Hildesheim und Eichstätt, die der welfischen Seite nahe standen, gegen ihm genehme Amtsinhaber austauschte.
Im September 1153 nahm Barbarossa trotz der Bedingungen des Konstanzer Vertrags die seit dem Tod Konrads III. ruhenden Bündnisverhandlungen mit Byzanz wieder auf. Der König bot an, eine byzantinische Prinzessin zu heiraten. Bald gerieten die Verhandlungen ins Stocken. Am 9. Mai 1154 reiste Anselm von Havelberg nach Byzanz ab, um ein mögliches Bündnis zu retten. Allerdings kehrte er frühestens Mitte 1155 zurück, so dass das Verhältnis zu Byzanz noch ungeklärt war, als Barbarossa sich auf den Weg nach Rom machte.
Im Juni 1154 berief Friedrich I. einen Hoftag nach Goslar. Heinrich der Löwe erhielt während dieser Versammlung das Investiturrecht für Bischöfe in seinen Territorien an der Ostsee, auch in der Frage des Herzogtums Bayern sprach sich Barbarossa für Heinrich aus, ohne den Konflikt allerdings endgültig zu lösen.
Die erste Romfahrt
Im Oktober 1154 setzte sich das Heer zur Romfahrt in Bewegung. Inzwischen hatte sich die Lage in Süditalien aber geändert, da Roger II. im Februar gestorben war. Sein Sohn Wilhelm I. wurde vom neuen Papst Hadrian IV. nicht anerkannt, bemühte sich aber dennoch um Verhandlungen mit der Kurie. Hadrian wiederum fürchtete eine byzantinische Invasion in Italien und wies Friedrich I. mit Nachdruck auf den Konstanzer Vertrag hin. Darüber hinaus befand sich Hadrian im verschärften Konflikt mit dem Senat der Stadt Rom. Friedrich und Hadrian trafen erstmals in Sutri zusammen, wo sich der deutsche König allerdings weigerte, dem Papst den traditionellen Stratordienst zu erweisen, also sein Pferd am Zügel zu führen. Es hat allerdings den Anschein, dass dieser Konflikt schnell beigelegt wurde. Auf dem gemeinsamen Weg nach Rom trafen König und Papst auf eine Abordnung des Senats, der die Anerkennung der erneut aufgestellten städtischen Verfassung sowie die Zahlung von 5000 Pfund Gold forderte und zudem die Ansicht vertrat, dass der künftige Kaiser seine Krone von der Stadt Rom empfange. Trotz der Verlockung, auf diese Weise vom Papsttum unabhängig zu werden, wies der König diese Forderungen entschieden zurück, da damals ohne päpstliche Anerkennung ein erheblicher Legitimitätsverlust des Kaisertums zu befürchten war. Daraufhin verschloss die eigentliche Stadt Rom, die außerhalb des Vatikans lag, ihre Tore vor König und Papst.
Am 18. Juni 1155 krönte Hadrian IV. Barbarossa im Petersdom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Direkt nach der Krönung kam es zu einem Aufstand der stadtrömischen Bevölkerung, die den Papst gefangen setzen wollte. Bis in die Nacht kämpften kaiserliche und päpstliche Truppen gegen die Römer. Nachdem Ruhe eingekehrt war, ging Barbarossa, entgegen dem Konstanzer Vertrag, nicht gegen die Stadtbevölkerung vor und stellte auch die Herrschaft des Papstes über die Stadt nicht wieder her. Ein Zug gegen die Normannen auf Sizilien blieb ebenfalls aus. Zwar hatten auch byzantinische Gesandte, mit denen Barbarossa kurz nach der Krönung in Ancona über Heirats- und Bündnispläne verhandelte, dies gefordert. Die Fürsten im Gefolge des Kaisers weigerten sich jedoch, an einem Feldzug teilzunehmen. Auch die weiteren Gespräche mit den Byzantinern scheinen erfolglos geblieben zu sein, denn der oströmische Kaiser nahm mit den Aufständischen in Apulien Kontakt auf und bemühte sich nicht mehr um weitere Verhandlungen mit Friedrich I.
Durch den Bruch des Konstanzer Vertrags kam es zu einer Entfremdung zwischen Papsttum und Kaisertum, die zu einem Anlass für die folgenden Auseinandersetzungen wurde. Zudem verschlechterten sich aus Friedrichs Sicht auch die äußeren Bedingungen in Italien. Mit byzantinischer Hilfe griff der apulische Aufstand immer weiter um sich. Die Normannen schlugen sich erfolgreich gegen die Byzantiner und nahmen ihnen das kurz zuvor eroberte Brindisi wieder ab. Angesichts dieser Entwicklung schloss Hadrian IV. 1156 den Vertrag von Benevent mit den Normannen. In den folgenden Jahren bewährten sich die Normannen als weltliche Schutzmacht des Papstes, vor allem im Konflikt mit der Stadt Rom, und stellten so die Position des Kaisers in Frage. Damit stellte der Vertrag von Benevent einen wichtigen Schritt im Loslösungsprozess kaiserlicher und päpstlicher Herrschaft voneinander dar.
Weitere Entwicklung und strukturelle Veränderungen im Reich
Nach der Vorentscheidung in der Frage der bayerischen Herzogswürde zu Gunsten Heinrichs des Löwen in Goslar begann Friedrich im September 1155 mit Heinrich Jasomirgott über eine Entschädigung für den Verlust Bayerns zu verhandeln. Als es zu keiner Einigung kam, ließ Barbarossa im Oktober in Regensburg die bayerischen Großen einen Treueid auf Heinrich den Löwen schwören. Formell blieb das Herzogtum noch bis zum 8. September 1156 in Babenberger Hand. Als Heinrich Jasomirgott auch dann die Herrschaft nicht aufgeben wollte, scheint um das Pfingstfest 1156 herum ein Kompromiss ausgehandelt worden zu sein, der im September im Privilegium minus festgeschrieben wurde: Die Babenberger behielten die Herzogswürde, mussten sich aber auf die ehemalige Markgrafschaft Österreich beschränken, während Heinrich d. Löwe das restliche Bayern erhielt. Damit wurde der Grundstein für die Entwicklung Österreichs als eigenständiges Territorium gelegt.
Vor dem 2. März 1147 hatte Friedrich in Eger Adela von Vohburg geheiratet, die Tochter des Markgrafen Diepold III. von Vohburg und Cham und Erbin des Egerlandes. Die kinderlose Ehe wurde im März 1153 in Konstanz annulliert, was ihn nicht daran hinderte, das Egerland seinem Vetter Friedrich von Rothenburg zu geben (Adelheid heiratete den welfischen Ministerialen Dieto von Ravensburg, 1152/1180 bezeugt). Am 17. Juni 1156 heiratete Friedrich I. in Würzburg in zweiter Ehe die minderjährige Beatrix von Burgund (* 1140, † 15. November 1184 in Jouhe bei Dole, Tochter des Grafen Rainald III. und seit diesem Jahr Erbin der Freigrafschaft Burgund (heute Franche-Comté). Diese Heirat und Erwerbung brachten dem Kaiser im gleichen Jahr den Titel eines Grafen von Burgund ein und ermöglichten ihm einen leichteren Alpenübergang im Westen, steigerten jedoch seinen Einfluss in dieser Region kaum. Seine und Beatrix' Krönung zum König von Burgund erfolgte erst am 30. Juli 1178 in Arles (er) bzw. im August 1178 in Vienne (sie). Dadurch wurde der Ausgleich mit den Zähringern hinfällig, die ihre Ambitionen schwinden sahen, als Rektor von Burgund diese Region in Vertretung des Königs beherrschen zu können.
In dieser Phase veränderte Barbarossa die Herrschaftsstrukturen im gesamten Reich. So wurde nach dem Hoftag von Roncaglia mit dem Fodrum erstmals eine regelmäßige Reichssteuer erhoben, die der italienische Adel entrichten musste. Zusammen mit den Zahlungen der italienischen Städte gab diese Entwicklung der stärker werdenden Geldwirtschaft einen bedeutenden Schub. Auch die Heeresstruktur wandelte sich. Neben die durch ihren Lehnseid verpflichteten adligen Kämpfer traten zunehmend Söldner. Die Reichsstruktur wandelte er durch Teilung der alten Amtsherzogtümer in verkleinerte Territorien eher lehnsrechtlicher Prägung um, wobei er für zuvor eher herrschaftslose Räume auch neue Territorialherzogtümer schuf; daneben stärkte Barbarossa die königliche Macht vor allem durch die Ausdehnung und Verdichtung des Reichsguts in Thüringen, Franken und Schwaben zu königlichen Territorien und Reichsländern, die er durch Reichsministeriale verwalten ließ, wozu auch die Gründung einer Vielzahl von Städten wie Göppingen, Pegau und Chemnitz sowie neue Reichspfalzen wie Hagenau, Kaiserslautern, Bad Wimpfen, Gelnhausen und die Renovierung älterer Anlagen wie Ingelheim, Kaiserswerth oder Nimwegen gehört.
Die Italienpolitik Friedrichs I.
Verschärfter Konflikt mit dem Papsttum
Der erste Zug nach Italien 1154/55 sollte nicht nur dazu dienen, die Kaiserkrone zu erlangen, sondern verfolgte wie die fünf darauf folgenden Züge auch die Absicht, die unumstrittene Herrschaft über Reichsitalien, insbesondere über die lombardischen Städte, zu sichern. Ziel war es, den honor imperii zu wahren, was stark verkürzt ausgedrückt die Herrschaftsrechte des Kaisers bedeutete. Dazu passt auch, dass der Begriff Sacrum Imperium (geheiligtes Reich) 1157 im Gegensatz zur „sanctae ecclesiae“ (heilige Kirche) in der staufischen Kanzlei geboren wurde. Damit sollte klar gestellt werden, dass das sacrum imperium aus sich heraus heilig ist, während die Kirche lediglich erst heilig gemacht wurde.
Vor dem eigentlichen Zug ging es für Friedrich zunächst darum, Verbündete zu sammeln. So bemühte er sich um eine Verbesserung des Verhältnisses zu den nach Österreich zurückgedrängten Babenbergern, indem er im Sommer 1157 durch einen Feldzug versuchte, den mit ihnen verschwägerten Wladislaw II. auf den polnischen Herzogsthron zurückzuführen, was aber misslang. Im Januar 1158 erhob er Herzog Vladislav II. von Böhmen, ebenfalls mit den Babenbergern verwandt, zum König. Das Wohlwollen des Erzbischofs von Bremen sicherte sich Barbarossa, indem er zu seinen Gunsten gegen das vom Papst beförderte und in Konkurrenz zu Bremen um das Primat über die nordische Kirche stehende Erzbistum Lund vorging und nach der Gefangennahme Erzbischof Eskils auf seiner Heimreise von Rom durch Burgund nichts zu dessen Befreiung unternahm. Gleichzeitig versuchte er damit Einfluss auf den dänischen Erbfolgestreit zu nehmen.
Für Oktober 1157 berief Barbarossa einen Hoftag nach Besançon ein, vor allem um seinen Herrschaftsanspruch in Burgund zu unterstreichen. Dort forderten zwei päpstliche Legaten die Freilassung Eskils aus der Gefangenschaft kaiserlicher Parteigänger. Zu einem Eklat führte eine eher beiläufige Bemerkung in dem entsprechenden Brief Hadrians IV., in der das Kaisertum als beneficium bezeichnet wurde. Dies konnte mit Lehen oder Wohltat übersetzt werden. Rainald von Dassel, seit 1156 Reichskanzler und einer der engsten Vertrauten Friedrichs, übersetzte es mit Lehen, wobei allerdings auch die anwesenden päpstlichen Gesandten keinen Einspruch erhoben. Der Begriff beneficium bezeichnet jedoch nicht nur den aktuellen Gegenstand, das Lehen an sich - dieses wird normalerweise feodum genannt -, sondern auch die damit verbundene Rechtsbeziehung. Für diejenigen Anwesenden, die das Latein der päpstlichen Legaten verstanden, musste es sich also so anhören, als sei das Kaisertum als Lehen und Kaiser Friedrich Barbarossa als Lehnsmann des Papstes bezeichnet worden. In den darauffolgenden tumultartigen Szenen konnte nur durch das persönliche Eingreifen Barbarossas, der den mit dem gezückten Schwert auf den päpstlichen Legaten Kardinal Roland eindringenden bayerischen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach zurückhielt, noch schlimmeres verhindert werden.
Als darauf das Gepäck der Legaten durchsucht wurde, fanden sich zahlreiche vorgefertigte Privilegien an den deutschen Episkopat, mit deren Ausstellung offenbar die Kirchenhoheit des Kaisers zu Gunsten des Papstes unterlaufen werden sollte. Diese beiden Provokationen des Papstes wurden darauf zu Angriffspunkten einer Propagandakampagne, in der Friedrich die Unterstützung eines Großteils des deutschen Episkopats gewann. Die deutschen Bischöfe untersagten dem gesamten Klerus die Appellation an die römische Kurie. Damit sollte der Einfluss des Papstes beschnitten werden, was sowohl dem König, als auch den Bischöfen in ihren Bestrebungen nach Unabhängigkeit von Rom entgegen kam. Am Ausgreifen der anti-päpstlichen Stimmung änderte auch eine Erklärung Papst Hadrians IV. im Juni 1158 nichts, dass er nicht Lehen, sondern Wohltat gemeint habe (Beneficium: non feudum, sed bonum factum). Ebenso wenig konnte der Papst durch eine Kontaktaufnahme mit Heinrich dem Löwen den Italienzug verhindern.
Der zweite Italienzug
Im September 1158 schlug das Heer Friedrichs I. Mailand, im November berief er auf den Ronkalischen Feldern einen Hoftag ein, der die Verwaltung Italiens regeln sollte. Der Kaiser ließ eine Kommission aus Rechtsgelehrten der Universität Bologna (die für ihre Juristen berühmt war) die so genannten Ronkalischen Gesetze ausarbeiten. Dabei wurde größtenteils das römische Recht als Vorlage verwendet und dem Kaiserrecht Vorrang vor dem ius commune gegeben. Die Kommunen mussten sich danach ihre Regalien vom Kaiser bestätigen lassen, was Anlass für die spätere Empörung mehrerer Städte war. Der Hoftag gilt als Beginn einer strukturierten Italienpolitik Barbarossas.
Auf dem Hoftag und in der darauf folgenden Winterpause prallten die Staatsvorstellungen von Kaiser und Papst aufeinander: Nachdem Friedrich die Verwaltungsstruktur auch auf die vom Papst beanspruchten Territorien Italiens, insbesondere auf verschiedene Bistümer und die Mathildischen Güter, ausgedehnt und Verhandlungen mit der Stadt Rom aufgenommen hatte, erschien im Frühjahr 1159 eine päpstliche Delegation am Hof, um eine Rücknahme dieser Regelungen einzufordern. Barbarossa lehnte mit der Begründung ab, dass die Bischöfe nicht über eigene Territorien verfügten, sondern sich ihre Pfalzen auf Grund und Boden des Reiches befänden, über den er als Kaiser die Hoheit besitze. Gleichzeitig nahm der Papst Verhandlungen mit Mailand auf, das erneut einen Feldzug gegen den Kaiser vorbereitete, während Barbarossa parallel zur päpstlichen Gesandtschaft eine Abordnung der Stadt Rom empfing.
Das Schisma
Zu Hadrian schickte Friedrich Pfalzgraf Otto von Wittelsbach. Bevor dieser aber in Rom aktiv werden konnte, starb Hadrian IV. am 1. September 1159. Die Wahlversammlung der Kardinäle war gespalten, so dass nach der Wahl Roland Bandinelli als Alexander III. für die „italienische“ und Viktor IV. für die kaiserliche Seite das Papstamt beanspruchten. Alexander wurde von der Mehrzahl der Kardinäle unterstützt, während Viktor vom römischen Volk zum Papst ausgerufen worden war. Friedrich berief 1160 ein Konzil nach Pavia ein, um die Papstfrage zu klären. Diese Aktion verlief im Rahmen der von Friedrich formulierten Kaiseridee, die teils an spätantikes Rechtsgut, stärker aber noch an die Tradition der salischen Kaiser anzuknüpfen versuchte, wonach der Kaiser Vogt der Kirche war und strittige Papstwahlen zu entscheiden hatte. Allerdings war zu dieser Zeit das Recht des Kaisers zur Einberufung eines Konzils bereits umstritten. Gleichzeitig schickte Alexander Schreiben in die gesamte vom Christentum erfasste Welt, um für seinen Anspruch auf das Amt zu werben. Im Februar 1160 trat das Konzil im Dom von Pavia zusammen. Unterstützer Alexanders waren allerdings nicht zugelassen, so dass Viktor erwartungsgemäß bestätigt wurde. Insgesamt wurde der Beschluss in der westlichen Welt wegen der geringen Teilnehmerzahl kaum beachtet. Vor allem der italienische und der französische Klerus, aber auch ein Teil des deutschen erkannte das Konzil und damit Viktor nicht an.
Das Schisma wirkte sich auch außerhalb des Reichs aus, vor allem in England und Frankreich. Noch 1159 lud Friedrich Heinrich II. und Ludwig VII. zur gemeinsamen Lösung der Papstfrage ein, wobei er die Anerkennung Viktors durchzusetzen versuchte. Diese Versuche scheiterten, als beide Könige offiziell Alexander anerkannten.
Unterdessen gingen die militärischen Auseinandersetzungen in Italien weiter. Nachdem Mailand im März 1162 erneut kapituliert hatte und zerstört worden war, stand Friedrich auf dem Höhepunkt seiner militärischen Macht in Italien. Aus dieser günstigen Lage heraus plante er einen Feldzug nach Sizilien, um einen dortigen Adelsaufstand auszunutzen. Im Juni wurden die Vorbereitungen jedoch abgebrochen, nachdem der normannische König die Adligen besiegt und Kämpfe zwischen Pisa und Genua die benötigte Flotte gebunden hatten.
Nun zielte Friedrich mit seinen diplomatischen Bemühungen verstärkt auf Frankreich. Ziel waren ein Freundschaftsvertrag und weiterhin die Anerkennung Viktors gegen den nach Frankreich geflohenen Alexander. Man vereinbarte für August 1162 ein Treffen zwischen Kaiser, König und beiden Päpsten auf der Brücke über die Saône in Saint-Jean-de-Losne. Sollte ein Papst nicht anwesend sein, würde der andere als rechtmäßiger Amtsinhaber anerkannt werden. Alexander weigerte sich, an dem Treffen teilzunehmen, worauf Ludwig VII. einen Aufschub erbat. Friedrich berief ein Konzil zum Ort des geplanten Treffens ein, worauf Ludwig sich als von seinen Zusagen entbunden ansah. Auf dem Konzil setzte sich Friedrich mit seiner Parteinahme für Viktor IV. nicht durch. Es gilt als eine der größten politischen Niederlagen Barbarossas.
Als Viktor IV. im April 1164 starb, schien das Schisma zunächst beendet zu sein. Rainald von Dassel ließ jedoch bereits zwei Tage später ohne das Wissen Friedrichs I. in Lucca den Kardinal Wido von Crema unter dem Namen Paschalis III. zum Papst wählen. Dieser Schritt rief massiven Widerstand hervor, vor allem in Oberitalien durch den neu gegründeten Veroneser Bund, aber zunehmend auch in Deutschland. Zahlreiche deutsche Bischöfe und Geistliche, insbesondere in Burgund, erkannten Alexander III. an. Der wichtigste unter ihnen war Rudolf von Zähringen, der bereits 1162 ein Bündnis mit Ludwig VII. geschlossen hatte. Grund war die Tatsache, dass seinem Bruder Berthold IV. umfangreiche Rechte in Burgund entzogen und ihm die Ernennung zum Mainzer Erzbischof verweigert worden war.
Auf die zunehmend kritische Lage reagierte Friedrich I. mit verstärkten diplomatischen Bemühungen. Im Zentrum stand dabei ein Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems, gemeinsam mit dem französischen und dem englischen König. Dadurch sollte der Graben zwischen den christlichen Königreichen geschlossen und zugleich das Verhältnis zu Alexander entspannt werden. Rainald von Dassel reiste nach Ostern 1165 an den englischen Hof in Rouen und handelte dort die Verheiratung zweier Töchter Heinrichs II. mit einem Sohn Barbarossas und Heinrich dem Löwen aus. Der weitere Verlauf der Verhandlungen entwickelte sich aber unerwartet: Rainald reiste weiter auf die britischen Inseln und überzeugte Heinrich II. dort, Alexander abzuschwören und Paschalis III. anzuerkennen. Grund für dieses Umschwenken war der Streit Heinrichs mit Thomas Becket.
Direkt nach seiner Englandreise erreichte Rainald auf einer Reichsversammlung in Würzburg die Ablegung der Würzburger Eide: Friedrich und zahlreiche Fürsten und Bischöfe, aber keineswegs alle, schworen, niemals Alexander III. oder seinen eventuellen Nachfolger als Papst anzuerkennen. Hintergrund war das erhoffte gemeinsame Vorgehen gegen den Papst mit England. Im Rahmen der Versammlung setzte Barbarossa den Mainzer Erzbischof Konrad von Wittelsbach ab. Anschließend versuchte er in der Region um Salzburg, in der Alexander Rückhalt hatte, seine Position durchzusetzen.
Parallel zur politischen Auseinandersetzung versuchte Barbarossa dem deutschen Reichsteil zusätzliches theologisches Format zu verleihen. 1164 wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln überführt. Weihnachten 1165 wurde Karl der Große in Aachen heilig gesprochen, um so durch einen Reichsheiligen eine bessere Legitimationsbasis zu erhalten, zumal Karl auch in der Kaiseridee Friedrichs eine wichtige Rolle spielte. Allerdings kam diesem Akt außerhalb des Reiches wenig Bedeutung zu.
Indessen entfalteten die Würzburger Eide kaum Wirkung. Auch Heinrich II. von England ging nicht aktiv gegen Alexander vor, zumal er nach der Ermordung Thomas Beckets (für die Heinrich wenigstens teilweise verantwortlich gemacht wurde) dringend auf die Unterstützung Alexanders III. angewiesen war, der mehrheitlich vom englischen Episkopat unterstützt worden war.
Im Mai 1166 starb Wilhelm I. von Sizilien. Die Nachfolgekämpfe machten die Normannen weitgehend handlungsunfähig, so dass Alexander III. nicht auf ihre Hilfe rechnen konnte. Diese Lage nutzte Friedrich und startete zu seinem vierten Italienzug, für den er auf einem Hoftag in Ulm (März 1166) bereits (durch die Lösung der Tübinger Fehde) einen Großteil der deutschen Mächtigen verpflichtet hatte. Rainald von Dassel und Erzbischof Christian von Mainz zogen mit einem Heer im Westen der italienischen Halbinsel gegen Rom und besiegten das städtische Aufgebot in der Schlacht von Tusculum, während Barbarossa Ancona belagerte, schließlich einnahm und bis nach Apulien vordrang. Danach wandte er sich ebenfalls Rom zu, das er im Juli 1167 eroberte. Paschalis krönte die Kaiserin im Petersdom, Alexander III. floh als Pilger verkleidet nach Benevent. In dieser Lage brach im Heer eine heftige Seuche (vermutlich Malaria) aus, der wichtige Persönlichkeiten wie Herzog Friedrich von Schwaben (Rothenburg), Sohn König Konrads, Welf VII., Sohn Herzog Welf VI., sowie Erzbischof Rainald von Köln und viele weitere Adlige zum Opfer fielen. Friedrich konnte nur Reste der Streitmacht nach Deutschland zurückführen.
Die norditalienischen Städte nutzten die Niederlage des Kaisers aus. Schon 1167 hatten sie sich zum papsttreuen Lombardenbund zusammengeschlossen, der nun massiv von Byzanz und den Normannen bezuschusst wurde.
In Deutschland hatte die Niederlage von 1167 zur Folge, dass Barbarossa zahlreiche Territorien von Gefallenen und an der Seuche Gestorbenen selbst übernahm, insbesondere die herzoglichen welfischen Hausgüter in Oberschwaben, nachdem die versprochenen Zahlungen Heinrich d. Löwen an seinen Onkel Welf ausblieben. So entstand ein staufischer bzw. königlicher Territorialgürtel zwischen dem welfischen Baiern und den zähringischen Gebieten um Freiburg. Durch die Verleihung der rheinischen Pfalzgrafschaft einschließlich der Überlassung vieler alter salischer Erbgüter an seinen Halbbruder Konrad, das Ausspielen der Erzbistümer Trier und Mainz gegeneinander sowie den geschickten Einsatz der Königsgüter in der Region hatte Barbarossa bereits seit 1156 im Mittelrhein-Mosel-Gebiet und in den angrenzenden hessischen Regionen seinen Einfluss vergrößert. Auch in der Wetterau um Gelnhausen und Friedberg errichtete er ein Reichsland. Ein weiterer reichspolitischer Schritt dieser Zeit war die Erteilung der Goldenen Freiheit für das Bistum Würzburg von 1168, in der der Bischof mit herzoglicher Gewalt ausgestattet, sein Territorium jedoch nicht in ein Herzogtum umgewandelt wurde. Der Bischof von Würzburg erhielt damals den Titel eines Herzogs von Franken.
Ausgleich mit dem Papst und den Kommunen
In dieser Situation verstärkte Friedrich die Verhandlungen mit Alexander III. Dennoch wurde nach dem Tod Paschalis' III. im Herbst 1168 mit Calixt III. erneut ein Gegenpapst gewählt. Gleichzeitig bereitete sich Barbarossa auf eine Einigung mit Alexander vor: Zu Pfingsten 1169 wurde sein zweitgeborener Sohn Heinrich in einem Wahlakt als Nachfolger im Amt des deutschen Königs bestimmt. Vermutlich sollte er Alexander anerkennen, während Friedrich auf seiner ablehnenden Position verharrte, um so bei einem Thronwechsel eine Einigung zu erreichen. Zusätzlich versuchte Friedrich, den französischen und englischen Hof als Unterhändler zwischen ihm und dem Papst zu gewinnen.
Allerdings verfolgte Barbarossa nicht nur eine Entspannungspolitik, sondern setzte weiterhin auch auf Konfrontation. Mit einer im März 1172 erhobenen Klage warf er dem Lombardenbund und Anhängern Alexanders vor, das römische Kaisertum auf Byzanz übertragen zu wollen. Dies nutzte er als Anlass für den fünften Italienzug, der 1174 nicht gegen Rom, sondern ausschließlich gegen die oberitalienischen Städte gerichtet war. Allerdings reichte das kaiserliche Heer nicht aus, um wirksame militärische Erfolge zu erzielen. Eine Belagerung Alessandrias blieb erfolglos. 1175 gab es Friedensverhandlungen in Montebello, die mit einem Friedensschluss zwischen Kaiser und Lombardenbund endeten. Die Städte unterwarfen sich zwar formal, Entscheidungen wurden aber von einer paritätischen Schiedskommission getroffen. Die Einigung war jedoch nicht von Dauer, denn Barbarossa verlangte die Zerstörung Alessandrias und die Städte forderten, dass der Papst in die Verhandlungen einbezogen würde.
Im Herbst 1175 bat Friedrich um frische Truppen aus Deutschland. Vor allem Heinrich der Löwe als mächtigster Fürst und Herrscher über das nahe gelegene Bayern weigerte sich aber, diese zu schicken. Er hatte in Chiavenna zur Bedingung gemacht, dass ihm Goslar mit dessen ergiebigen Silberminen überlassen werden sollte. In der Schlacht von Legnano am 29. Mai 1176 unterlag der Kaiser schließlich. Er musste Frieden mit den Städten schließen und ihrer De-facto-Autonomie zustimmen.
Nach zisterziensischer Vermittlung schickte Barbarossa im Herbst 1176 eine Gesandtschaft zu Alexander III., die in Anagni einen Sonderfrieden aushandeln sollte. Der Papst wollte jedoch nur ein Abkommen zwischen allen Beteiligten schließen, das neben dem Lombardenbund auch die übrigen italienischen Städte, Sizilien und Byzanz umfassen sollte. Zumindest die Forderung nach der Einbeziehung Byzanz' ließ die Kurie jedoch schnell wieder fallen, nachdem Manuel I. 1176 eine Niederlage gegen die Moslems erlitten hatte und dadurch zu geschwächt war, um für Alexander von Nutzen sein zu können. Am Ende der Verhandlungen stand dennoch die gegenseitige Anerkennung von Papst und Kaiser, also die Rücknahme der Würzburger Eide sowie der Bannung Barbarossas. Der Kaiser sagte einen Rückzug aus dem vom Papst beanspruchten Territorium sowie die Rückgabe der Mathildischen Güter zu. Alexander III. sagte zu, dass von Schismatikern erteilte Ordinationen Gültigkeit behalten sollten.
Diese Vereinbarungen umfassten allerdings weder die Städte noch Sizilien. Mit diesen Parteien wurde in Chioggia weiter verhandelt. In diesen Verhandlungen gelang es Barbarossa, den Papst zur Aufgabe einiger seiner Territorialforderungen aus dem Abkommen von Anagni zu bewegen. So sollte der Kaiser für die Mathildischen Güter 15 Jahre lang das Nutzungsrecht behalten und die Frage, ob ein Territorium zum päpstlichen Besitz gehörte, sollte von Fall zu Fall von einer Schiedsrichterinstanz geregelt werden. Im Gegenzug sagte Friedrich I. dem Lombardenbund einen sechs und Wilhelm II. von Sizilien 15 Jahre dauernden Waffenstillstand zu. In Venedig trafen sich Kaiser und Papst 1177 persönlich, um das Abkommen zu beeiden.
Die staatsrechtliche Bedeutung des Friedensschlusses ist historisch umstritten. Einerseits musste der Kaiser von seinen Maximalansprüchen, die eine Weiterentwicklung der Umstände zu Zeiten Heinrich III. bedeutet hätten, große Abstriche vornehmen. Die Trennung zwischen dem italienischen und dem deutschen Reichsteil wurde vergrößert. Die Frage danach, ob der Papst oder der Kaiser über die größere Herrschaftsautorität verfüge, blieb ungeklärt, obwohl der Papst gestärkt und der Kaiser geschwächt aus den Auseinandersetzungen hervorging. Vor allem der kaiserliche Herrschaftsanspruch über Rom war de facto nahezu aufgehoben worden. Andererseits wurde deutlich, dass auch der Papst sehr an einer Einigung mit dem Kaiser interessiert war, wodurch die Position dessen lombardischer Verbündeter in den nachfolgenden Friedensverhandlungen geschwächt war.
Nach dem Auslaufen des Waffenstillstands von Venedig schlossen Barbarossa und der Lombardenbund 1183 den Frieden von Konstanz. Der Kaiser musste zwar viele Forderungen den Städten gegenüber aufgeben, band dafür aber den Lombardenbund fest in die Strukturen des Reiches ein. Er wurde eine Art vom Kaiser legitimierter Interessenverband der oberitalienischen Städte. Es gelang ihm, die Regalien in regelmäßige Geldzahlungen der Städte umzuwandeln, wodurch die kaiserlichen Rechte zwar weit unter das frühere Niveau zur Salierzeit hinabsanken, er aber dennoch an ihrem Reichtum partizipierte und eine größere Machtposition einnahm, als sie Konrad III. innehatte. Die lombardischen Städte erhielten das Recht, ihre Konsuln zu wählen, die aber alle fünf Jahre vom Kaiser erneut eingesetzt werden mussten. In den Jahren nach den Friedensschlüssen begann sich die Toskana zum neuen städtischen Machtzentrum in Italien zu entwickeln. Das Kaisertum begann als Ersatz für die erlittenen Verluste in der Lombardei nun mehr in Mittelitalien seine Machtpositionen aufzubauen.
Wie sehr beide Seiten damals mit dem gefundenen Kompromiss zufrieden waren, erkennt man daran, dass Ende Januar 1186, auf dem sechsten und letzten Italienzug des Kaisers, Barbarossas Sohn Heinrich VI. Konstanze, die Tante Wilhelms II. von Sizilien, in Mailand heiratete. Die Normannen erhofften sich von dieser Verbindung einen dauernden Frieden mit dem Kaiser und eine Anerkennung ihres Reiches, während Friedrich auf einen Erbfall Siziliens an sein Haus spekulierte, da Wilhelm II. kinderlos war. Nach der Hochzeit erfolgte eine Krönung Heinrichs, die stark an eine Kaiserkrönung erinnerte. Dies sollte ihm das mögliche Erbe Siziliens aus eigener Kraft sichern, und nicht bloß als Gatte seiner Frau. Barbarossa hatte zuvor von Papst Lucius III. mehrfach die Kaiserkrönung Heinrichs noch zu seinen eigenen Lebzeiten gefordert. 1188 krönte Clemens III. Heinrich VI. zum Kaiser.
Der Prozess gegen Heinrich den Löwen
In den letzten Jahren Friedrichs hatten sich die Beziehungen zwischen ihm und seinem welfischen Vetter Heinrich dem Löwen immer mehr verschlechtert. Wesentlich hierzu beigetragen hatte die Weigerung Heinrichs, auf dem fünften Italienzug Truppen zu stellen (Kniefall von Chiavenna). Zudem schloss Heinrich 1175 oder 1176 einen Erbvertrag mit Welf VI., der Heinrich die italienischen Besitzungen seines Onkels sichern sollte. 1178 kaufte Barbarossa Welf VI. dessen Territorien nördlich der Alpen ab und gab einen Teil sofort als Lehen an ihn zurück.
Im Januar 1179 klagte der Kaiser Heinrich den Löwen auf dem Hoftag in Worms wegen verschiedener Vergehen an. Heinrich erhob sofort eine Gegenklage, in der er den mit Barbarossa verbündeten Kölner Erzbischof beschuldigte, das Gebiet um Hameln verwüstet zu haben. Formal entfaltete sich der folgende Rechtsstreit zwischen Heinrich dem Löwen und dem Erzbischof. Zu einer tatsächlichen Verhandlung kam es nicht, da Heinrich der Löwe zu keinem Gerichtstermin erschien. Nach einer ersten Acht im Juni 1179 wurde im Januar 1180 in Würzburg von der versammelten Fürstenschaft die Reichsacht über Heinrich verhängt. Dadurch wurden ihm sämtliche Reichslehen entzogen. Der Herrschaftsbereich Heinrichs wurde aufgeteilt: Das norddeutsche Gebiet wurde in der Gelnhäuser Urkunde im April 1180 zweigeteilt in die Herzogtümer Westfalen, das an den Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg, und Sachsen, das an den Askanier Bernhard von Anhalt fiel. In Bayern machte Barbarossa im September 1180 Pfalzgraf Otto von Wittelsbach zum Herzog.
Heinrich der Löwe setzte sich militärisch gegen das Urteil zur Wehr, woraufhin es zur Reichsheerfahrt gegen ihn kam. Er musste sich bereits im November 1181 dem Kaiser unterwerfen, nachdem der sächsische Adel, slawische und dänische Verbündete von ihm abgefallen waren und auch die Stadt Lübeck dem Kaiser die Tore geöffnet hatte. Ende 1181 wurde er auf dem Hoftag in Erfurt noch einmal verurteilt, wobei vermutlich die Fürsten den Kaiser zum vergleichsweise milden Urteil der Verbannung auf drei Jahre zwangen.
Spätestens mit der Übernahme Westfalens wurde Philipp von Heinsberg als mächtigster Fürst in der Nordhälfte Deutschlands zum Problem für Barbarossa. Möglicherweise war der Erzbischof sogar die treibende Kraft hinter dem Prozess gegen Heinrich den Löwen. Bereits seit 1165 hatte Barbarossa versucht, die Macht Philipps zurückzudrängen. Die Förderung verschiedener Fürsten in den südlichen Niederlanden und im Maas-Mosel-Gebiet sowie der Städte Aachen und Duisburg konnte den Machtzuwachs Philipps jedoch nicht wirklich bremsen. Hier zeigten sich auch die strukturellen Schwächen in der Politik Barbarossas in Deutschland: nicht der König, sondern mehrere Reichsfürsten profitierten vom Fall Heinrichs des Löwen.
1184 erfolgte auf dem Mainzer Hoftag eine eindrucksvolle Demonstration staufischer Macht. Im selben Jahr schloss Barbarossa ein Bündnis mit Philipp I. von Flandern gegen den französischen König Philipp II., an dem sich auch Heinrich II. von England beteiligte. Barbarossas Sohn Heinrich VI. sollte einen Feldzug gegen Frankreich anführen, der jedoch abgebrochen wurde, als Balduin V. von Hennegau den Durchzug des Heeres verweigerte. Den Konflikt mit Balduin scheute Barbarossa, weil er ihn als Gegengewicht zu Philipp von Heinsberg benötigte. Im Gegenzug trat der Kölner Erzbischof in direkte Opposition zu Barbarossa, wobei er, unterstützt von Papst Urban III., vor allem dem von Barbarossa beanspruchten Erbkaisertum entgegen trat. Der Kaiser setzte wiederum 1186 seinen Sohn als Regenten in Italien ein, um sich auf Deutschland zu konzentrieren. Im November 1186 bekannte sich in Gelnhausen ein Großteil des deutschen Episkopats zum Kaiser, was dem Erzbischof und dem Papst eine Niederlage beibrachte. Nachdem es Philipp von Heinsberg 1187 noch gelungen war, ein Bündnis des Kaisers mit dem französischen gegen den englischen König zu vereiteln, musste er sich im März 1188 auf dem Hoftag in Mainz unterwerfen.
Kreuzzug und Tod
Ebenfalls auf dem Mainzer Hoftag wurde der Kreuzzug beschlossen. 1189 brach Friedrich von Regensburg aus zum Dritten Kreuzzug auf. Philipp II. von Frankreich und Richard I. Löwenherz von England sollten ihm 1190 folgen. Die Regentschaft im Reich übernahm sein Sohn Heinrich VI.
Im Zusammenhang mit diesem Kreuzzug soll Friedrich I. Barbarossa einer Handels- und Marktsiedlung, die zuvor von Graf Adolf III. von Schauenburg und Holstein am westlichen Alsterufer gegründet worden war, weitgehende handels- und stadtrechtliche Privilegien verliehen haben. Dieses Diplom gilt als Gründungsurkunde Hamburgs, jedoch ist die Echtheit dieser Urkunde umstritten. Für weitere Details hierzu, siehe Artikel zur Geschichte Hamburgs.
Vor seinem Aufbruch soll Barbarossa Saladin von Ägypten in einem Schreiben vom 26. Mai 1188 zum ritterlichen Zweikampf in der ägyptischen Ebene Zoan aufgefordert und den 1. November 1189 als Termin dafür genannt haben. Dieses Schreiben gilt allerdings wohl als eine englische Fälschung.
Er führte sein Heer die Donau entlang über den Balkan. In Ungarn verlobte er seinen Sohn Friedrich V. von Schwaben mit Konstanze, der Tochter des ungarischen Königs. Gegen erheblichen Widerstand des byzantinischen Kaisers Isaak II. Angelos erzwang er im März 1190 bei Gallipoli die Überfahrt nach Kleinasien.
Er siegte in zwei Schlachten, bei Philiomelium und bei Iconium, gegen die muslimischen Rum-Seldschuken. Nachdem er mit seinem Heer das befreundete christliche Reich Kleinarmenien erreicht und das Taurus-Gebirge überquert hatte, ertrank Friedrich I. im Juni 1190 in Sichtweite der Stadt Seleucia im Fluss Saleph. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt: Teils wird berichtet, er habe, erhitzt vom Ritt, sich durch ein Bad abkühlen wollen; nach anderer Überlieferung wurde er bei der Flussüberquerung von seinem scheuenden Pferd abgeworfen und durch das Gewicht seiner Rüstung unter Wasser gezogen. Man spekuliert auch, dass er angesichts der Sommerhitze und seines Alters im eiskalten Gebirgswasser einen Herzinfarkt erlitt.
Sein Sohn Friedrich V. von Schwaben zog mit einer kleinen Schar weiter, um Friedrich Barbarossa in Jerusalem zu beerdigen. Der Versuch, den Leichnam in Essig zu konservieren, misslang, so dass Herz und Eingeweide des Kaisers in Tarsos, das Fleisch in der Peterskirche in Antiochia (Antakya), seine Knochen in der Kathedrale von Tyros beigesetzt wurden.
Herrschaftsprogramm und Kaiseridee
Wichtigste Quelle für das Selbstverständnis Barbarossas in seinen ersten Regierungsjahren sind die Gesta Friderici des Bischofs Otto von Freising. In ihnen nimmt das Motiv der Abwehr eines Niedergangs des Reiches (vor allem angesichts der nahezu zusammengebrochenen Reichshoheit über Oberitalien) und die Wiederherstellung des Einverständnisses zwischen Kaiser- und Papsttum eine zentrale Rolle ein. Friedrich wurde in den Gesta als Heilsbringer nach dem Investiturstreit gesehen. Ein weiteres Motiv ist die Treue der Staufer den Saliern gegenüber, wofür sie, im Kontrast zu den salier-feindlichen Fürsten, mit der Königswürde belohnt worden sind.
Aus der Wahlanzeige Friedrichs geht vor allem die auf der Zweigewaltenlehre fußende Absicht hervor, die Privilegien der Kirche und die Ehre des Reiches (honor imperii) wiederherzustellen. Allerdings handelt es sich bei dieser Formulierung um die Übernahme eines justinianischen Textes, auf den bereits Konrad III. zurückgegriffen hatte. Barbarossa nahm auch als erster mittelalterlicher Kaiser das spätantike Corpus iuris civilis auf, um damit die kaiserlichen Herrschaftsrechte in Reichsitalien einzufordern, freilich mit wenig Erfolg. Aus der Konzentration Barbarossas in Sachen Rückgewinnung von Herrschaftsrechten auf Oberitalien ergibt sich auch die besondere realpolitische Bedeutung des anfangs angestrebten guten Verhältnisses zwischen Reich (Imperium) und Kirche (Sacerdotium): Barbarossa hoffte, mit päpstlicher Unterstützung die de facto autonom gewordenen Territorien in Italien leichter wieder in den Reichsverband einfügen zu können.
Seinen ersten Ausdruck fand der angestrebte Interessenausgleich zwischen Reich und Kirche im Konstanzer Vertrag. Doch bereits mit dem Beneventer Vertrag wurde die Vorstellung der beiden gleichberechtigten Reiche, des weltlichen und des geistlichen, unterlaufen. Mit ihm trat für Barbarossa die Stadt Rom mit ihrer Bevölkerung als weitere Machtgruppe sowie für den Papst der sizilianische König als alternative Schutzmacht in Erscheinung. Zunehmend fasste Barbarossa die stadtrömische Bevölkerung und die Anerkennung durch sie als Rechtfertigung für seine Kaiserwürde auf und geriet damit weiter in Konflikt mit dem Papsttum, das nur die Krönung durch den Papst anerkannte. Als Antwort auf die sich verstärkenden Spannungen mit dem Papsttum kann auch die Schöpfung des Begriffs sacrum imperium in der staufischen Kanzlei im Jahre 1157 verstanden werden.
Der Herrschaftsanspruch Barbarossas wurde vor allem von zwei Seiten angegriffen: vom Papsttum, das insbesondere unter Alexander III. für sich den Vorrang gegenüber der weltlichen Macht beanspruchte und dem Kaiser eine geistliche Autorität vollkommen absprach, sowie von anderen weltlichen Herrschern, die zumindest in ihrem Territorium für sich eine vom Kaisertum unabhängige Herrschaft beanspruchten. Letzteres galt insbesondere für den französischen König.
Umstritten war und ist unter Zeitgenossen und Historikern, inwieweit Friedrich I. für sich die Weltherrschaft beanspruchte. Zwar versuchte er lediglich Sizilien tatsächlich in sein Reich zu integrieren, allerdings drückte sich in seinem Anspruch auf die Schutzherrschaft über Rom auch eine Ausdehnung der Autorität über die gesamte christliche Welt aus.
Ein wichtiges Element im kaiserlichen Selbstverständnis Barbarossas war die Berufung auf Karl den Großen, die sich unter anderem in dessen Heiligsprechung 1165 ausdrückte. Damit versuchte er offenbar der beginnenden Vereinnahmung des Frankenherrschers durch das sich konsolidierende Frankreich entgegenzutreten und dem gesamtchristlichen Herrschaftsanspruch des byzantinischen Kaisers zu widersprechen. Die Berufung auf Karl den Großen wurde auch von einer genealogischen Auffassung bestärkt, die die Staufer als Verwandte der Salier und diese als Verwandte der Karolinger ansah. Diese Auffassung ermöglichte es Barbarossa, einen Erbanspruch auf die Kaiser- und Königswürde zu erheben, die übrigen Elemente der kaiserlichen Autorität (Krönung durch den Papst, Herrschaft über die Stadt Rom, Schutzauftrag der Kirche gegenüber) geringer einzuschätzen und damit die Rolle des Papstes zurückzudrängen. Auch der Kreuzzug Barbarossas kann als Berufung auf das Vorbild Karls und seiner Dimension als Kämpfer gegen die Heiden gesehen werden.
Nach innen, auf die Lehnsstruktur des Reiches gerichtet, vertrat Friedrich I. den Anspruch höchster königlicher Autorität. Der König selbst sollte demnach einziger Ausgangspunkt für Herrschaftsgewalt sein, auf den die gesamte Lehnspyramide sich letztendlich bezog. Die Teilung Bayerns und die Entmachtung Heinrichs des Löwen sind Beispiele für diesen absoluten Machtanspruch.
Nachkommen
Erste Ehe mit Adela von Vohburg ohne Nachkommen
Zweite Ehe mit Beatrix von Burgund
- Beatrix (* wohl 1160/1162; † vor Anfang 1174), begraben in Lorch
- Friedrich (* 16. Juli 1164 in Pavia; † 28. November 1169/1170), 1167 Herzog von Schwaben, begraben in Lorch
- Heinrich VI. (* 1165; † 1197), deutscher König und Kaiser, König von Sizilien, ∞ Konstanze von Sizilien (* 1154; † 1198), Tochter des Königs Roger II.
- Konrad (* 1167; † 1191), als Friedrich V. Herzog von Schwaben
- Tochter, möglicherweise „Gisela“ (* Oktober/November 1168; † Ende 1184)
- Otto I. (* 1179; † 1200), Pfalzgraf von Burgund, ∞ Margareta von Blois († 1230), Pfalzgräfin von Burgund, Gräfin von Blois
- Konrad († 1196), Herzog von Schwaben
- Rainald (* wohl Oktober/November 1173; † klein), begraben in Lorch
- Wilhelm (* wohl Juni/Juli 1176; † klein), begraben in Lorch
- Philipp von Schwaben (* 1177, † 1208), Herzog von Schwaben, deutscher König, ∞ 1197 Eirene (Marie) von Byzanz (* 1181; † 1208), Tochter des Kaisers Isaak II. Angelos
- Agnes († 8. Oktober 1184), begraben im Dom zu Speyer
Das Barbarossa-Bild der Nachwelt
Geschichtsforschung
In der Erinnerungskultur des Spätmittelalters und in der beginnenden Geschichtsschreibung der Frühen Neuzeit trat Barbarossa zunächst hinter seinen Enkel Friedrich II. zurück. Im 16. Jahrhundert wurde Friedrich I. von deutschen Historikern wiederentdeckt, allerdings angesichts einer ersten Herausbildung eines „deutschen“ Nationalgefühls in verengter Betrachtung: Seine Bedeutung für den deutschen Reichsteil wurde hervorgehoben, sein Wirken in Italien vernachlässigt oder, in protestantischer Deutung, ausschließlich als Kampf gegen den Papst interpretiert.
Im 18. Jahrhundert begannen sich zwei Bewertungen von Barbarossas Herrschaft herauszubilden, die seitdem die Diskussion über den Kaiser prägen: Entsprechend dem ersten Ansatz, der von Gottfried Wilhelm Leibniz begründet und von vielen deutsch-nationalen Historikern des 19. Jahrhunderts übernommen wurde, erscheint Barbarossa als der größte römisch-deutsche Kaiser des Mittelalters und seine Zeit als ein Höhepunkt der deutschen Geschichte, dem der Verfall folgte. Grund für die überaus positive Bewertung Barbarossas dürften zu einem bestimmten Grad die gesta friderici gewesen sein, in denen Otto von Freising für seinen Stiefneffen Barbarossa „Propaganda“ betrieb. Jüngere Historiker mit einer positiven Einschätzung Friedrichs sind (wenn auch nicht in der extremen Ausprägung der älteren Geschichtsforschung) unter anderem Alfred Haverkamp und Ferdinand Opll. Friedrich wurde in der älteren Geschichtsforschung vor allem zugute gehalten, dass er versucht habe, ohne Eigennutz die Rechte des Reiches und die Macht des Kaisertums wiederherzustellen und gegen die Macht der Kirche sowie partikularistische Bestrebungen im Adel zu verteidigen (obwohl er vor allem in den ersten Jahren mit den Fürsten eng kooperierte). Auch habe er ein geschickt ausbalanciertes Machtsystem zwischen Zentralgewalt und Adel geschaffen, das eine langfristige Friedensordnung zwischen Kaiser, Papst und Fürsten hätte ermöglichen können (erstmals so formuliert von Friedrich von Raumer, 1825).
Die zweite Auffassung, die sich bereits Anfang des 18. Jahrhunderts herausbildete (erstmals vermutlich von Samuel von Pufendorf und später vor allem von Justus Möser vertreten), wird heute unter anderem von Hagen Keller und Geoffrey Barraclough vertreten. Sie sehen Barbarossas Italienpolitik eher kritisch. Das Vorgehen des Kaisers habe zu einer Verschwendung von Ressourcen in Italien geführt, die in keinem Verhältnis zum Erzielten gestanden hätten. Friedrich habe außerdem weitere zentrifugale Effekte im Reich gefördert, da er den Reichsfürsten mehr Macht gab. Barbarossa hätte nach dieser Auffassung das Ergebnis seiner Italienpolitik schon in den 50er Jahren des 12. Jahrhunderts erreichen können, wenn er im Einvernehmen mit den Kommunen agiert hätte und dem Papsttum entgegengekommen wäre. Vor allem, aber nicht nur, katholische Historiker werteten das Vorgehen gegen Papst und italienische Stadtstaaten als Akt der Barbarei, mit dem organisatorisch weit entwickelte Gebilde angegriffen worden seien. Diese Auffassung von den älteren Staufern, ganz im Gegensatz zu Friedrich II., vertrat auch die national-italienische Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts.
Einen wahren Schub und allerdings auch eine weitgehende Einengung auf eine positive Interpretation bekam die Beschäftigung mit Barbarossa nach der Revolution von 1848. Ab diesem Zeitpunkt verdrängte er Friedrich II. geradezu aus der Geschichtsforschung. Barbarossa wurde als Einiger des Reiches unter einer starken Zentralmacht verehrt, was vor allem preußische Historiker (insbesondere Johann Gustav Droysen) dazu brachte, die Hohenzollern in die Tradition Barbarossas zu stellen. Dieses positive Barbarossa- und Stauferbild wurde in Deutschland erst in der Zeit zwischen den Weltkriegen vorsichtig relativiert, als auch die ältere kritische Forschungsmeinung wieder wahrgenommen wurde.
Es gibt aber auch eine Interpretations-Tradition, die gerade das intensive Engagement Barbarossas in Italien als Grund für den unter ihm einsetzenden Modernisierungsschub für das ganze Reich sieht. Demnach hat der Versuch, Italien wieder enger an das Reich zu binden, die exakte Ausformulierung und schriftliche Festsetzung von Herrschaftsrechten sowie eine intensive Beschäftigung mit römischen Rechtstraditionen nach sich gezogen. Dies wiederum führte zu einer Verstetigung und Verfestigung der Gesetzgebung und des Justizwesens im Gesamtreich. Ein ähnlicher Prozess lässt sich auch für die Verwaltung der Königsgüter und des Gesamtreiches ausmachen, dies jedoch mit der straffen Verwaltung Siziliens als Keimzelle.
Ein neuerer Forschungsansatz ist die Frage, ob man überhaupt von einer durchgehenden und klar umrissenen Zielsetzung Barbarossas sprechen kann, zumal seine Regierung so lange dauerte und mehrere grundlegende Bündnis- und Zielwechsel umfasste. Beispielsweise vertritt Peter Munz diese Auffassung und stellt auch die Bedeutung historischer Traditionen für Friedrich in Frage. Er vertritt die These, dass Barbarossa eine weitgehend genuin selbstbestimmte und wandelbare Politik betrieben habe.
Neben seiner stabilisierenden Wirkung auf die Zentralmacht des Reiches machen Historiker jedoch auch Zerfallsprozesse aus, die unter Barbarossa beschleunigt wurden. Unter anderem die Abtrennung Österreichs von Bayern und die Aufteilung der Herzogtümer Sachsen und Bayern trieben dieser Einschätzung zufolge die Auflösung der alten Stammesherzogtümer weiter voran und stellten Stufen der Herausbildung regionaler, von der Person des Fürsten unabhängiger Territorien dar. Im Prozess gegen Heinrich den Löwen drückte sich darüber hinaus eine neue Rechtsauffassung über die Fürstenwürde aus: Sie wurde zunehmend als rechtlich definiertes und weniger als angeborenes Amt verstanden.
Sagen
Im mittelalterlichen Volksglauben lebt Barbarossa weiter, je nach Version im Trifels, dem Kyffhäuser[1] oder dem Untersberg, bis das Reich ihn wieder braucht. Raben sollen sein Versteck umkreisen und ihn benachrichtigen, falls sein Reich in Gefahr sein sollte. In diesem Falle würde sich Barbarossa aus seinem ewigen Schlaf erheben und dem Land wieder Ehre und Ruhm zurück bringen. Das Motiv des schlafenden Kaisers wurde allerdings zuerst seinem Enkel Friedrich II. zugeschrieben und erst später auch auf Barbarossa übertragen. Das Märchen Der Schmied von Jüterbog greift das Motiv auf.
Barbarossa zu Ehren wurde seine Büste in der Walhalla aufgestellt.
Belletristik
Eine Darstellung des Barbarossa-Stoffes findet sich in Umberto Ecos Roman Baudolino (it. 2000, dt. 2001)
Literatur
Quellen
- MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Bd. X/1-5, Friderici I. Diplomata, bearbeitet von Heinrich Appelt, Hannover 1975-1990.
- Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris, herausgegeben von Georg Waitz und Bernhard von Simson, Hannover 1997 (Nachdruck).
Sekundärliteratur
Allgemeine Darstellungen
- Odilo Engels: Die Staufer. 8. Auflage, Stuttgart 2005, ISBN 3-17-017997-7. (Standardwerk zur Stauferzeit; dort auch weiterführende Literatur)
- Wilhelm von Giesebrecht: Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bde. V (1880) und VI (1895). Bd. VI herausgegeben und fortgesetzt von B. von Simson ("bis auf den heutigen Tag die quellenmäßig am besten fundierte Abhandlung für die Regierungszeit des ersten Stauferkaisers" Zitat: Ferdinand Opll, Friedrich Barbarossa, 1990, S. 2.; die Darstellung neigt aber zu einer stark romantisierenden Darstellung der Staufer)
- Knut Görich: Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert. Darmstadt 2001. ISBN 3-534-15168-2. (Rezension)
- Hagen Keller: Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024–1250. Propyläen Geschichte Deutschlands. Bd 2. Berlin 1986. ISBN 3-549-05812-8
- Heinz Krieg: Herrscherdarstellung in der Stauferzeit. Friedrich Barbarossa im Spiegel seiner Urkunden und der staufischen Geschichtsschreibung. Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-6760-7.
- Heinz Löwe: Die Staufer als Könige und Kaiser. In: Die Zeit der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur. Bd 3. (Aufsätze). Hrsg. vom Württembergischen Landesmuseum, Stuttgart 1977, S. 21–34.
- Stefan Weinfurter (Hrsg.): Stauferreich im Wandel. Ordnungsvorstellungen und Politik in der Zeit Friedrich Barbarossas. Stuttgart 2002, ISBN 3-7995-4260-4.
- Christian Uebach: Die Ratgeber Friedrich Barbarossas (1152–1167). Marburg 2008, ISBN 978-3-8288-9580-5. (Rezension)
Biografien
- Heinrich Appelt: Friedrich Barbarossa (1152–1190). In: Helmut Beumann (Hrsg.): Kaisergestalten des Mittelalters. 2. Auflage. München 1985, ISBN 3-406-30279-3, S. 177–198.
- Joachim Ehlers: Friedrich I. In: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des Mittelalters, Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I. München 2003, ISBN 3-406-50958-4, S. 232–257
- Johannes Laudage: Friedrich Barbarossa. Eine Biographie. Regensburg 2009. ISBN 978-3-7917-2167-5. (Aus dem Nachlass Laudages herausgegeben von Lars Hageneier und Matthias Schrör und daher für die 1170er Jahre teils lückenhaft.) (Rezension)
- Ferdinand Opll: Friedrich Barbarossa, 4. bibliographisch vollständig aktualisierte Aufl., Darmstadt 2009 (1. Aufl. 1990), ISBN 978-3-534-22880-5.
Anmerkungen
- ↑ Vgl. unter anderem Camilla G. Kaul: Friedrich Barbarossa im Kyffhäuser. Bilder eines nationalen Mythos im 19. Jahrhundert. Bonner Beiträge zur Kunstgeschichte 4. 2 Bde., Köln 2007.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Herzog von Burgund - Philipp III. (Burgund)
Philipp der Gute, franz. Philippe le Bon; (* 31. Juli 1396 in Dijon; † 15. Juli 1467 in Brügge) war Herzog von Burgund aus der burgundischen Seitenlinie des Hauses Valois, Sohn von Herzog Johann Ohnefurcht (Jean sans peur) und der Margarete von Bayern.
Leben
Philipp wuchs vor allem in Gent auf. Als ersten Titel erhielt er von seinem Vater 1405 den Titel eines Grafen von Charolais als Apanage verliehen. Philipp wurde 1419 Herzog von Burgund und Graf von Flandern, Artois und Pfalzgraf von Burgund, als sein Vater Johann von Leuten des Dauphins ermordet wurde (siehe Bürgerkrieg der Armagnacs und Bourguignons).
Aus Hass gegen den Dauphin, den späteren Karl VII. von Frankreich verbündete er sich im Vertrag von Troyes vom 21. Mai 1420 mit Heinrich V. von England gegen Frankreich, um sich zu rächen. Als schließlich am 21. September 1435 der Vertrag von Arras abgeschlossen wurde, ließ sich Philipp darin von Karl VII. seine völlige Unabhängigkeit von der französischen Krone garantieren sowie die Grafschaften Auxerre, Mâcon, die Kastellanei Bar-sur-Seine sowie alle Eroberungen in der Picardie (Grafschaft Boulogne, Grafschaft Ponthieu, südlicher Teil der Grafschaft Vermandois sowie die Somme-Städte in der Umgebung von Amiens) übertragen. So erreichte er für seinen jungen Staat Burgund die Möglichkeit zu einer unabhängigen Großmachtpolitik zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich. Durch Erbschaft von Philipp von Brabant aus der Seitenlinie Burgund-Brabant war Philipp der Gute bereits 1430 Herzog von Brabant und Limburg geworden.
1421 erwarb er durch Kauf die Grafschaft Namur hinzu. 1433 entriss er im Haager Vertrag Jakobäa von Bayern, deren Erbe er bereits 1428 im Delfter Versöhnungsvertrag geworden war, die Grafschaften Holland, Zeeland, Friesland und das Hennegau. Ähnlich verfuhr er mit Elisabeth von Görlitz, die als Pfand das Herzogtum Luxemburg innehielt. 1442 sah sie sich aus Geldnot genötigt, Philipp als ihren Alleinerben einzusetzen, der im darauf folgenden Jahr das Herzogtum besetzte und gegen die konkurrierenden Ansprüche der Erben aus dem Haus Luxemburg zu behaupten. Damit drang er tief in das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches ein, was den ebenso heftigen wie hilflosen Protest von Kaiser Sigismund auslöste. Zusammen mit dem Herzogtum Burgund, der Freigrafschaft Burgund und der Grafschaft Flandern, die er geerbt hatte, formte Philipp so ein Territorium von Gebieten beiderseits der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, das an das Reich des ältesten Sohnes von Kaiser Ludwig dem Frommen, Lothars I., erinnerte. Es gelang ihm außerdem die Fürstbistümer Cambrai und Utrecht unter seine indirekte Kontrolle zu bringen, indem er die Wahl von Bischöfen aus seiner Familie durchsetzte.
Philipp begünstigte die Künste und Wissenschaften und beförderte Handel und Gewerbe, namentlich die Teppichweberei in Flandern.
Am 10. Januar 1430 stiftete er nach dem Vorbild des englischen Hosenbandordens den Orden des Goldenen Vlieses, der als einigendes Band für die Elite seines sehr heterogenen Territoriums gedacht war und die christlichen Werte weltweit verteidigen sollte.
In seinen letzten Jahren überließ Philipp die Regierung ganz seinem ehrgeizigen Sohn Karl (Charles le Téméraire).
Philipps faktisch unabhängiger Länderkomplex zwischen Frankreich und Deutschland wurde in seinem nördlichen Teil zum Vorläufer der Niederlande (aus denen später die heutigen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg entstanden). Die Ablösung Philipps von Frankreich und sein Rückzug aus der französischen Innenpolitik geschah allerdings nicht ohne Zögern und Schwanken, da er sich zeitlebens als Prince du sang (Fürst von französischem königlichen Geblüt) betrachtete. Erst sein Sohn Karl der Kühne sollte sich vollends als Oberhaupt eines unabhängigen Reiches fühlen, das er allerdings durch seine unbedachte Politik in Gefahr brachte und das bei seinem Tod auf dem Schlachtfeld 1477 wieder zwischen Frankreich und Habsburg aufgeteilt wurde.
Familie
Philipp war seit 1409 in erster Ehe verheiratet mit Michelle, Tochter des französischen Königs Karl VI.. Nach dem Tod seiner ersten Frau 1422 heiratete Philipp in zweiter Ehe 1424 Bonne d'Artois, die Tochter des Grafen Philipp von Artois. Sie war außerdem die Witwe seines Onkels, des Grafen Philipp von Burgund-Nevers. 1430 heiratete Philipp in dritter Ehe Isabella von Portugal, mit der er endlich den gewünschten Nachfolger bekam, Karl den Kühnen. Philipp hatte drei legitime und neun bekannte illegitime Kinder, sein einziger überlebender männliche Nachkomme war Karl der Kühne.
Neben seinen drei Ehefrauen verkehrte Philipp mit mehreren anderen Frauen, so Jeanne de Presle de Lizy sowie Jeanne Chastellain, genannt de Bosquiel, Dame von Quéry la Motte (†1462) sowie Marie de Belleval. Aus diesen Verbindungen entsprossen neun uneheliche Nachkommen.
Eheliche Nachkommen
einzig mit Isabelle von Portugal
- • Antoine und Josse verstarben kurz nach der Geburt
- • Karl (der Kühne), * 1433 in Dijon
Uneheliche Nachkommen
- • Antoine (1421–1504), genannt Grand Bâtard de Bourgogne, Herr von Tournehem, Sohn von Jeanne de Presle de Lizy.
- • Cornelius, Herr von Elverdinge, Vlamertinge, Neuve-Église und Pierrefort, Kapitän und Generalgouverneur des Herzogtums Luxemburg.
- • Marie de Bourgogne (1426–1475), Tochter von Jeanne Chastellain (nach anderen Quellen aber der Jeanne Presle de Lizy); ∞ Pierre de Bauffremont, Graf von Charny, Kammerherr Philipps des Guten (Haus Bauffremont)
- • Marguerite († 1455).
- • David (1427–1496), wurde 1451 Bischof von Thérouanne und 1456 auch von Utrecht, Sohn von Jeanne Chastellain.
- • Anne (1435–1508), war die Gouvernante von Maria von Burgund
- 1. ∞ Adrien de Brosse
- 2. ∞ Adolf von Kleve-Ravenstein
- • Raphaël de Mercatel (1437–1508), Abt von Saint-Bavon de Gand und Saint-Pierre d'Oudenburg, Sohn von Marie de Belleval.
- • Baudouin (1446–1508), Herr von Fallais, Peer, Baudour, Sainte-Anne, Lovendegem, Zomergem et Fromont.
- • Philipp (1464–1524), ab 1517 Bischof von Utrecht.
Wappen
Philipp führte seit 1430 ein Wappen das einerseits das Wappen der burgundischen Seitenlinie des Hauses Valois als Grafen von Tours zeigte (goldene Lilien auf blauem Grund, eingefasst durch rot-weiß gestreiftes Band) und andererseits die Wappen der Herzogtümer Burgund (goldene diagonale Streifen auf blauem Grund, eingefasst von rotem Band) sowie Limburg (roter Löwe mit gespaltenem Schwanz auf silbernem Grund), Brabant (goldener Löwe auf schwarzem Grund) zeigte. In der Mitte war das Wappen der Grafschaft Flandern platziert – durch seine Großmutter Margarete von Flandern kamen die Grafschaften Flandern, Artois, Rethel und Nevers und die Pfalzgrafschaft Burgund an das Haus Burgund.
Titel
- • 28. Januar 1405–Januar 1431, 5. Februar 1432–April 1432, August 1432–November 1432: Graf von Charolais als Philipp II.
- • 10. September 1419–15. Juli 1467: Herzog von Burgund als Philipp III.
- • 10. September 1419–15. Juli 1467: Graf von Artois als Philipp V.
- • 10. September 1419–15. Juli 1467: Pfalzgraf von Burgund als Philipp V.
- • 10. September 1419–15. Juli 1467: Graf von Flandern als Philipp III.
- • 1. März 1429–15. Juli 1467: Markgraf von Namur als Philipp IV.
- • 4. August 1430–15. Juni 1467: Herzog von Brabant und Herzog von Lothier (Niederlothringen) als Philipp II.
- • 4. August 1430–15. Juni 1467: Herzog von Limburg als Philipp II.
- • 1433–15. Juni 1467: Graf von Hennegau als Philipp I.
- • 1433–15. Juni 1467: Graf von Holland und Friesland als Philipp I.
- • 1433–15. Juni 1467: Graf von Seeland als Philipp I.
- • 20. September 1435–15. Juni 1467 Graf von Auxerre
- • 20. September 1435–15. Juni 1467 Graf von Mâcon
- • 20. September 1435–15. Juni 1467 Graf von Boulogne
- • 20. September 1435–15. Juni 1467 Graf von Ponthieu
- • 20. September 1435–15. Juni 1467 Graf von Vermandois
- • 1443–15. Juni 1467: Herzog von Luxemburg als Philipp I.
Literatur
- Bonenfant, Paul, Philippe le Bon. Sa politique, son action, Études présentées par A.M. Bonenfant-Feytmans, (Bibliothèque du Moyen âge, 9) Brüssel 1996.
- Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle: notices bio-bibliographiques. Hg. von Raphael de Smedt. (Kieler Werkstücke, D 3), 2., verbesserte Auflage, Frankfurt 2000 (ISBN 3-631-36017-7), S. 1f.
- Vaughan, Richard, Philip the Good. The apogee of Burgundy. London 1970.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Liste der Bischöfe von Bremen
(Weitergeleitet von Erzbischof von Bremen)
- Die folgenden Personen waren Bischöfe des Bistums Bremen in Personalunion mit dem Erzbistum Hamburg:
-
- von bis Name
- 848 865 Ansgar. Seit 831 Erzbischof von Hamburg, seit 845 Bischof von Bremen
- 865 888 Rimbert
- 888 909 Adalgar
- 909 915 Hoger (auch:Huggar)
- 916 916 Reginwart
- 916 936 Unni
- 936 988 Adaldag
- 988 1013 Libentius I. (auch: Libizo, Liawizo)
- 1013 1029 Unwan
- 1029 1032 Libentius II. (auch: Liawizo)
- 1032 1035 Hermann
- 1035 1043 Adalbrand (auch: Bezelin, Alebrand)
- 1043 1072 Adalbert I., Pfalzgraf von Sachsen
- 1072 1101 Liemar
- 1101 1104 Humbert
- 1104 1123 Friedrich I.
- 1123 1148 Adalbero (auch: Adalbert II.)
- 1148 1168 Hartwig I. von Stade
- 1168 1178 Balduin I. (auch: Baldwin), von Kaiser Friedrich I. nach unentschiedener Doppelwahl zwischen Siegfried I. und Dompropst Otbert eingesetzt.
- 1178 1179 Bertold (auch: Bertram). Nicht päpstlich bestätigt, danach Bischof von Metz
- (1168)
- 1179 1184 Siegfried I., Fürst von Anhalt. Nach Einsetzung Balduins I. nannte er sich „Erwählter von Bremen“. Nach dem Tod von Balduin I. von Kaiser Friedrich I. eingesetzt.
- 1184 1207 Hartwig II. von Utlede (auch: Wilrich, Hartwig II. von Uthlede). 1190 von König Heinrich IV. abgesetzt, blieb aber im Amt, da Waldemar in Dänemark gefangen war.
- (1192)
- 1208 1212 Waldemar Prinz von Dänemark (auch Bischof von Schleswig). 1192 ohne päpstliche Anerkennung in Bremen gewählt. 1217 endgültig vertrieben.
- 1208 1210 Burghard I. von Stumpenhausen. Nur in Hamburg anerkannt. 1210 resigniert.
- 1210 1219 Gerhard I. von Oldenburg-Wildeshausen. Von 1192 bis 1216 auch Bischof im Bistum Osnabrück.
- 1219 1258 Gebhard II. zur Lippe. Nannte sich rechts der Elbe Bischof von Hamburg, links der Elbe Erzbischof von Bremen.
Papst Honorius III. bestätigt 1224 das Doppelbistum mit Sitz in Bremen endgültig. Hamburg hat keinen eigenen Bischof mehr, das Domkapitel von Hamburg bleibt aber mit besonderen Rechten ausgestattet bestehen.
- Die folgenden Personen waren Erzbischöfe des Erzbistums Bremen:
-
- von bis Name
- 1258 1273 Hildebold von Wunstorf (auch: Hildbold).
- 1273 1306 Giselbert von Brunkhorst (auch: Giselbert von Bronkhorst)
- 1306 1307 Heinrich I. von Goltern (auch: von Golthorn)
- 1307 1310 Sedisvakanz. Doppelwahl, gewählt waren Florenz von Bronchorst und Bernhard von Wölpe. Florenz starb 1308, Bernhard gab auf.
- 1310 1327 Jens Grand (auch: Johann, Jonas Fursat Grand). Vorher seit 1289 Erzbischof von Lund. 1316 versuchte man ihn für unzurechungsfähig zu erklären.
- 1316 1327 Johann I. von Braunschweig-Lüneburg (Administrator)
- 1327 1344 Burchard Grelle
- 1344 1348 Otto I. von Oldenburg
- 1348 1359 Gottfried von Arnsberg (vorher Bischof von Osnabrück)
- 1348 1359 Moritz von Oldenburg (Administrator) , ohne päpstliche Bestätigung)
- 1359 1395 Albert II. von Braunschweig-Lüneburg
- 1395 1406 Otto II. von Braunschweig-Lüneburg
- 1406 1421 Johannes II. von Schlamstorf (auch: von Slamsdorp)
- 1422 1435 Nikolaus von Oldenburg-Delmenhorst, resigniert
- 1435 1441 Baldwin II. von Wenden (auch: Balduin)
- 1442 1463 Gerhard III. von der Hoye
- 1463 1496 Heinrich II. von Schwarzburg (Ab 1466 auch Bischof von Münster)
- 1497 1511 Johann III. Rode von Wale
- 1511 1558 Christoph von Braunschweig-Lüneburg (Seit 1503 auch Bischof von Verden)
- 1558 1566 Georg von Braunschweig-Lüneburg (Ebenfalls Bischof von Verden)
Ab 1540 führten die Stände gegen den Willen des Bischofs die Reformation durch. Ab 1566 wurden vom Bremer Domkapitel lutherische Administratoren gewählt.
- Die folgenden Personen waren evangelische Administratoren des Bistums Bremen:
-
- von bis Name
- 1567 1585 Heinrich von Sachsen-Lauenburg
- 1585 1596 Johann Adolf von Holstein-Gottorf
- 1596 1634 Johann Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf
- 1634 1648 Friedrich II. (Prinz von Dänemark)
1648 wurde das Erzstift Bremen säkularisiert und ging als Herzogtum Bremen an Schweden.Inhaltsverzeichnis
Schrifttum
Quellen
- Ernst Friedrich Mooyer: Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, S. 15-16.
- Friedrich Wilhelm Ebeling: Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts - Biographisch, literarisch, historisch und kirchenstatistisch dargestellt. 1. Band, Leipzig 1858, S. 58-111.
- Hermann Grote: Stammtafeln, Leipzig 1877, S. 506
Literatur
- Eckhard Danneberg, Heinz-Joachim Schulze (Hrsg.): Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser. Band II Mittelalter, Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, Stade 1995, ISBN 3-9801919-8-2, S. 524-527
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
August III. (Polen)
Friedrich August II. (* 17. Oktober 1696 in Dresden; † 5. Oktober 1763 ebenda) war seit 1733 Kurfürst von Sachsen und als August III. auch König von Polen und Großherzog von Litauen. Er führte nach dem Tod seines Vaters, August I. als zweiter wettinischer Herrscher, die Personalunion Sachsen-Polen fort. Der in Polen auch als August der Sachse (August Sas) bekannte Regent gehörte zu den größten Kunstmäzenen seiner Zeit, stürzte jedoch durch die Fortführung der väterlichen Außenpolitik den Kurstaat Sachsen in die Katastrophe des Siebenjährigen Kriegs.
Leben
Gewöhnlich wird vom Sohn Augusts des Starken und der Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth behauptet, dass er sich wenig um Politik gekümmert hätte. Solche Probleme hätten ihn überfordert. Betont wird, dass er gern Jagden veranstaltete, häufig in die Oper ging, sich um seine umfangreichen Kunstsammlungen kümmerte sowie großen Familiensinn bewies. Auch wenn dies nicht in Zweifel gezogen werden soll, zeigt die neuere polnische Forschung, dass August III. ein sehr fleißiger polnischer König gewesen ist (siehe die Veröffentlichungen von Jacek Staszewski).
Der Kurfürst wurde mit Unterstützung Österreichs und Russlands und den üblichen Bestechungen gegen den Kandidaten Schwedens und Frankreichs, Stanisław Leszczyński, zum König von Polen gewählt, was den Polnischen Thronfolgekrieg auslöste. August III. wurde am 17. Januar 1734 gekrönt und behauptete die Krone im Frieden von Wien 1738. Seine Durchsetzung fand also im Rahmen eines deutlichen Souveränitätsverlusts des einst sehr mächtigen Staates Polen-Litauen statt, der allerdings bereits unter August dem Starken eingesetzt hatte.
Die Spielräume für seine Regierung in Polen-Litauen waren angesichts des Streits zwischen den Magnatengruppen der Czartoryski und Potocki im Sejm äußerst eng. Die Magnatenparteiungen genossen ihrerseits ausländische Unterstützung, so dass Polen-Litauen zum Spielball rivalisierender Nachbarmächte wurde. Fast alle Reichstage blieben ergebnislos (vergleiche Liberum Veto). Ein Beispiel waren die Reichstage von 1744 und 1746, in denen die Krone und der Großkanzler vorsichtig definierte Reformen im Wirtschafts- und Militärsektor auf den Weg bringen wollten. Sie waren jedoch außerstande, die verfeindeten Magnatenparteien überhaupt an einen Tisch zu bringen. Letztlich scheiterten sie im Sejm, unter ausländischer Einmischung. Ohne ordnungsgemäß abgehaltene Sejms mussten die Minister auch keine Rechenschaft ablegen, was die Korruption förderte.
Angesichts dieser Sachlage hofften sich der König und sein Premierminister Brühl in Polen mit dem „Ministerialsystem” sachsentreuer Magnaten (die in Schlüsselpositionen gesetzt wurden) über Wasser zu halten und beide Länder politisch verbinden zu können. Sie erlangten im Siebenjährigen Krieg sogar die Zustimmung ihrer drei Verbündeten für eine erneute Thronkandidatur Sachsens, aber die Erfolge waren nur scheinbar und nicht von Dauer.
Ein bescheidener Wirtschaftsaufschwung war in Polen weiterhin bemerkbar, später beeinträchtigt durch die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges (preußische Münzfälschung, Kontributionen, Requisitionen und teilweise Plünderungen durch russische Truppen).
In Sachsen führte Heinrich von Brühl nach dem Sturz Graf Sulkowskis von 1738 bis 1756 die alleinige Regierung, 1746 wurde er formell Premierminister. Er war ein erfolgreicher Diplomat und festigte die Verwaltung, wurde aber wegen falscher Finanzpolitik im Landtag 1749 scharf angegriffen. Trotz rücksichtsloser finanzieller Maßnahmen Brühls steuerte Sachsen in eine Staatskrise. Der Zwangsumtausch von Vermögenswerten in staatliche Schuldverschreibungen erschütterte die Wirtschaft, die ohnehin zu kleine Armee musste abgerüstet und ein bedeutender Anteil der Steuern verpfändet werden. Dazu kam der Druck von außen, denn der sächsische Export wurde durch die preußische (Zoll-)Politik jener Zeit stark behindert.
Aber erst der Siebenjährige Krieg brachte für Sachsen 1756 den Absturz. Die zu kleine sächsische Armee kapitulierte unter Graf Rutowski kampflos am Lilienstein, August III. und sein Hof zogen nach Warschau um, wo sie bis zum Ende des Krieges in relativer politischer Ohnmacht verblieben. Sachsen, nun behelfsweise von den Preußen und von einigen Kabinettsministern verwaltet, wurde zum Kriegsschauplatz und litt unter den hohen Kontributionen beider Seiten. Es bezahlte zweifellos einen großen Teil der preußischen Kriegskosten („Sachsen ist wie ein Mehlsack, egal wie oft man draufschlägt, es kommt immer noch etwas heraus.” Zitat: Friedrich II. v. Preußen zugeschrieben). Dresden selbst wechselte die Besatzung und wurde von Friedrich II. 1760 belagert, was umfangreiche Zerstörungen zur Folge hatte.
Als der Siebenjährige Krieg im Hubertusburger Frieden 1763 zu Ende ging, war das bis dahin recht wohlhabende Sachsen ruiniert, was der Hof nur ungern zur Kenntnis nahm. Auf die Vergabe der polnischen Krone hatte Sachsen zudem keinerlei Einfluss: Polen-Litauen war mehr denn je unter die Vorherrschaft Russlands geraten; den Nachfolger August III., Stanisław August Poniatowski, bestimmte die Zarin Katharina II. Dauerhafteren Nachruhm bescherte jedoch dem Kurfürst-König seine eingangs erwähnte Liebe zur Kunst.
Baumaßnahmen in Sachsen
- Schloss Hubertusburg
- Katholische Hofkirche, Dresden
- Spitzhaus in Radebeul 1749 nach Plänen von Matthäus Daniel Pöppelmann
Baumaßnahmen in Warschau [Bearbeiten]
- Sächsisches Palais (zerstört 1944)
- Brühlsches Palais (zerstört 1944)
Nachkommen
Am 20. August 1719 heiratete er in Wien
- Maria Josefa Benedikta Antonia Theresia Xaveria Philippine (1699–1757), Erzherzogin von Österreich. Sie hatten gemeinsam folgende fünfzehn Kinder, von denen elf das Kindesalter überlebten:
- Friedrich August Franz Xaver (* 18. November 1720 in Dresden; † 22. Januar 1721 ebd.), Königlicher Prinz von Polen und Kurprinz von Sachsen
- Joseph August Wilhelm Friedrich Franz Xaver Johann Nepomuk (* 24. Oktober 1721 in Pillnitz; † 14. März 1728 in Dresden), Königlicher Prinz von Polen und Kurprinz von Sachsen
- Friedrich Christian Leopold Johann Georg Franz Xaver (1722–1763), Königlicher Prinz von Polen und Kurfürst von Sachsen
- totgeborene Tochter (*/† 23. Juni 1723 in Dresden)
- Maria Amalia Christina Franziska Xaveria Flora Walburga (1724–1760), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen ∞ Karl, Herzog von Parma und Piacenza, König von Spanien, Neapel und Sizilien
- Maria Margareta Franziska Xaveria (* 13. September 1727 in Dresden; † 1. Februar 1734 ebd.), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen
- Maria Anna Sophie Sabina Angela Franziska Xaveria (1728–1797), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen ∞ Maximilian III. Joseph, Kurfürst von Bayern
- Franz Xaver Albert August Ludwig Benno (1730–1806), Königlicher Prinz von Polen und Prinz von Sachsen, Graf von der Lausitz, Administrator von Sachsen
- Maria Josepha Karolina Eleonore Franziska Xaveria (1731–1767), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen ∞ Ludwig Ferdinand, Dauphin von Frankreich
- Karl Christian Joseph Ignaz Eugen Franz Xaver (1733–1796), Königlicher Prinz von Polen und Prinz von Sachsen, Herzog von Kurland und Semgallen
- Maria Christina Anna Theresia Salomea Eulalia Franziska Xaveria (1735–1782), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen, Sternkreuzordensdame und Fürstäbtissin in Remiremont
- Maria Elisabeth Apollonia Kasimira Franziska Xaveria (* 9. Februar 1736 in Warschau; † 24. Dezember 1818 in Dresden), Prinzessin von Polen und Sachsen, Sternkreuzordensdame
- Albert Kasimir August Ignaz Pius Franz Xaver (1738–1822), Königlicher Prinz von Polen, Prinz von Sachsen, Herzog von Teschen und Generalstatthalter der Österreichischen Niederlande
- Clemens Wenceslaus August Hubertus Franz Xaver (1739–1812), Königlicher Prinz von Polen und Prinz von Sachsen, Domherr zu Köln, Propst von St. Johann und Ellwangen, Fürstbischof von Freising, Regensburg und Augsburg, Kurfürst und Erzbischof von Trier
- Maria Kunigunde Dorothea Hedwig Franziska Xaveria Florentina (1740–1826), Königliche Prinzessin von Polen und Prinzessin von Sachsen, Sternkreuzordensdame, Kanonisse zu Münsterbilsen, Fürstäbtissin von Thorn und Essen
Trivia
In der Filmreihe Sachsens Glanz und Preußens Gloria wurde er vom Schauspieler Rolf Hoppe verkörpert.
Literatur
- Jacek Staszewski: August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Akademie-Verlag, Berlin 1996, ISBN 3-05-002600-6
- Thomas Niklas: Friedrich August II (1733-1763) und Friedrich Christian (1763). In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Die Herrscher Sachsens Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089 - 1918. C. H. Beck, München 2005, ISBN 3-406-52206-8, S. 192–222.
- Ariane James-Sarazin, « Hyacinthe Rigaud (1659-1743), portraitiste et conseiller artistique des princes Électeurs de Saxe et rois de Pologne, Auguste II et Auguste III », dans catalogue de l’exposition Dresde ou le rêve des princes, la Galerie de peintures au XVIIIe siècle, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Paris, RMN, 2001, p. 136-142.
- Heinrich Theodor Flathe: Friedrich August II.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 7. Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 784–786.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Philipp II. (Frankreich)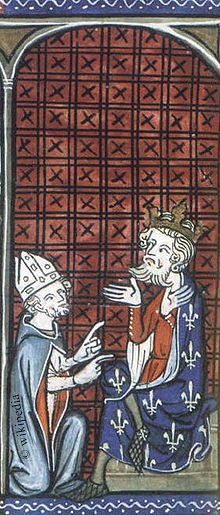
Philipp II. August (fr: Philippe Auguste; * 21. August 1165 in Gonesse; † 14. Juli 1223 in Mantes-la-Jolie), war von 1180 bis 1223 König von Frankreich aus dem Haus der Kapetinger. Er war der einzige Sohn von König Ludwig VII. dem Jüngeren und dessen dritter Gemahlin Adele von Champagne.
Philipp ist einer der bedeutendsten Könige in der mittelalterlichen Geschichte Frankreichs. Seine Herrschaft war bestimmt von dem Kampf gegen das Haus Plantagenet und das „angevinische Reich“. Nach wechselvollen Auseinandersetzungen mit Heinrich II., Richard Löwenherz und Johann Ohneland konnte er letztlich über die Plantagenets siegen und ihnen den größten Teil ihrer französischen Territorien entreißen. Dies ermöglichte den Durchbruch des kapetingischen Königtums. Zugleich verhalf sein Sieg über Otto IV. in der Schlacht bei Bouvines 1214 dem Staufer Friedrich II. zum römisch-deutschen Königtum.
Philipps Beiname ist zeitgenössisch. Er ist dem kaiserlichen Titel Augustus (franz: Auguste, dt.: der Erhabene) entliehen und wurde ihm von seinem Biographen Rigord geben. Der erkannte in dem König, entsprechend der Definition des Titels, einen „Mehrer des Reiches“.
Anfang und Herrschaftskonsolidierung
Philipp wurde als Kind häufig „Dieudonné“ (Gottgegebener) genannt, da seine Geburt eine dynastische Krise beendete und die Kontinuität der kapetingischen Dynastie wahrte. Er wurde erst im achtundzwanzigsten Regierungsjahr seines Vaters geboren und stammte, als erster und einziger Sohn, aus dessen dritter Ehe. Trotz dieses Hintergrundes zögerte Ludwig VII., seinen Sohn zum Mitkönig krönen zu lassen, um die Nachfolge Philipps zu sichern. Vermutlich lag diesem Zögern das abschreckende Beispiel des Hauses Plantagenet zugrunde, in dem sich die Söhne mit dem Vater um die Macht stritten. Erst nachdem die Gesundheit des Königs nachließ, berief er 1179 eine Adelsversammlung ein, um sich Rat einzuholen. Als sich die Mehrheit der Versammlung durch Akklamation für die Krönung Philipps aussprach, wurde dieser am 1. November 1179 in Reims zum König gekrönt und gesalbt.
Nach dem Tod Ludwigs VII. am 18. September 1180 konnte Philipp so unbestritten die Nachfolge als König antreten. Allerdings galt er zu diesem Zeitpunkt mit fünfzehn Jahren noch als unmündig, weshalb sich für die nächste Zeit eine Regentschaft für das Land abzeichnete, die sich aus Philipps Mutter, Adele von Champagne, und deren Brüdern Erzbischof Wilhelm von Reims, Graf Theobald von Blois und Graf Stephan von Sancerre, zusammensetzte. Diese Gruppierung hatte schon in den letzten Lebensjahren Ludwigs VII. den königlichen Hof dominiert und für den zeitweise regierungsunfähigen König die Macht ausgeübt.
Philipp aber gedachte trotz seiner Jugend, die Macht sofort zu übernehmen und stellte sich damit gegen seine Mutter und seine Onkel. Gegen diese gewann er mit dem Grafen Philipp von Flandern einen mächtigen Verbündeten. Gegen den Willen seiner Mutter heiratete er am 28. April 1180 die Nichte des Grafen von Flandern, Isabella von Hennegau, und vollzog damit einen Bruch mit seiner Verwandtschaft. Die Situation artete in einen regelrechten Krieg aus; Adele von Champagne floh in die Normandie in der Hoffnung, Heinrich II. Plantagenet, den wohl mächtigsten Mann Frankreichs zu jener Zeit, als Verbündeten gegen ihren Sohn zu gewinnen. Aber Heinrich Plantagenet hatte andere Pläne als sich gegen seinen Lehnsherren zu wenden, da er zu dieser Zeit mit der Durchsetzung der Ansprüche seines Schwiegersohnes, Heinrich des Löwen, in Deutschland beschäftigt war. Auch galt es nach den Konventionen des mittelalterlichen Lehnsrechts als unehrenhaft, die Minderjährigkeit eines Lehnsherrn auszunutzen um ihn anzugreifen. Stattdessen trafen sich Philipp und Heinrich Plantagenet am 28. Juni 1180 in Gisors, um ein gemeinsames Verteidigungsbündnis zu schließen.
Diese Entwicklung führte im Gegenzug zu einem Bruch Philipps mit dem Grafen von Flandern, der ein Rivale der Plantagenet war. Am 14. Mai 1181 schloss sich in Provins der Graf von Flandern mit den Grafen von Blois-Champagne zusammen, denen sich auch die Grafen von Nevers und Hennegau sowie der Herzog von Burgund anschlossen. Die Krondomäne war so von der feindlichen Allianz fast eingeschlossen. Auf Druck Heinrich Plantagenets aber beendeten 1182 der Erzbischof von Reims und die Grafen von Blois-Champagne ihre Opposition zu Philipp und erkannten dessen Herrschaft an. Der jungen Königin Isabella gelang es, auch ihren Vater aus dem Bündnis zu lösen. Nur das Verhältnis zum Grafen von Flandern blieb feindselig. Es verschärfte sich zusätzlich durch den Tod von dessen erster Frau 1182, deren Erbe, die Grafschaft Vermandois, Philipp zurückforderte. Der Graf von Flandern wurde durch ein gescheitertes Bündnisangebot an Kaiser Friedrich Barbarossa zunehmend isoliert. Nachdem sich der Krieg nach einigen Siegen zugunsten König Philipps wendete, war auch der Graf von Flandern zur Unterwerfung bereit. Im Vertrag von Boves 1185 gewann der König die Stadt Amiens und 65 Burgen im Vermandois und sicherte sich die Anwartschaft auf die Grafschaft Artois als Mitgift seiner Frau. Der Graf von Flandern konnte den nördlichen Teil des Vermandois behalten.
Somit hatte sich Philipp bis zum Jahr 1185, mittlerweile mündig geworden, gegenüber seinen Konkurrenten behauptet und die Alleinherrschaft übernommen.
Die angevinische Bedrohung
Philipps Königtum
Philipp trat ein schwieriges Erbe an. Sein Vater hinterließ ihm einen geordneten und effizienten Verwaltungsapparat. Der voranschreitende wirtschaftliche Aufschwung von Städten wie Paris und Orléans sicherte der Krone ständige Einnahmequellen. Die Macht des Königs aber beschränkte sich auf die Krondomäne, ein Gebiet, das die Städte Orléans, Sens, Senlis und Mantes umfasste, während der große Rest des Königreiches von mächtigen Feudalfürsten beherrscht wurde. Philipps Vater und Großvater hatten bereits versucht, die Macht solcher nahezu unabhängigen Fürsten zu brechen, jedoch ohne Erfolg. Während der Regierung König Ludwigs VII. entstand ein weiteres Machtgefüge, das sogenannte „Angevinische Reich“, das sich über den gesamten Westen des Landes, von den Pyrenäen bis zum Ärmelkanal, erstreckte. Es war in den Händen des Hauses Plantagenet und in Personalunion vereint mit dem englischen Königreich.
Wie schon sein Vater verfolgte Philipp seit dem Beginn seiner Herrschaft eine Politik, die zur Zerschlagung des angevinischen Reichs führen sollte. Zwei wichtige Faktoren kamen ihm dabei zugute. Zum einen war er der Lehnsherr für die französischen Territorien und zum anderen waren die Söhne von Heinrich II. Plantagenet untereinander zerstritten und führten Krieg gegen den eigenen Vater.
Gegen Heinrich II. Plantagenet
Obwohl Heinrich II. Plantagenet in den ersten Jahren von Philipps Herrschaft als dessen Schutzherr aufgetreten war, förderte Philipp in dieser Zeit den Konflikt bei den Plantagenets, um diese zu schwächen. Ein Vorwand war das seit Jahren anhaltende Verlöbnis seiner älteren Schwester Alice (Alix) mit Richard Löwenherz, einem jüngeren Sohn Heinrichs II. und Herzog von Aquitanien. Die Ehe des Paares sollte den Besitzstatus des normannischen Vexin bei den Plantagenets legitimieren, doch die Weigerung Richards, die Prinzessin zu heiraten, gab Philipp eine rechtliche Handhabe, gegen die Plantagenets vorzugehen.
Bereits 1183 unterstützte Philipp den ältesten Sohn Heinrichs II., Heinrich den Jüngeren, indem er ihm im Kampf gegen dessen Vater Geld und Söldner zukommen ließ. Doch der jüngere Heinrich verstarb plötzlich noch im selben Jahr, und König Heinrich II. blieb Sieger in dieser Auseinandersetzung. In einem erneuten Treffen in Gisors am 6. Dezember 1183 musste Philipp den alten Heinrich in dessen Besitzungen anerkennen. Aber schon im folgenden Jahr konnte er erfolgreich einen weiteren Sohn Heinrichs, den Herzog Gottfried von Bretagne, dazu bewegen, an den Hof nach Paris zu kommen und ihm für die Bretagne zu huldigen. Auch wenn Gottfried im Jahre 1186 nach einem Turnierunfall verstarb, konnte die Bretagne dauerhaft von den Plantagenets gelöst werden, da sich dessen Witwe gegen die Familie ihres Mannes stellte.
Philipp ging nun unverzüglich dazu über, den nächsten Sohn Heinrichs, Richard Löwenherz, für seine Zwecke zu gewinnen. Dabei spielte ihm die anstehende Nachfolgefrage im Gesamtbesitz der Plantagenets in die Hände. Heinrich bevorzugte seinen jüngsten Sohn Johann Ohneland als Erben, den er mit der Prinzessin Alice (Alix) verheiraten und mit der Normandie belehnen wollte. Dies wiederum trieb Richard in die Arme Philipps, der Heinrichs Erbpläne ablehnte, die im Jahr 1187 in Paris ein Zweckbündnis gegen Heinrich schlossen. Aus der so entstandenen Abhängigkeit Richards zu Philipp konnte dieser profitieren, nachdem er Richard 1187 zwang, sein Vorgehen gegen den Grafen Raimund V. von Toulouse zu beenden. Dies brachte Philipp die Eroberung von Issoudun im Berry ein. Anschließend richteten beide ihren Kampf gegen Heinrich, indem Philipp den Gewinn des Berry durch die Einnahme von Châteauroux 1188 abrunden konnte.
Im November 1188 kam es daraufhin zu einem Treffen Heinrichs II., Richards und Philipps in Bonmoulins. Ein Friedensschluss scheiterte, vor allem nachdem Richard an Philipp für den gesamten französischen Besitz der Plantagenets gehuldigt hatte. Für Heinrich war dies nicht hinnehmbar, da dies seine Enteignung in Frankreich und auch eine Trennung des Festlandes von England bedeutete. Weiterhin demonstrierten Richard und Philipp die Unerschütterlichkeit ihrer Allianz mittels öffentlicher Vertrauensgesten, wie einem Bruderkuss oder das Übernachten in einem Bett. Heinrich zog sich darauf nach England zurück, um 1189 mit einem Heer nach Frankreich zurückzukehren und den Entscheidungskampf mit Richard und Philipp zu führen. Diese aber waren ihm militärisch überlegen, verdrängten ihn aus der Touraine, drangen in das Maine vor und zwangen Heinrich am 12. Juni 1189 zur Flucht aus Le Mans nach Chinon. Am 4. Juli 1189 war Heinrich gezwungen den Friedensvertrag von Azay-le-Rideau zu schließen, worin er alle Eroberungen Philipps bestätigen, ihm für den restlichen Besitz huldigen und Richard als Erben anerkennen musste. Zwei Tage später starb Heinrich in Chinon.
Der Dritte Kreuzzug
Mit Heinrichs Tod zerfiel das Bündnis zwischen Philipp und Richard, da dieser nun die Position seines Vaters als König von England und Oberhaupt des „angevinischen Reichs“ einnahm und somit der neue Hauptgegner Philipps wurde. Obwohl Richard am 22. Juli 1189 in Chaumont-en-Vexin dem französischen König für alle Festlandsbesitzungen huldigte, verweigerte er weiterhin die dringlich geforderte Ehe mit Alice (Alix), womit der Konflikt um das Vexin weiterhin aktuell blieb. Eine direkte Konfrontation beider Könige blieb zunächst aus, da das christliche Abendland seit dem Verlust von Jerusalem an die Muslime im Jahr 1187 einen Kreuzzug zur Rückeroberung der Stadt verlangte. Philipp, Richard und Heinrich hatten schon in Azay über einen Kreuzzug verhandelt, den die ersten beiden nun gemeinsam ausführen wollten. Das lag in erster Linie daran, dass keiner dem anderen wirklich traute und die Abwesenheit des einen Königs einen unvorstellbaren Vorteil für den Daheimgebliebenen bedeutet hätte. Die Abreise verzögerte sich zunächst, da Richard mit der Unterwerfung einiger Vasallen in der Gascogne beschäftigt war und Philipps Frau, Isabella von Hennegau, am 15. März gestorben war. Als beide Könige am 4. Juli 1190 in Vézelay ihren Kreuzzug offiziell begannen, war in Kleinasien bereits Kaiser Friedrich I. Barbarossa gestorben. Die Regentschaft Frankreichs übergab Philipp dem königlichen Rat unter Vorsitz seiner Mutter Adele und Erzbischof Wilhelm von Reims. Philipp sorgte dafür, dass ihnen der Zugriff auf den Staatsschatz verwehrt blieb, der den Templern zum Schutz anvertraut wurde, wobei sechs angesehene Bürger aus Paris die Schlüssel der Geldtruhen erhielten.
Nach einigen Verzögerungen erreichte Philipp am 20. April 1191 das Lager der Kreuzfahrer vor Akkon. Richard hingegen war zunächst mit der Eroberung von Zypern beschäftigt. Dort heiratete er die Prinzessin Berengaria von Navarra, mit der er sich bereits in Sizilien verlobt hatte. Damit war eine Verbindung mit Prinzessin Alice (Alix) unmöglich geworden. Für Philipp stellte diese Zurückweisung seines Vasallen einen erheblichen Ansehensverlust dar, zumal Richard auch die Forderung auf die Restitution des Vexins ignorierte. Am 21. Juli 1191 fiel Akkon in die Hände der Kreuzfahrer, wenige Tage danach erklärte Philipp seine Rückkehr in die Heimat. Als Vorwand diente ihm der Tod des Grafen Philipp von Flandern während der Belagerung, dessen Erbe geregelt werden musste, wobei es auch um die Durchsetzung eines Anrechtes der Krone auf das Artois ging. Richard ließ ihn auf das Evangelium schwören, keinen Angriff auf seinen französischen Besitz zu wagen, wies aber dennoch seine Bankiers in Pisa an, den Sold für seine Grenztruppen zu erhöhen. Er selbst blieb noch in Palästina um weiter gegen Saladin zu kämpfen.
Auf der Heimreise traf sich Philipp in Rom mit Papst Coelestin III., von dem er vom Kreuzzugsgelübte entbunden wurde. Gegenüber dem Papst bekräftigte er, wenn auch erfolglos, dass Richard Löwenherz die Hauptverantwortung für die gescheiterte Rückeroberung Jerusalems trage. Anschließend traf er sich in Mailand mit Kaiser Heinrich VI., dem Nachfolger Barbarossas, um die staufisch-kapetingische Allianz zu erneuern. Eine Vermittlerrolle übernahm dabei Herzog Leopold V. von Österreich, der den englischen König hasste, weil dieser ihn vor Akkon gedemütigt hatte indem er das herzogliche Banner vom Stadtwall hatte herunterreißen lassen. Zusätzliche Interessen verbanden Philipp mit dem Kaiser, nachdem Richard 1191 mit dem König Tankred von Sizilien ein Beistandsabkommen gegen den Kaiser geschlossen hatte. Zu Weihnachten 1191 weilte Philipp bereits wieder in Fontainebleau und begann mit der Forcierung seines Kampfes gegen Richard. Dazu ließ er Gerüchte verbreiten, in denen er den englischen König beschuldigte, einen Mordanschlag gegen ihn in Akkon durchführen wollte, was einige der Vasallen Richards tatsächlich auf die Seite Philipps führte.
Nachdem Richard nach den Verhandlungen mit Saladin im Oktober 1192 die Rückreise angetreten hatte, geriet er bei der Passierung von Österreich in die Hände Herzog Leopolds, von dem er unverzüglich an Kaiser Heinrich ausgeliefert wurde.
Der angevinische Krieg
Gegen Richard Löwenherz
Die Gefangennahme seines Rivalen nutzte Philipp II. im Frühjahr 1193 zum Angriff auf dessen Territorien. Zuerst rückte er in die Normandie vor wo er Burgen wie Pacy, Ivry und vor allem das lang geforderte Gisors einnehmen konnte. Richard ermächtigte aus seiner Haft heraus ein Friedensabkommen (Mantes, 9. Juli 1193), indem er Philipp die Eroberungen bestätigte. Anschließend versuchte Philipp erneut eine Spaltung in der Plantagenetfamilie herbeizuführen, indem er die Ambitionen Johanns Ohneland gegen dessen Bruder unterstützte. Johann erklärte sich für diese Unterstützung in einem Geheimvertrag bereit die gesamte Normandie rechts der Seine, einschließlich Rouen, sowie die Touraine an Philipp zu übergeben. Auch war er bereit für den Fall einer erfolgreichen Übernahme des englischen Thrones den Lehnseid für England an Philipp zu leisten.
Diesen Plänen setzte sich die Mutter der beiden angevinischen Brüder, Königin Eleonore, entgegen. Sie strengte eine schnelle Herauslösung Richards aus der Gefangenschaft an, die wiederum Philipp und Johann durch eigene Lösegeldangebote an den Kaiser hinauszuzögern versuchten. Eleonore aber veranlasste ihren gefangenen Sohn dem Kaiser den Lehnseid zu leisten und nachdem sie das immense Lösegeld aufgebracht hatte, ließ der Kaiser Richard im Frühjahr 1194 frei. Der brachte zunächst die Verhältnisse in England wieder unter seine Kontrolle und setzte im Mai 1194 mit einem Heer auf das Festland über. Nach und nach eroberte Richard seine Burgen in der Normandie zurück, marschierte anschließend in den Süden und vertreib Philipp nach dem Gefecht von Fréteval aus der Touraine. Am 15. Januar 1196 war Philipp zur Unterzeichnung des Friedens von Louviers genötigt, indem er aber von Richard auch einige Zugeständnisse, wie zum Beispiel die direkte Lehnshoheit über die Auvergne, erhielt.
Der Frieden hielt nicht mal ein halbes Jahr. Nachdem Richard bei der Unterwerfung der Bretagne scheiterte und die regierende Herzogin ihren Sohn Arthur, der Richards Neffe und designierte Erbe war, an den Hof von Paris entsandte, begannen die Kämpfe von neuem. Philipp eroberte im Juni 1196 die normannische Burg Aumale. Richard reagierte darauf mit einem Bündnis mit dem Grafen Balduin IX. von Flandern und unterstützte 1198 die Thronkandidatur seines Neffen Otto von Braunschweig in Deutschland. Philipp versuchte die sich anbahnende Umklammerung Frankreichs durch das angevinisch-welfische Bündnis mit einer Offensive zu begegnen, aber im September 1198 musste er in der Schlacht bei Gisors eine schwere Niederlage gegen Richard hinnehmen.
In den Friedensverhandlungen von 1199, die unter der Vermittlung des Klerus eingeleitet wurden, musste Philipp herbe Rückschläge hinnehmen. Der französische Kronprinz sollte eine Tochter des mit Richard verbündeten Königs von Kastilien heiraten, Richards Besitzstand auf dem Festland sollte bestätigt werden. Weiterhin sollte Philipp die Wahl Ottos von Braunschweig zum römisch-deutschen König anerkennen, lediglich mit der Überlassung der Burg Gisors wurde ihm entgegengekommen. Seine militärische Unterlegenheit gegenüber Richard brachte die gegen die Plantagenets gerichtete Politik Philipps an den Rand des Scheiterns. Doch im April 1199 wendete sich die Lage überraschend als Richard Löwenherz im Kampf gegen den Vizegrafen von Limoges tödlich verwundet wurde. Dem französischen König eröffnete dies eine neue Möglichkeit den Kampf gegen die Plantagenets weiter zu führen.
Gegen Johann Ohneland
Die Nachfolge Richards trat sein jüngerer Bruder Johann Ohneland an, obwohl es unter den angevinischen Vasallen zu Unsicherheiten in Bezug auf die Erbrechte Arthurs von Bretagne kam. Zwar wurde Johann in England und der Normandie allgemein anerkannt, aber besonders die Grafschaft Anjou war von der Nachfolge Johanns nicht überzeugt und hielt zu Arthur. Da das ausgehandelte Friedensabkommen noch nicht unterschrieben war, nahm Philipp die Chance war, machte sich zum Verteidiger der Rechte Arthurs und griff Johann an. Da Johann einem direkten Kampf aus dem Weg ging, erlangte Philipp so bis zum Jahr 1200 eine weitaus bessere Verhandlungsbasis als er noch gegenüber Richard gehabt hatte. Seine Aktionen waren durchaus vielversprechend, doch die eigene familiäre Situation zwang den König von Frankreich zum Einlenken.
Im Jahr 1193 hatte Philipp die dänische Prinzessin Ingeborg, die Schwester des Dänenkönigs Knut VI. geheiratet, um diesen zu einem Bündnis gegen Richard zu bewegen. Aber schon am Tag nach der Hochzeit verlangte Philipp die Trennung von der Braut, da er sie als zu abstoßend empfand. Ingeborg verwehrte allerdings ihre Zustimmung zu einer Scheidung, worauf Philipp sie verstieß und die deutsche Adlige Agnes von Meran heiratete. Die sich daraus ergebende Bigamie veranlasste Papst Innozenz III. zur drastischen Schritten und verhängte 1198 das Interdikt über Frankreich. Der Handlungsspielraum Philipps in seinem Königreich wurde dadurch zunehmend bedroht, vor allem weil seine treusten Unterstützer in den Reihen des Klerus standen. Aber auch international wurde seine Position gefährdet, da seine wichtigsten außenpolitischen Verbündeten der Papst selbst und auch die Staufer im Reich waren. Deshalb war Philipp 1200 zu einem Frieden mit Johann genötigt der im Vertrag von Le Goulet besiegelt wurde. Darin trat Johann einige Gebiete in der Normandie an Philipp ab und anerkannte ihn als Oberlehnsherren der restlichen Festlandsbesitzungen. Philipp ließ im Gegenzug seine Unterstützung für Arthur fallen.
Das anschließende Fehlverhalten Johanns spielte Philipp aber erneut einen Vorwand gegen ihn vorzugehen in die Hände. Johann hatte im Sommer 1200 Isabella von Angoulême geheiratet, die aber schon dem Grafen Hugo X. von Lusignan versprochen war. Lusignan war als aquitanischer Graf ein Vasall Johanns, der somit als Instanz zur Beschwerde für ihn nicht in Frage kam. Stattdessen wandte sich Lusignan an König Philipp, welcher wiederum der Lehnsherr Johanns für Aquitanien war. Philipp ergriff die Gelegenheit Johann rechtlich zu belangen und eröffnete einen Lehnsprozess gegen ihn. Um gleichzeitig eine Versöhnung mit dem Papst zu erreichen berief er im Mai 1201 ein Konzil in Soissons ein, auf dem er Ingeborg wieder an seine Seite holte. Und nachdem Agnes von Meran im Juli 1201 gestorben war hob der Papst das Interdikt auf und legitimierte deren Kinder. Nachdem Johann bis zum Jahr 1202 vier Vorladungen vor das Hofgericht in Paris ignoriert hatte sprach Philipp ein Versäumnisurteil über ihn und erklärte ihn all seiner Länder in Frankreich für verlustig. Der erneut entbrannte Krieg konnte somit als Vollstreckung eines ordentlichen Urteils und nicht als Eroberungsfeldzug gelten. Der französische König griff erneut auf Arthur von Bretagne zurück und dieser huldigte ihm für alle angevinischen Ländereien. Arthur griff im Juli 1202 seinen Onkel mit einem Heer im Anjou an und belagerte seine Großmutter Eleonore in Mirebeau, dort aber wurde er am 1. August 1202 von Johann überrascht und gefangen genommen.
Als sich im Jahr 1203 die Nachricht von der Ermordung Arthus in Rouen durch Johann verbreitete kam es zu einem allgemeinen Abfall dessen Vasallen, die sich nun direkt König Philipp anschlossen. Der nutzte die Situation und marschierte in die Normandie ein. Im April 1204 konnte er die angeblich uneinnehmbare Burg Château-Gaillard durch Verrat an sich bringen, womit ihm der Weg nach Rouen frei gelegt wurde. Dort marschierte er am 24. Juni 1204 ein, nachdem die Stadt bereits am 1. Juni kampflos kapituliert hatte. Anschließend wandte er sich nach Aquitanien, wo bereits im April 1204 die Herzogin Eleonore gestorben war, und zog am 11. August in Poitiers ein. Johann konnte dem nichts entgegensetzen und war am 13. Oktober 1206 zur Unterzeichnung des Waffenstillstandes von Thouars bereit. Er verzichtete darin auf den ganzen Besitz der Plantagenetfamilie nördlich der Loire. Die betreffenden Territorien wie Normandie, Maine, Anjou und Touraine konnte Philipp nun der Krondomäne hinzufügen, die er der königlichen Verwaltung unterstellte. Damit endete auch die von Wilhelm dem Eroberer 1066 geschaffene Verbindung zwischen der Normandie und England. Johann behielt Aquitanien und die Gascogne, wenngleich er diesen Gebieten fortan kaum noch Beachtung schenkte.
Der Deutsche Thronstreit
Aufs engste verbunden mit dem Krieg zwischen Kapetingern und Plantagenet war der deutsche Thronstreit im heiligen römischen Reich zwischen den Staufern und Welfen, der 1197 nach dem Tod Kaiser Heinrich VI. ausgebrochen war. Das strategische Interesse beider Seiten gebot ihre Einflussnahme in die politischen Verhältnisse Deutschlands. Die Plantagenets unterstützten naturgemäß ihre welfischen Verwandten um somit gegen den König von Frankreich eine zweite Front eröffnen zu können. Dagegen war Philipp daran gelegen eine solche angevinisch-welfische Umklammerung zu verhindern und förderte die Staufer als Gegengewicht zu den Welfen. Beide Parteien wählten im Sommer 1198 mit Philipp von Schwaben beziehungsweise Otto IV. von Braunschweig ihre Kandidaten zu Könige, worauf sich in den folgenden Jahren ein Machtgleichgewicht im Reich einstellte. Bis im Jahre 1208 der Staufer Philipp von Schwaben in Bamberg einem Mordanschlag zum Opfer fiel, so dass Otto IV. einziger deutscher Herrscher war und die alte staufisch-kapetingische Allianz gegenstandslos zu werden drohte. Zwar versuchte Philipp den Herzog Heinrich von Brabant, der Geldlehen von ihm empfing, zum Nachfolger für den ermordeten Philipp von Schwaben zu gewinnen, doch wurde Otto mittlerweile sogar von den führenden Anhängern der staufischen Partei als König anerkannt. Selbst Papst Innozenz III. lieh seine Unterstützung dem Welfen, da er hoffte durch ihn die staufische Politik zur Vereinigung Siziliens mit dem Reich beenden zu können. Nachdem Otto IV. im Oktober 1209 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde drohte Frankreich außenpolitisch isoliert zu werden.
Die Wende brachte die Fortführung der staufischen Italienpolitik durch Otto IV., die den Papst dazu zwang seine Position zu überdenken. Im November 1210 verhängte der Papst den Kirchenbann über den Kaiser, wodurch die staufische Sache eine Wiederbelebung erfuhr. Philipp nahm Kontakt zu den alten Stauferanhänger im Reich auf, wo es ihm gelang den Landgrafen Hermann I. von Thüringen vom Kaiser zu lösen. Im September 1211 erreichte der junge Staufer Friedrich II., die Alpen überquerend, Deutschland und wurde dort von seinen Anhängern zum König gewählt und gekrönt. Im November desselben Jahres wurde die kapetingisch-staufische Allianz bei einem Treffen zwischen Friedrich und Prinz Ludwig in Vaucouleurs erneuert.
Die Schlacht bei Bouvines
Während dieser Vorgänge im Reich war Philipp nach der Zerschlagung des angevinischen Reichs 1204 damit beschäftigt, die Herrschaft der Krone im Norden des Landes zu konsolidieren und sie auf die umliegenden Vasallen auszudehnen, was nicht ohne Widerstand geschah. Problematisch gestaltete sich die Situation in Flandern, wo Philipp seit dem Beginn seiner Regierung um das Erbe seiner ersten Ehefrau, Isabella von Hennegau, streiten musste. Um den Grafen Balduin IX. von Flandern aus der Allianz mit den Plantagenets zu lösen, hatte er ihm im Vertrag von Péronne 1200 große Teile des Artois überlassen müssen. Graf Balduin starb 1204 als Kreuzfahrer in Griechenland und hinterließ nur Töchter. Die älteste Tochter und Erbin Johanna wurde von Philipp im Jahr 1212 mit dem portugiesischen Prinzen Ferdinand (Ferrand) verheiratet. Philipps Sohn, Prinz Ludwig, drängte darauf, das Erbe seine Mutter Isabella antreten zu können, und zwang das flandrische Grafenpaar zur Herausgabe des Artois. In der Bretagne stärkte Philipp seinen Einfluss, indem er seinen Vetter Peter Mauclerc mit der Erbherzogin Alix verheiratete. Während des Erbfolgekrieges in der Champagne unterstützte er die Position der Gräfin Blanka und deren unmündigen Sohn Theobald IV. gegen ihre Gegner, auch hier zum Vorteil der königlichen Interessen.
Im April 1213 wurde auf einem Hoftag in Soissons eine Invasion in England beschlossen. Die Chance, damit Johann Ohneland endgültig zu vernichten und gleichzeitig eine Vereinigung Englands mit Frankreich zu begründen, erschien günstig, da sich Johann durch eine aggressive Kirchenpolitik mit seinem Klerus überworfen hatte, was den Erzbischof von Canterbury zur Flucht nach Frankreich veranlasste. Dies hatte zur Folge, dass der Papst den englischen König seines Amtes enthob und ihn exkommunizierte. Philipp sah sich nun als Vollstrecker des päpstlichen Willens und sammelte sein Heer in Boulogne. Doch Johann war sich seiner Gefahr bewusst, unterwarf sich am 15. Mai 1213 in aller Form dem Papst, der ihm vergab, woraufhin die Invasion abgebrochen werden musste. Graf Ferrand von Flandern hatte während dieser Ereignisse nur halbherzig seine Unterstützung dem König geliehen und forderte danach eine finanzielle Entschädigung für den Verlust des Artois. Philipp und Ludwig wendeten daher das in Boulogne zusammengestellte Heer nach Flandern, um Ferrand zu unterwerfen. Der Feldzug war zwar militärisch erfolgreich, bis Juni 1213 konnte Ferrand aus Flandern vertrieben und das Land unter Kontrolle gebracht werden. Lediglich der Verlust der Flotte im Hafen von Damme musste hingenommen werden. Der Graf von Flandern und mit ihm einige andere französische Vasallen wie die Grafen Rainald I. von Dammartin und Rudolf I. von Eu flohen nach England, wo sie zu Johann Ohneland als ihrem neuen Lehnsherrn huldigten. Johann erkannte darin eine allgemeine Abfallbewegung der französischen Vasallen von ihrem König und rüstete zum entscheidenden Feldzug nach Frankreich um die verloren gegangenen Festlandsbesitzungen der Plantagenets zurückzuerobern. Sein Verbündeter, Kaiser Otto IV., versammelte seinerseits sein Heer um durch einen Sieg über Frankreich seine Lage gegenüber den Staufern in Deutschland zu wenden und den Thronstreit für sich zu entscheiden.
Im Frühjahr 1214 landete Graf Ferrand mit einem englischen Kontingent unter dem Grafen William Longesée von Salisbury an der Küste Flanderns, eroberte einige Städte zurück und wartete auf das Heer des Kaisers, um sich mit diesem zu vereinen. Gleichzeitig war Johann Ohneland mit starken Truppen bei La Rochelle an der Küste des Poitou gelandet, eroberte das bretonische Nantes und marschierte in das Anjou vor. Prinz Ludwig beendete einstweilen den Kampf in Flandern und zog Johann entgegen. Am 2. Juli 1214 überraschte er ihn bei der Belagerung von Roche-aux-Moines, überfiel sein Heer und trieb es in das Poitou zurück. Johann musste dabei sein gesamtes Belagerungsgerät zurücklassen, womit ihm die weitere Fortführung des Eroberungszuges verwehrt wurde. Während Prinz Ludwig weiter gegen Johann vorging, versammelte Philipp seinen Heerbann, der sich hauptsächlich aus Rittern und Kommunalmilitzen der Île-de-France zusammensetzte, in Erwartung auf den Angriff des Kaisers. Mit den Bannern der Oriflamme und der königlichen Lilien an der Spitze marschierte er im Juli 1214 nach Flandern. Dort traf er an einem Sonntag dem 27. Juli bei der Ortschaft Bouvines auf das kaiserliche Heer. An dem wechselreichen Kampf nahm Philipp mit persönlichem Einsatz teil und wurde dabei von gegnerischen Rittern vom Pferd gezogen. Nur das rechtzeitige Eingreifen der königlichen Ritter verhinderte seine Gefangennahme. Die Entscheidung im Kampf wurde durch die Flucht des Kaisers und seiner Ritter herbeigeführt, die Grafen von Flandern, Dammartin und Salisbury wurden gefangen genommen.
Der Sieg bei Bouvines war einer der entscheidendsten des Mittelalters. Philipp konnte darin seine Erfolge gegen die Plantagenets aus den Vorjahren verteidigen, Johann Ohneland erkannte am 18. September 1214 in Chinon in einem neuerlichen Waffenstillstand die 1204 geschaffenen Verhältnisse an. Wenn auch der angevinische Krieg formell erst mit dem Vertrag von Paris 1259 beendet wurde, stellten die Plantagenets keine Gefahr mehr für das kapetingische Königtum dar. Im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts waren Englands Könige hauptsächlich in Auseinandersetzungen mit ihren eigenen Baronen verwickelt, schon Johann musste ihnen 1215 die Magna Carta gewähren. Zugleich legte Philipp mit diesem Sieg den Grundstein zum Aufstieg der französischen Krone zur vorherrschenden Macht in Westeuropa beim gleichzeitig einsetzenden Verfall der kaiserlichen Macht. Den damit begründeten Wandel im Verhältnis zwischen Frankreich und dem Reich machte Philipp symbolisch deutlich, indem er den erbeuteten goldenen Trosswagen Ottos in die Kaiserpfalz nach Haguenau zu seinem Verbündeten Friedrich II. schickte und diesem dort die Reichsstandarte mit den gebrochenen Schwingen des Reichsadlers vor die Füße legen ließ.
Letzte Jahre
In den letzten zehn Jahren seines Lebens beschäftigte sich Philipp vorrangig mit dem Ausbau des Erreichten und der Reformierung der Verwaltungs- und Lehnsstrukturen seines Königreiches. Im Jahr 1216 eröffnete sich ihm sogar die Möglichkeit zu einer Vereinigung Englands mit Frankreich, als die dortigen Barone seinen Sohn Ludwig einluden ihr König zu werden. Ludwig konnte fast das gesamte englische Königreich erobern, bis König Johann Ohneland starb. Dessen unmündiger Sohn Heinrich III. wurde aber umgehend von dem loyal gebliebenen William Marshal gekrönt und unter dem Schutz des Papstes gestellt. Philipp entzog darauf seinem Sohn die Unterstützung, der sich bis 1217 aus England zurückziehen musste.
Ein weiteres für Frankreich bedeutendes Ereignis zu Philipps Lebzeiten spielte sich im Süden (Okzitanien) seines Königreiches ab. Dort herrschten vorwiegend kleine Allodialbesitzer, was einen gefestigten Vasallenverband wie es ihn im Norden Frankreichs gab nahezu ausschloss. Das kapetingische Königtum war hier allenfalls nur formal anerkannt, einige Gebiete standen bereits unter der Lehnshoheit der Krone von Aragón. War der nördliche Teil Frankreichs seit dem 11. Jahrhundert von der Kirchenreform erfasst worden, so konnte der Klerus in Okzitanien die Forderungen nach apostolischer Lebensführung und der damit verbundenen Vorbildfunktion nicht erfüllen, weil die Kirchenreform nahezu spurlos an diesem Landstrich vorüberging. Seit dem 11. Jahrhundert füllte diese Lücke die neue Glaubensgemeinschaft der Katharer. Etwa ein Viertel der Bevölkerung der Grafschaft Toulouse war Mitglied dieser Bewegung. In der Führungsschicht wurde diese neue Religion recht verbreitet, was nicht zuletzt an der Ablehnung der den Zehnten fordernden Amtskirche Frankreichs lag.
Die römische Amtskirche erklärte den Katharimus zur Häresie und rief 1208 zu einem Kreuzzug gegen die Katharer und ihre Unterstützer auf (Albigenserkreuzzug). König Philipp konnte trotz des Wunsches des Papstes sich nicht an diesem Krieg beteiligen, weil ihn seine Feldzüge gegen Johann von England vollkommen in Anspruch nahmen. Dennoch konnte er indirekt Einfluss auf den Verlauf des Kreuzzuges nehmen, indem er dessen Anführer Simon de Montfort Anweisungen erteilte. Montfort schlug am 13. September 1213 am die Gegner des Kreuzzuges in der Schlacht bei Muret und konnte im Anschluss eine Herrschaft im Süden errichten, die er nach nordfranzösischen Vorbild einrichtete. Aber der Krieg zog sich in die Länge und Montfort wurde 1218 bei der Belagerung von Toulouse tödlich verwundet wird, sein Sohn war nicht fähig den Kreuzzug erfolgreich fortzuführen. Im Jahr 1219 schickte Philipp daher seinen Sohn mit einem Kreuzritterheer in den Süden, ohne dabei bedeutende Fortschritte zu erzielen. Im Jahr 1222 schickte Philipp noch ein Heer unter der Führung des Erzbischofs von Bourges gegen den Grafen von Toulouse.
Bevor er selbst einen Zug in den Süden beginnen konnte starb Philipp am 14. Juli 1223 in Mantes, nach einem Umritt in der Normandie, und wurde in der Abtei Saint-Denis bestattet.
Reformtätigkeit
Neues Lehnsrecht
Durch den Zusammenbruch des angevinisches Reichs und dem einhergegangenen Gewinn großer Territorien für die Krondomäne wurde die Krone Frankreichs zum größten Land besitzenden Herren des Landes. Ihr dadurch begründetes Übergewicht auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiet erlaubte es Philipp nun, die herrschaftliche Autorität der Krone gegenüber dem Lehnsadel des Königreiches zu stärken. Damit begann eine Entwicklung des kapetingischen Königtums hin zu einer französischen Monarchie, die alle Regionen des alten westfränkischen Reichs administrativ und jurisdiktionell erfasste. Zu diesem Zweck fand unter seiner Herrschaft ein grundlegender Wandel der seit fast dreihundert Jahren bestehenden feudalen Ordnung statt, indem der König nicht mehr als erster unter gleichen gegenüber den Lehnsfürsten auftrat, sondern nun eine gesetzgebende und richterliche Oberherrschaft forderte. Der Sanktionsbereich des königlichen Rechts (us et coutumes de France), das bis dahin nur auf die Krondomäne beschränkt war, wurde über das gesamte Königreich ausgedehnt. Mit dem Hofgericht stand eine zentrale juristische Instanz zur Verfügung, vor der zukünftig alle lehnsrechtlichen Fragen erörtert werden sollten. Die schrittweise Beschneidung der rechtlichen Stellung des Adels lag diesen Maßnahmen zu Grunde. Der wohl spektakulärste Lehnsprozess wurde gleich gegen den englischen König Johann Ohneland von 1200 bis 1202 geführt (s. o.). Um dem mächtigsten Lehnsadel entgegenzukommen, der sich nicht der Autorität des Hofgerichtes unterwerfen wollte, bildete Philipp mit dem Pairshof eine gesonderte juristische Instanz, in der die Pairs Rechtsstreitigkeiten untereinander entscheiden konnten.
Die Krone behielt sich bei der Neugestalltung der Lehnsordnung wichtige Rechte vor. Zum Beispiel mussten sich fortan alle Erbinnen im Lande gegenüber der Krone eidlich dazu verpflichten, nur noch mit der ausdrücklichen Zustimmung des Königs zu heiraten, was der Krone eine wirksame Einflussmöglichkeit in der Territorialpolitik des Landes sicherte. Ein spektakuläres Beispiel dieser Art war das der Gräfin Blanka von Champagne, die 1201 einen solchen Schwur leistete und ihre unmündige Tochter damit faktisch unter die Vormundschaft des Königs stellte. Als Garantiemächte dieses Eides wurden die eigenen Vasallen der Gräfin verpflichtet, die versprachen, zugunsten der Krone gegen die Gräfin vorzugehen, wenn sie den Eid brechen sollte. Weiterhin wurde das Prinzip der ligischen Treue (homagium ligium) als rechtsverbindlich erklärt, wonach ein Vasall, der Lehen von mehreren Herren empfangen hat, nur einem von diesen zur Heerfolge verpflichtet war. Sollte einer der Lehnsherren die Krone selbst sein, so gebührte ihr der Vorrang in der ligischen Treue. Solche Maßnahmen fanden im ganzen Land ihre Anwendung, was eine weitestgehende Auflösung althergebrachter Lehnsbande zugunsten der Position der Krone zur Folge hatte. Der Begriff des Lehens selbst erfuhr dadurch einen allmählichen Definitionswandel. Zunehmend empfing die Krone das Homagium, ohne dass sie im Gegenzug ein Dienstgut mit Befugnissen zur Rechtsausübung verlieh. Stattdessen vergab sie bloße Geldlehen, was für den Lehnsnehmer eine Einnahmequelle eröffnete, für die er sich im Gegenzug der Krone verpflichtete.
Um zusätzlich die wirtschaftliche Basis des Adels zu verringern, wurden Maßnahmen erlassen, die zu Teilungen von Besitzrechten führten. Im Jahr 1209 erließ das Hofgericht dazu eine neue Regelung des Erbteilungsrechts. War es vorher üblich, dass ein jüngerer Sohn einer Familie sein geerbtes Gut vom älteren Bruder als Lehen empfing, mussten nun beide für ihr Erbe gegenüber der Krone huldigen. 1214 wurde die Bestimmung erlassen, wonach das Wittum einer Witwe mindestens die Hälfte der Güter des Mannes ausmachen musste, was für dessen Erbe zusätzliche wirtschaftliche Einbußen bedeutete.
Die daraus resultierenden sozialen Veränderungen für den Adel banden diesen seit der Zeit Philipps in immer stärker werdenden Maße an die Krone. Gefördert wurde diese Entwicklung durch die zunehmende Verwendung von Söldnern durch die Krone. Dies war zwar kostenintensiver, machte aber den König in militärischen Belangen unabhängiger vom Vertrauen auf die Heerfolgepflicht seiner Vasallen. Der gepanzerte Adelsreiter spielte weiterhin in der Kriegführung Frankreichs bis in das Spätmittelalter eine zentrale Rolle, wurde nun aber durch seine zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit zum König stärker an ihn und seine Hofhaltung gebunden.
Verwaltungsgeschichte
Zur Konsolidierung dieser neuen Rechtsordnung trieb Philipp die Etablierung einer einheitlichen königlichen Verwaltung im ganzen Land voran. Die drei wichtigsten Hilfsmittel dazu waren die Schriftlichkeit der Verwaltung, ein Korps verlässlicher Amtsträger und ein geordnetes Finanzwesen.
Philipp ordnete als erster französischer König eine umfangreiche Kodifizierung und Archivierung aller Urteile und Erlasse des Hofgerichtes an. War es bisher üblich den Standort des königlichen Archivs an dem des Königs zu binden, richtete Philipp es in einem festen Platz in Paris ein (Trésor des chartes). Diese Maßnahme war dem Verlust des Archivs in der Schlacht von Fréteval 1194 geschuldet und legte damit den Grundstein für die Entstehung des französischen Nationalarchivs. Darüber hinaus wichen die umständlich formulierten Urkunden früherer Jahrhunderte knapp gehaltenen königlichen Mandaten, die in Kopien im Archiv aufbewahrt wurden.
Philipp II. bemühte sich auch dort Präsenz zu zeigen, wo er nicht anwesend war. Bereits sein Vater hatte die Krondomäne in kleinere Verwaltungseinheiten, den sogenannten Prévoté (Vogteien), eingerichtet. Ihren Ausbau betrieb Philipp fort und ergänzte sie durch zusätzliche Instanzen, indem mehrere Prévoté einem Amtsbezirk untergeordnet wurden. Nördlich der Loire war dies die Bailliage und südlich die Sénéchaussée (siehe Bailliage und Sénéchaussée). Die Baillis beziehungsweise die Seneschalle vertraten fortan in den jeweils so entstandenen Amtsbezirken die Autorität der Krone und vertraten diese in Rechtsangelegenheiten. Die ihnen nun untergeordneten Prévoté standen ihnen dabei als polizeiliche Vollzugsorgane zur Seite. Der wesentliche Unterschied zwischen Bailli und Seneschall bestand darin, das ersterer direkt vom König ernannt wurde, während das Amt des Seneschalls weitgehend in der Hand adliger Familien erblich blieb.
Der dafür benötigte Verwaltungsapparat trieb einerseits das dafür benötigte Geld ein, verschlang es aber auf der anderen Seite wieder, sodass Strafgelder, Sondersteuern, Wegnahme jüdischer Vermögen (Ausweisung der Juden aus Frankreich 1182) und Wegezoll (Pèage) diese dadurch entstandenen Haushaltslöcher stopfen mussten. Eine reine Agrarwirtschaft konnte das nicht mehr leisten, vielmehr mussten Handel, Gewerbe und Geldumlauf zusammenwirken.
Paris
Unter Philipps Herrschaft avencierte Paris endgültig zur zentralen Hauptresidenz des französischen Königtums und damit zur Hauptstadt des Landes. Er erweiterte die Königspfalz auf der Île de la Cité zu einem repräsentativen Palast (Palais de la Cité) dem er das Gebäude des königlichen Archivs angliederte, womit der Stadt nun auch die Rolle des administrativen Zentrums des Königreiches zukam. Zur Förderung der wirtschaftlichen Prosperität gewährte er der Stadt 1181 das Messeprivileg und nur zwei Jahre später wurden die ersten beiden Markthallen gebaut aus denen das Quartier des Halles hervorging. Im Jahr 1185 gab Philipp den Befehl zur Pflasterung der wichtigsten Straßen, errichtete bis 1214 einen neuen Turm für die Burg des Louvre und begann mit dem Bau einer neuen Stadtmauer die mit mehreren Türmen (u. a. Tour de Nesle) gesichert wurde.
Mit dem Erlass des Scholarenprivilegs im Jahr 1200 stellte Philipp die Schüler und Magister des Quartier Latin unter königlichem Schutz. Damit begründete er deren juristische Autonomie was in den kommenden Jahren zur Bildung der Universität von Paris führte. Die daraus mit dem Bischof von Paris reslutierten Unklarheiten bezüglich der Rechtskompetenzen in der Stadt wurden mit der 1222 ausgearbeiteten Forma pacis zugunsten der Krone neu definiert.
Familiäres
Nachfahren
Am 28. April 1180 heiratete Philipp in erster Ehe Isabelle von Hennegau († 1190). Mit ihr hatte er die Kinder:
- Ludwig VIII. der Löwe (* 1187, † 1226), König von Frankreich
- Philipp (* 15. März 1190, † 18. März 1190)
- Robert (* 15. März 1190, † 18. März 1190)
Am 14. August 1193 vermählte er sich mit Ingeborg von Dänemark († 1236) von der er sich mehrfach vergeblich versuchte zu scheiden. Das Paar lebte bis zu Philipps Tod getrennt und hatte keine Kinder.
In dritter Ehe nahm er am 1. Juni 1196 Agnes von Meran zur Frau († 1201). Die Ehe wurde vom Papst nicht anerkannt, da Philipp bereits mit Ingeborg rechtsgültig verheiratet war. Aus dieser Ehe gingen folgende Kinder hervor, die vom Papst legitimiert wurden:
- Marie (* 1198, † 20. August 1223)
- 1. ∞ 1210 mit Markgraf Philipp I. von Namur
- 2. ∞ 22. August 1213 mit Herzog Heinrich I. von Brabant
- Philipp Hurepel (* 1200, † 1234), Graf von Clermont und von Boulogne
- Tristan († Juli 1201)
Philipp II. war Vater eines unehelichen Sohnes:
- Peter Karlotus (* 1205/09, † 1249), Bischof von Noyon
Quellen
Die beiden wichtigsten Quellen zum Leben Philipps II. August sind die Werke des Rigord (Gesta Philippi Augusti) und des Wilhelm den Bretonen (La Philippide). Rigord begann die Gesta mit der Krönung Philipps 1179 bis zum Jahr 1206, von da an wurde sie von dem königlichen Kapelan Wilhelm dem Bretonen bis zum Jahr 1220 weitergeführt. Wilhelm selbst begann unmittelbar nach der Schlacht bei Bouvines 1214 mit dem epischen Gedichtswerk Philippide, das er 1224 abschloss. Beide Werke fanden Eingang in die Grandes Chroniques de France und wurden von H. F. Delaborde in zwei Bänden (Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, 1882/95) ediert.
Ergänzend dazu sind die Werke der englischen Chronisten Roger von Hoveden (Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi Benedicti abbatis und Chronica) und Roger von Wendover (Flores historiarum) zu nennen.
Literatur
- Alexander Cartellieri: Philipp II. August, König von Frankreich. In 4 Bänden. Aalen 1969, ISBN 3-511-03840-5. (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1899).
- La France de Philippe Auguste: Le temps des mutations. Actes du colloque international organisé par le C.N.R.S. (Paris, 29 septembre - 4 octobre 1980), hrsg. von Robert-Henri Bautier, 1982.
- Georges Duby: Der Sonntag von Bouvines. Berlin 1988.
- Joachim Ehlers: Geschichte Frankreichs im Mittelalter. Stuttgart 1987.
- Gérard Sivéry: Philippe Auguste. Paris 1993.
Film
Im Jahr 1968 spielte der Brite Timothy Dalton in dem Film Der Löwe im Winter (The Lion in Winter) König Philipp von Frankreich. Der Film spielt im Jahr 1183 um die Weihnachtszeit und handelt von den Intrigen um die Nachfolge Heinrichs II. Plantagenet. In dem gleichnamigen TV-Remake von 2003 spielte diese Rolle der irische Schauspieler Jonathan Rhys Meyers.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Ludwig IX. (Frankreich)
Ludwig IX. von Frankreich, genannt Ludwig der Heilige in Frankreich Saint Louis (* 25. April 1214 in Poissy, vermutlich auf der Burg Poissy; † 25. August 1270 in Karthago), war von 1226 bis 1270 König von Frankreich aus der Dynastie der Kapetinger.
Der heilige Ludwig zählt zu den bedeutenden europäischen Monarchen des Mittelalters. Seine Herrschaft blieb in Frankreich als ein goldenes Zeitalter (le siècle d’or de St. Louis) in Erinnerung, in dem das Land einen ökonomischen wie auch politischen Höhepunkt erreichte. Er war Anführer zweier Kreuzzüge und wurde seit dem Tod Kaiser Friedrichs II. von Hohenstaufen unter den europäischen Herrschern als primus inter pares angesehen, dessen moralische Integrität ihn zu einem Schiedsrichter ihrer Streitigkeiten erhob.
Ludwig war einer tiefen christlichen Frömmigkeit (amour de Dieu) verpflichtet, nach der er sein Handeln als Mensch und König ausrichtete. In mittelalterlichen Königslisten wurde Ludwig auch mit dem Beinamen „Prud'homme“ genannt, in Anspielung auf seine Lebensführung, die der sogenannten prud’homie entsprach, wobei es sich um eine Mischung aus Mäßigung, Vernunft, Tapferkeit und ritterlicher Höflichkeit handelte.[1] Von Zeitgenossen gelegentlich auch als „Mönchskönig“ getadelt, gelangte er bereits zu Lebzeiten in den Ruf der Heiligkeit, der mit seiner Heiligsprechung 1297 auch von der katholischen Kirche anerkannt wurde. Seither gilt Ludwig als Idealtypus eines christlichen Herrschers. Sein Gedenktag ist zugleich sein Todestag, der 25. August.
Leben
Familie und Kindheit
Ludwig war ein Sohn des Königs Ludwig VIII. dem Löwen († 1226) und dessen Gemahlin Blanka von Kastilien († 1252). Sein älterer Bruder Philipp starb überraschend 1219, wodurch Ludwig zum designierten Erben des Thrones aufrückte. Seine jüngeren Geschwister waren Robert von Artois (* 1216; † 1250), Johann Tristan (* 1219; † 1232), Alfons von Poitiers (* 1220; † 1271), Philipp Dagobert (* 1222; † 1232), Isabella von Longchamp (* 1224; † 1270) und Karl von Anjou (* 1226; † 1285).
Ludwig wurde im Jahr der Schlacht bei Bouvines geboren, in welcher sein Großvater Philipp II. August über ein englisch-welfisches Heer siegte und den Aufstieg des französischen Königtums zur vorherrschenden Macht Westeuropas begründete. Ludwigs Vater war als Prinz selber im Kampf gegen die Plantagenets engagiert und besetzte zeitweise den größten Teil Englands. In Asien begann zur selben Zeit Dschingis Khan den Eroberungszug der Mongolen, der bald auch China und Europa ergriff. Von 1217 bis 1221 führten französische Ritter unter der Führung des päpstlichen Legaten Pelagius einen Kreuzzug gegen Ägypten, der allerdings nach der Einnahme der Hafenstadt Damiette scheiterte. Unter dem Eindruck eines allgemein steigenden ökonomischen Wohlstandes im Abendland flaute allerdings die Kreuzzugsbegeisterung der Ritterschaft immer weiter ab. Dieser Wohlstand hatte auch die römische Kirche ergriffen, die sich immer tiefer in weltliche Machtkämpfe verstrickte. Diese Entwicklung rief die von Dominikus und Franz von Assisi angestoßene Armutsbewegung hervor, welche die Christenheit zu einer inneren geistigen Erneuerung aufrief. Ebenfalls in dieser Zeit fand in Südfrankreich der so genannte Albigenserkreuzzug statt, der die Bekämpfung der als häretisch eingestuften Sekte der Katharer und deren Unterstützer zum Ziel hatte. Nach anfänglichen Erfolgen gerieten dort die Kreuzfahrer nach dem Tod ihres Anführers Simon IV. de Montfort in die Defensive. 1226 führte Ludwigs Vater selber einen Kreuzzug in den Süden an, der den Anfang zur Unterwerfung dieser Region durch die französische Krone markierte. Auf diesem Kreuzzug starb der Vater nach einer Ruhrerkrankung am 8. November 1226 in Montpensier.
Herrschaft
Die Regentschaft der Mutter
Ludwig wurde am 29. November 1226 in Reims durch den Bischof von Soissons, Jacques de Bazoches, zum König gesalbt und gekrönt. Auf eine traditionelle Weihe durch den Erzbischof von Reims musste verzichtet werden, da seit dem Tod des Erzbischofs Guillaume de Joinville vier Monate zuvor dieses Kirchenamt noch vakant war. Der neue König war erst zwölf Jahre alt, was das Königtum in eine kritische Situation führte. Denn der Lehnsadel Frankreichs hatte unter der Herrschaft von Ludwigs Großvater und Vater erheblich an Macht verloren, weshalb sich bereits unter seinem Vater eine breite Opposition der Vasallen gegen die Krone gebildet hatte. In der Frage der Vormund- und Regentschaft für den jungen König versuchte nun diese Opposition, ihre Interessen und Positionen gegenüber der Krone zu stärken, indem sie die Rechtmäßigkeit der Regierungsübernahme durch Ludwigs Mutter, als Frau und zudem Landesfremde, bestritten.
Die maßgeblichen Köpfe der Opposition waren Peter Mauclerc, Hugo X. von Lusignan und Graf Theobald IV. von Champagne, die der Krönung Ludwigs demonstrativ fernblieben und damit ihre Revolte offen begannen. Königin Blanche aber ging die Niederwerfung der Barone entschlossen an und fand dabei besonders im Klerus und dem päpstlichen Legaten Romano Frangipani einen Rückhalt. Zunächst schuf sie sich Verbündete, indem sie den seit Bouvines gefangengehaltenen Grafen Ferrand von Flandern freiließ und ihn wieder in seinem Lehen einsetzte. Einen weiteren potentiellen Unruhefaktor schaltete sie in der Person des Philipp Hurepel aus, eines Halbbruders König Ludwigs VIII. und der Kandidat der Barone auf die Regentschaft, der jedoch keinen besonders ausgeprägten Ehrgeiz besaß. Blanche stellte ihn ruhig, indem sie ihm die Nachfolge seines in königlicher Haft verstorbenen Schwiegervaters in der Grafschaft Boulogne erleichterte. Einen bedeutenden Erfolg gegen die Barone konnte Blanche bei einer Unterhandlung mit ihnen bei Curçay (Januar 1227) erreichen, indem es ihr durch eine geschickte Verhandlungsführung gelang, den Grafen Theobald von Champagne zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Die Partei der Barone wurde dadurch so empfindlich geschwächt, dass sie sich im März 1227 in Vendôme genötigt sah, sich der Regentin zu unterwerfen.
Der Kampf sollte allerdings weitergehen, nachdem Peter Mauclerc im Herbst 1227 den Versuch unternahm, sich in Montlhéry der Person des Königs zu bemächtigen. Nur ein rechtzeitiger Entsatz der Regentin konnte ihn davon abhalten. Die militärischen Aktionen der Barone verlagerten sich in die Champagne, deren Graf sich als stärkste Stütze der königlichen Sache erwies. Zudem gelang es ihnen, Philipp Hurepel in ihr Lager zu ziehen. Dennoch neigte sich der Kampf zunehmend zugunsten der Krone, besonders nachdem Peter Mauclerc im Oktober 1229 dem englischen König gehuldigt und diesen dazu eingeladen hatte, in Frankreich zu landen. Damit hatte sich Mauclerc der Felonie schuldig gemacht, worauf mehrerer seiner Anhänger, besonders Hugo von Lusignan, auf die Seite Ludwigs und seiner Mutter übergingen. Im Frühjahr 1228 führte Ludwig persönlich ein Heer gegen die Burg Bellême und zog anschließend in die Champagne, wo er erfolgreich den Grafen Theobald gegen dessen Feinde unterstützte. Ludwig nahm hier trotz seiner Unmündigkeit erstmals Aufgaben eines militärischen Führers war, denn die Schwertleite hatte er schon wenige Tage vor seiner Krönung in Soissons erhalten. 1230 zog Ludwig in die Bretagne, wo er mehrere Burgen einnahm. Als sich ihm Clisson ergab, kapitulierte auch Mauclerc, womit der Aufstand der Barone sein Ende fand. Der König von England zog sich kampflos in sein Königreich zurück.
Die Regentin konnte sich gegen ihre Gegner behaupten und damit das Erbe ihres Mannes für ihren Sohn bewahren. Daneben gelang ihr mit der Aushandlung des Vertrages von Meaux-Paris 1229 auch ein bedeutender diplomatischer Erfolg, der den Albigenserkreuzzug formell beendete und die Unterwerfung des Languedoc unter die Hoheit der Krone besiegelte. Dynastisch wurde dieser Vertrag durch die Verlobung des Prinzen Alfons mit der Erbin der Grafschaft Toulouse abgesichert. Durch ihr Verhandlungsgeschick mit Papst Gregor IX. erreichte Ludwigs Mutter im Februar 1234 auch die Erteilung einer notwendigen Dispens für seine Vermählung mit Margarete von der Provence (eine Cousine vierten Grades), der ältesten Tochter des Grafen Raimund Berengar V. von der Provence und der Beatrix von Savoyen. Die Heirat fand am 27. Mai 1234 in der Kathedrale Saint-Étienne in Sens statt.
Erste Regierungsjahre
Ein Jahr nach seiner Hochzeit erreichte Ludwig mit seinem einundzwanzigsten Lebensjahr die Mündigkeit und übernahm offiziell die Regierung. Dennoch sollte seine Mutter ihm weiterhin bis zu ihrem Tod beratend zur Seite stehen. Zu den bedeutendsten Handlungen Ludwigs in dieser Zeit zählen die Belehnungen seiner jüngeren Brüder mit großen Apanagen, die noch von ihrem Vater testamentarisch verfügt worden waren. Robert erhielt 1237 das Artois, Alfons 1241 das Poitou und Saintonge, sowie Karl 1246 das Anjou und Maine. Formell bedeutete dies den Verlust bedeutender Territorien für die Krondomäne, doch wurde dafür gesorgt, dass wichtige königliche Vorrechte in diesen Lehen, besonders in der Justiz- und Verwaltungshoheit, bestehen blieben.
Eine kritische Situation, welche noch einmal Ludwigs Königtum in Gefahr brachte, entstand 1242. Ihr Anstoß kam dieses Mal von außen, von König Heinrich III. von England (Ludwigs Schwager), der den Versuch unternahm, die im Jahr 1204 konfiszierten Territorien seiner Plantagenet-Familie (Anjou, Maine, Poitou, Normandie u. a.) zurückzuerobern. Diese Offensive versuchten erneut einige französische Fürsten zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, indem sie ein Bündnis mit dem englischen König eingingen. Namentlich waren dies vor allem Hugo von Lusignan (Stiefvater Heinrichs III. von England) und Graf Raimund VII. von Toulouse (Cousin Heinrichs III. von England, Schwiegersohn Hugos von Lusignan und Schwiegervater des Prinzen Alfons). Der Konflikt hatte sich besonders an der Belehnung des Prinzen Alfons mit Territorien entzündet, die ehemals den Plantagenets gehörten und auf die sie immer noch einen Anspruch erhoben. Die Mutter des englischen Königs (und Ehefrau des Lusignan), Isabella von Angoulême, hatte auf eine Belehnung ihres Sohnes Richard von Cornwall gehofft und vermittelte anschließend nach deren Ausbleiben tatkräftig diese Allianz ihrer Verwandtschaft.
Im April 1242 zog Ludwig bei Chinon ein Heer zusammen, an dessen Spitze er und Alfons in die Saintonge marschierte, wo am 13. Mai der englische König bei Royan landete. Nachdem am 16. Juni erste Unterhandlungen zwischen beiden Monarchen gescheitert waren, erklärte drei Tage später König Heinrich seinem französischen Schwager den Krieg. Ein Vordringen des englischen Heeres wurde aber von Sire Geoffroy de Rançon verhindert, der auf seiner Burg von Taillebourg den englischen König durch vermeintliche Bündnisverhandlungen aufhielt. Dies ermöglichte Ludwig, das Heer seines Feindes am 21. Juli dort zu überraschen und in die Flucht zu schlagen. Ein erneutes Treffen zwei Tage darauf vor Saintes konnte Ludwig ebenfalls für sich entscheiden, worauf sich ihm der aufständische Adel ergab. Heinrich III. von England floh unter Zurücklassung seiner Habe in die Gascogne, von wo aus er eine Seeblockade gegen La Rochelle organisierte. Nachdem ihm aber Kaiser Friedrich II. ein Bündnis ausschlug, gab er den Kampf auf und zog sich nach England zurück. Beide Monarchen vereinbarten einen fünfjährigen Waffenstillstand, der zuerst durch Ludwigs ersten Kreuzzug und anschließend 1254 um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Insgesamt leitete das Ende des so genannten Saintonge-Krieges eine über 40 Jahre währende Friedenszeit in Frankreich ein.
Auch der Aufstand im Süden wurde schnell niedergeschlagen, nachdem der Graf von Toulouse angesichts zweier großer königlicher Heere die Waffen niederlegte. Im Vertrag von Lorris (Frühjahr 1243) erkannten er und andere Fürsten des Südens die Bestimmungen von Meaux-Paris erneut an und verpflichteten sich zu weiteren Zugeständnissen. Der letzte militärische Widerstand wurde mit der Einnahme der Ketzerfeste Montségur (März 1244) gebrochen.
Kreuzzug gegen Ägypten
Während seines Feldzuges in die Saintonge erlitt Ludwig erstmals eine Malariaerkrankung, die ihn 1244 erneut befiel. Die Krankheit verlief problematisch, sogar ein Tod des Königs wurde befürchtet. In seiner frommen Natur gelobte er Gott, einen Kreuzzug führen zu wollen, falls er die Krankheit überleben sollte. Den Wunsch, in das Heilige Land zu ziehen, hatte Ludwig schon lange zuvor gehegt, obwohl zu seiner Zeit die Kritik am Sinn solcher Unternehmungen bereits laut ausgebrochen war. Bereits 1239 hatte er den Kreuzzug des Grafen Theobald von Champagne (Kreuzzug der Barone) finanziell unterstützt und ihm sogar königliche Würden verliehen, indem er die Erlaubnis zur Mitführung des königlichen Lilienbanners erteilte. Dieser Kreuzzug erbrachte trotz vieler Schwierigkeiten bis 1241 erhebliche Gebietsgewinne von den im Bürgerkrieg befindlichen Ayyubiden. Allerdings ging ein Großteil der Erwerbungen schon 1244 wieder verloren und die Niederlage in der Schlacht von La Forbie brachte die Kreuzfahrerstaaten in arge Bedrängnis. Deshalb erachtete Ludwig einen Zug nach Outremer nun für seine dringlichste Pflicht.
Nach seiner doch erlangten Genesung nahm Ludwig schließlich die Vorbereitungen zu einer bewaffneten Pilgerfahrt auf. Von Papst Innozenz IV. erreichte er 1245 die Bestätigung seines Gelübdes, womit der Kreuzzug auch offiziell sanktioniert wurde. Da ihm die Nutzung italienischer Häfen durch den Kaiser untersagt wurde, errichtete Ludwig in Aigues-Mortes einen Überseehafen, in dem er den Großteil seiner Flotte sammelte, die vornehmlich von Genua und Pisa gestellt wurden. Sein ca. 50.000 Mann starkes Kreuzfahrerheer bestand überwiegend aus französischen Rittern, lediglich aus England sollte später ein kleineres Kontingent zu ihm stoßen. Am 25. August 1248 stach er und mit ihm seine Brüder Robert und Karl (Alfons sollte später nachfolgen) von Aigues-Mortes aus in See und erreichte am 17. September Zypern, wo das Heer überwinterte. Hier wurde auch das direkte Angriffsziel Ägypten, als die stärkste muslimische Bedrohung der Christen Outremers, ausgegeben.
Anfang Juni 1249 landete das Heer an der Küste Ägyptens und nahm nach einem kurzen Kampf am Strand erfolgreich die Hafenstadt Damiette ein. Dieser Erfolg bewog Ludwig zu einem Vordringen in das Landesinnere. Dass inzwischen Sultan as-Salih verstorben war, wusste er nicht, da dessen Witwe die Todesnachricht geheim hielt. Der Weg der Kreuzfahrer nach Kairo wurde nur von der Stadt al-Mansura aufgehalten, wo fast dreißig Jahre zuvor der Kreuzzug von Damiette gescheitert war. Für Ludwig sollte sich dies am 8. Februar 1250 als schlechtes Omen erweisen, als sich dort sein Bruder Robert von Artois zu einem eigenmächtigen Vorstoß verleiten ließ. Entgegen den Befehlen Ludwigs führte Robert mit der Vorhut des Heeres selbständig einen Angriff auf die Stadt und lief dort in eine Falle der Elitekrieger der Mameluken. Robert und nahezu die gesamte Vorhut wurden in der Stadt getötet.
Zwar wurde wenige Tage später ein Gegenangriff der Mameluken vor der Stadt zurückgeschlagen, wobei Ludwig mit einem „deutschen Schwert“ kämpfte,[2] doch das Heer war mittlerweile nicht nur so stark personell verringert, dass eine Belagerung Mansuras aussichtslos erschien. Es wurde zudem von einer um sich greifenden Seuche geschwächt. Nachdem der neue Sultan ein Angebot zum Tausch von Damiette für Jerusalem ausgeschlagen hatte, sah Ludwig sich zu einem Rückzug gezwungen, um nicht von seiner Basis in Damiette abgeschnitten zu werden. Dabei wurde er am 6. April mit seinem engeren Gefolge bei Fariskur von den Mameluken überrascht und gefangengenommen. Der Kreuzzug war damit gescheitert, denn Ludwig musste nicht nur ein enormes Lösegeld (400.000 Besanten) für seine Freilassung und die seiner Gefolgsleute zahlen, sondern auch Damiette räumen. Während seiner Zeit als Gefangener wurde die in Ägypten herrschende Ayyubiden-Dynastie nach einer blutigen Palastrevolte von den Mameluken beseitigt. Nachdem Damiette am 6. Mai 1250 den neuen Herrschern übergeben wurde, ließen sie Ludwig frei, der sich umgehend nach Akkon begab.
Entgegen dem Drängen seiner Mutter, die in Frankreich als Regentin zurückgeblieben war, entschied sich Ludwig, so lange im heiligen Land zu bleiben, bis alle anderen Gefangenen freigekauft waren. Auch wollte er die durch die Vernichtung des Kreuzfahrerheeres von jeder Verteidigung entblößten christlichen Besitzungen in Palästina sichern. Im sogenannten Königreich Jerusalem wurde Ludwig sofort als Herrscher anerkannt, der rechtmäßige König Konrad war hier nie erschienen und sein Regent Heinrich von Zypern legte keine Einsprüche ein. Ludwig gelang es, die Freilassung der restlichen Gefangenen zu beschleunigen, nachdem er den Mamelunken androhte, sich mit den Ayyubiden von Damaskus zu verbünden, die den Mameluken den Krieg erklärt hatten. Er bekam nicht nur seine gefangenen Kameraden wieder frei, sondern wurde von den Mameluken auch mit einem Elefanten und einem Zebra beschenkt. Eine Einladung des Sultans von Damaskus zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem schlug Ludwig aber aus, da er – ähnlich wie Richard Löwenherz 60 Jahre zuvor – die Stadt nicht sehen wollte, ohne sie der Christenheit zurück erobern zu können.[3] Die Bedrohung der Christen durch die Sarazenen sollte sich in den kommenden Jahren verringern, nachdem der Sultan von Damaskus sich angesichts der neuen mongolischen Bedrohung mit den Christen auf einen Waffenstillstand einigte. Ludwig kümmerte sich danach um den Ausbau der Befestigungsanlagen von Akkon, Jaffa, Cäsarea, Haifa und anderer Burgen. 1252 regelte er einen Erbfolgestreit im Fürstentum Antiochia, trat mit den Assassinen in diplomatische Kontakte, wobei ein Bekehrungsversuch an dem „Alten vom Berge“ scheiterte,[4] und übernahm nach dem Tod König Heinrichs von Zypern die Regierungsgeschäfte für dessen unmündigen Sohn Hugo II.
1253 erreichte Ludwig die Nachricht vom Tod seiner Mutter. Nachdem klar wurde, dass der König von England sein Kreuzzugsgelübde nicht erfüllen würde, verließ er am 24. April 1254 das heilige Land. Obwohl er beabsichtigte direkt in Aigues-Mortes französischen Boden zu betreten, ließ er sich umstimmen um am 3. Juli bei Hyères in der Provenvce, also auf Reichsgebiet, an Land zu gehen. Nachdem er dort einer Predigt des franziskanischen Spiritualen Hugo von Digne beiwohnte, erreichte er wenig später bei Beaucaire sein französisches Königreich und traf am 17. Juli 1254 in Paris ein. Sein Kreuzzug war katastrophal gescheitert. Die Befreiung Jerusalems war ebenso misslungen wie eine Schwächung der muslimischen Mächte. Die christlichen Herrschaften in Outremer verdankten ihr weiteres Überleben nur dem Auftreten der Mongolen als neuen Machtfaktor im nahen Osten. Ludwigs Gefangennahme in Ägypten hatte in seiner Heimat zudem die Bewegung der Pastorellen ausgelöst.
Innenpolitik
Herrschaftsauffassung
Während seiner Herrschaft trieb Ludwig IX. die bereits von seinen Vorgängern begonnene Zentralisierung der Macht auf das Königtum weiter voran. Hauptziel war die Zurückdrängung der politisch und wirtschaftlich privilegierten Stellung des Lehnsadels, der sich in den vorangegangenen drei Jahrhunderten königliche Vorrechte angeeignet hatte. Schon Ludwigs Vorgänger auf dem Thron hatten administrative Kompetenzen auf ihr Amt vereint, doch war der Wirkungsbereich dieser Reformen, bedingt durch die Schwäche der frühen Kapetinger-Könige, auf die Krondomäne beschränkt geblieben. Ludwigs Vater und Großvater aber hatten durch die beständige Erweiterung der Krondomäne den König zum größten Landbesitzer und damit zum wirtschaftlich und militärisch stärksten Herren im Königreich gemacht. Dies brachte das Königtum somit in die Position, dem verbliebenen Lehnsadel seine privilegierte Stellung zu entziehen und eine königliche Höchstgewalt aufzuerlegen.
Mit der seit Ludwig VIII. einsetzenden Rückbesinnung der kapetingischen Monarchie auf die universelle Herrschaftsauffassung der Karolinger (Reditus regni Francorum ad stripem Karoli Magni) wurde der Anspruch der Krone auf eine ungeteilte Herrschaftsgewalt im Königreich begründet. 1256 schrieb der Legist Jean de Blanot dabei seine berühmt gewordene Formel nieder, in der er dem König eine kaiserliche Höchstgewalt (imperium) über alle Einwohner seines Reiches und allein ihm die Fähigkeit der Gesetzgebung (jurisdictio generalis) zuerkannte:
- Nam rex Franciae in regno suo princeps est, nam in temporalibus superiorem non recognoscit.
- (Der König Frankreichs ist in seinem Königreich Kaiser, denn er anerkennt in weltlichen Fragen keinen Oberherrn.)[5]
Dieses neue Selbstverständnis hatte das Herrscherbild der französischen Könige wie keine andere Monarchie in Europa geprägt. Das französische Königtum begann nicht nur nach innen einen wichtigen Schritt in den neuzeitlichen Absolutismus, nach außen löste es sich ideologisch von dem weltlichen Hoheitsanspruch der römisch-deutschen Kaiser.
Justiz und Finanzreform
Nach seiner Rückkehr aus dem heiligen Land widmete sich Ludwig dem Umbau der Verwaltungsstrukturen seines Hofes. Eine wichtige administrative Neuerung vollzog sich dabei in der allmählichen Bildung zentraler Behörden wie einem Hofgericht (Parlament), Rechnungshof (Cour des comptes) und einem Staatsrat (Conseil), die aus dem königlichen Rat (Curia regis) hervorgegangen sind. Zu Ludwigs Lebzeiten hatten diese Gremien noch einen eher provisorischen Charakter und sollten erst unter seinen Nachfolgern fest etabliert werden. Auf juristischem Gebiet orientierte sich Ludwig in seinen Reformen im besonderen Maße auf das römische Recht zurück, das stark von der aufkommenden Scholastik jener Zeit beeinflusst war.[6] Mittels des römischen Rechts versuchte Ludwig, alte Rechtsnormen (Gewohnheitsrecht) sowie die Gerichtsbarkeit des Adels und des Klerus zugunsten einer königlichen Jurisdiktion (consuetudo generalis) zu ersetzen. In mehreren Ordonnanzen stärkte er die Kompetenzen königlicher Beamter (Seneschalle und Baillis) gegenüber dem Lehnsadel und schwächte dessen Gerichtsbarkeit, indem er die königlichen Appellationsgerichte für alle Untertanen zugänglich machte. Die im Dezember 1254 erlassene „große Ordonnanz zur Wiederherstellung der moralischen Ordnung“ (ex debito regiae potestatis) war Ludwigs umfangreichste Maßnahme, die in Frankreich das Rechtsprinzip einführte, wonach niemand ohne Verfahren und Urteil seines Rechts beraubt werden darf. Auch eine Trennung zwischen Zivil- und Strafgerichtsbarkeit wurde damit erreicht. Die damit zugleich erlassenen Verbote gegen Glücksspiel (ein Verbot zur Würfelherstellung), Prostitution, Gotteslästerung und Wucher erwiesen sich allerdings als nur bedingt durchsetzungsfähig, genauso wie die 1258 erfolgte Abschaffung des gerichtlichen Zweikampfes als Gottesurteil.
Der Errichtung einer königlichen Rechtshoheit diente nicht nur die Heranziehung des römischen Rechts, sondern auch die unter Ludwigs Herrschaft vorangetriebene schriftliche Fixierung nordfranzösischer Gewohnheitsrechte. Die wichtigsten Werke waren dabei die Coutumes de Beauvaisis des Philippe de Beaumanoir, das Conseil è un ami des Pierre de Fontaines, das Livre de Jostice et de Plet, die Grand Coutumier de la Normandie und die Établissements de Saint Louis. Die Urteile des königlichen Parlaments wurden seit 1254 systematisch in einem Register, dem Olim, gesammelt.
Ludwigs persönlichem Engagement in diesen Reformen lag das Motiv zugrunde, das Königtum als einzige Autorität der Gerechtigkeit und des Friedens im Königreich zu etablieren. Das von Joinville überlieferte und idealisierte Bild Ludwigs IX. als ein Recht sprechender König (roi justicier) unter der Eiche von Vincennes[7] sollte dabei in das nationale Gedächtnis der Franzosen als ein Bewahrer des Rechts und des inneren Friedens eingehen. Für Montesquieu war Ludwig IX. der Vernunftherrscher, der im krassen Gegensatz zum Gewaltherrscher Ludwig XIV. stand.[8] Als konkretes Beispiel dieses Anspruches ist das Gericht zu nennen, das der König über einen Priester hielt, der drei Diebe erschlagen hatte, dem er im Urteil den Klerikerrang entzog.[9] Ludwig griff hier in die Rechtsprechung der Kirche ein, die sich gegenüber der königlichen zunehmend unterordnen musste. Aufsehenerregend war auch der Prozess im Jahre 1259 gegen den Sire von Coucy, der drei Edelleute, die er verdächtigte, in seinen Wäldern gejagt zu haben, ohne Verhandlung hängen ließ.[10] Das Verfahren wurde direkt vor dem König und nicht etwa vor dem Pairsgericht gehalten, worauf der Sire in seinem Standesbewusstsein bestanden hatte. Damit schloss Ludwig die Einflussnahme der Barone, die mit dem Sire sympathisiert hatten, in der Urteilsfindung aus und brachte damit auch gegenüber ihnen seine richterliche Autorität zur Geltung.
Ein weiteres innenpolitisches Betätigungsfeld fand Ludwig in der Errichtung einer Dominanz der Krone in Finanzen und Wirtschaft. Ähnlich wie in der Jurisdiktion galt es hier, die Privilegien des Lehnsadels zurückzudrängen. Zu diesem Zweck erließ Ludwig 1263 eine Ordonnanz, wonach von nun an innerhalb der Krondomäne ausschließlich die von der Krone geprägten Münzen als offizielles Zahlungsmittel anerkannt wurden. Gleiches galt auch in den Lehnsfürstentümern, die keine eigene Münze besaßen. Weiterhin wurde das Fälschen von königlichen Münzen in die Liste der Majestätsverbrechen aufgenommen. Das Ergebnis dieser Maßnahmen war eine schrittweise Verringerung der münzprägenden Herren in Frankreich von noch ca. 300 zu Ludwigs Lebzeiten auf nicht mehr als 30 bis zum Ende der Regierung Philipps des Schönen. Zu einer Vereinfachung des Zahlungsverkehrs sollte der erstmals 1266 in Tours geschlagene große Silberschilling „Gros tournois“ (grosso denarius Turnosus) beitragen, der bis zum Ende des 13. Jahrhunderts zu einer der Hauptwährungsmünzen in Nordeuropa avancierte. Diese Prägung führte den Schilling in Frankreich wieder als Münze ein, der bis dahin seit der karolingischen Zeit nur noch als Recheneinheit verwendet wurde. Im deutschen Raum wurde diese Münze um das Jahr 1270 erstmals als Groschen nachgeprägt. Der im selben Jahr wie der Silberschilling erstmals seit Jahrhunderten wieder geschlagene Goldtaler (Écu d'or) sollte hingegen keine weite Verbreitung finden. Er diente eher dem politischen Prestige, da Frankreich so in die Riege der Wirtschaftsmächte aufstieg, die eine Doppelwährung besaßen (u. a. Byzanz, Sizilien und die arabische Welt).
Außenpolitik
Ludwigs Außenpolitik war vom Anspruch geprägt, gegenüber seinen Nachbarn als friedliebender und friedensbringender König (rex pacificus) aufzutreten. Dabei war er besonders bestrebt, die unter seinen unmittelbaren Vorgängern neu gestalteten Beziehungen und Herrschaftsverhältnisse auf eine vertragliche Grundlage zu bringen.
Ausgleich mit Aragon
Die mit dem Vertrag von Meaux-Paris 1229 begründete Oberhoheit der Krone über den Süden hatte Frankreich in direkte Gegensätze mit den Interessen der Krone Aragons gebracht. Ein erster Berührungspunkt tat sich für Ludwig in der Provence auf, die seit mehreren Generationen von einem Seitenzweig des aragonesischen Königshauses regiert wurde. 1245 starb mit Graf Raimund Berengar V. der letzte Graf dieser Dynastie, Ludwig war mit der ältesten Tochter des Grafen verheiratet, doch galt diese nicht als Erbin ihres Vaters. Dieser hatte stattdessen seine jüngste Tochter Beatrix zur Erbin ernannt, deren Vormundschaft nun ihr Vetter König Jakob I. von Aragon beanspruchte. Ludwig reagierte umgehend mit der Entsendung eines Heeres unter seinem Bruder Karl von Anjou in die Provence, um dieses Land dem aragonesischen Zugriff zu entziehen. Um den französischen Einfluss auf die Provence endgültig zu sichern, nutzte Ludwig die politische Notlage des Papstes aus, der bereitwillig eine Dispens erteilte, die eine Ehe zwischen Beatrix und ihren Schwager Karl (Januar 1246) ermöglichte. Aragon konnte nichts anderes tun, als diesen Verlust seines Einflusses in der Provence zu akzeptieren.
Die Provence war allerdings nur einer der Konfliktpunkte zwischen Frankreich und Aragon. Denn die Machterweiterung, welche die französische Krone als Ergebnis der Albigenserkreuzzüge erringen konnte, geschah vor allem auf Kosten Aragons, da vor den Kreuzzügen der König von Aragon der nominelle Lehnsherr größerer Gebiete im Languedoc war, insbesondere der Besitzungen der Trencavel, die durch König Ludwig VIII. der Krondomäne einverleibt und in Seneschallate eingerichtet wurden. Als rechtliche Grundlage hatte hierfür einst die Übertragung der Rechte Amalrichs von Montfort an die Krone gedient, doch war deren Gültigkeit stark umstritten, da sie in einer päpstlichen Belehnung begründet waren und nicht etwa in einer durch den König Aragons. Der hielt seinen Anspruch auf die umstrittenen Gebiete weiter aufrecht, wohingegen die französische Krone die Auffassung vertrat, dass Aragon nach seiner Niederlage in der Schlacht bei Muret (1213) jegliche Rechte im Languedoc verspielt habe. Diese spannungsgeladene Situation brachte unter Ludwigs Herrschaft beide Königreiche mehrmals an den Rand eines Krieges. Ludwig aber wollte den Gewinn Frankreichs in den umstrittenen Gebieten von Aragon anerkannt wissen und griff dafür auf alte karolingische Rechte zurück. Seit seinem Vater beanspruchte die Dynastie der Kapetinger die dynastische und damit auch rechtliche Nachfolge der Karolinger, womit zugleich ein Anspruch auf die Oberhoheit über die betreffenden Gebiete, aber auch der spanischen Mark (Grafschaft Barcelona) verbunden war. König Jakob I. von Aragon geriet damit in erhebliche Verlegenheit, bildete die spanische Mark doch die Grundlage des Königreichs Aragon, dessen Souveränität nun in Frage gestellt war. Bedingt durch sein hohes Engagement auf See sowie die Inanspruchnahme im Kampf gegen die Mauren konnte sich der König von Aragon aber keinen längeren Konflikt mit Frankreich leisten, womit einer diplomatischen Lösung des Konfliktes der Weg geebnet wurde. Unter der maßgeblichen Vermittlung des Sire Oliver de Termes wurde am 11. Mai 1258 der Vertrag von Corbeil geschlossen, in dem König Jakob die neuen Machtverhältnisse anerkannte und auf alte Rechte sowohl im Languedoc als auch in der Provence verzichtete. Im Gegenzug ließ Ludwig seinen Anspruch auf die spanische Mark fallen, was die weitere Souveränität Aragons gewährleistete. Weiterhin erkannte Ludwig die Zugehörigkeit des Roussillons und der Cerdanya zu Aragon an. Lediglich um das Besitzverhältnis auf Montpellier sollte noch lange gestritten werden. Insgesamt wurde damit aber zwischen beiden Königreichen eine Grenze geschaffen, die für die kommenden vierhundert Jahre bestand haben sollte und erst in dem Pyrenäenfrieden von 1659 korrigiert wurde.
Bezüglich der Provence wurde im Vertrag von Corbeil eine besondere Lösung vereinbart. Der König von Aragon verzichtete dort auf seine Ansprüche zugunsten Ludwigs Ehefrau Margarethe und nicht etwa auf deren jüngere Schwester und Erbin Beatrix. Auf dieser Maßnahme hatte Ludwig bestanden, dem damit eine rechtliche Handhabe gegen seinen Bruder Karl von Anjou, dem Ehemann von Beatrix, in die Hand gegeben wurde. Karl von Anjou hatte in seinem eigennützigen Machtstreben Ludwig schon mehrmals Sorgen bereitet, aber durch die Begünstigung seiner Frau konnte Ludwig den Ehrgeiz seines Bruders in der Provence zügeln.
Frieden mit den Plantagenets
Ebenso wie gegenüber Aragon war Ludwig auf eine Einigung in dem lang andauernden Konflikt mit den Plantagenets bedacht. Das französische Königtum befand sich seit annähernd siebzig Jahren mit der aus dem Anjou stammenden englischen Königsfamilie in einem kriegerischen Konflikt um deren französische Besitzungen, die einst Heinrich II. Plantagenet († 1189) zusammengefasst hatte. Die Auseinandersetzungen waren 1204 in die entscheidende Phase geraten, nachdem Ludwigs Großvater Philipp II. August dem Plantagenet Johann Ohneland als seiner Lehen in Frankreich für verlustig erklärt und diese in mehreren Feldzügen beschlagnahmt hatte. Und trotz der entscheidenden Niederlage bei Bouvines (1214) war das damalige Plantagenetoberhaupt, König Heinrich III. von England, nicht bereit, die Verluste seiner Familie zu akzeptieren, bis er bei dem Versuch diese zurückzuerobern 1242 bei Taillebourg durch Ludwig IX. erneut schwer geschlagen wurde.
Und trotz des bald auslaufenden Waffenstillstandes mit Heinrich hatte sich die politische Lage merklich zugunsten Ludwigs gewendet, nachdem sich Heinrich in England ähnlich wie einst sein Vater einer breiten Opposition seiner Barone gegenüber sah, die seit der Bewilligung der Magna Carta 1215 beständig für eine Erweiterung ihrer Privilegien und Vorrechte gegenüber dem König eintrat. Und eben diese Barone waren es auch, die nicht länger bereit waren, für die privaten Familienangelegenheiten ihres Königs in Frankreich zu kämpfen. In diesem Willen kam eine Entwicklung zum Ausdruck, die mit der Zerschlagung des Plantagenet-Reiches (Angevinisches Reich) 1204 ihren Anfang nahm: nämlich die allmähliche politische wie auch kulturelle Lösung des aus Frankreich stammenden Adels von der Heimat ihrer Vorväter und der zunehmenden Bildung einer insularen, einer englischen Identität. Die Symbiose zwischen beiden Königreichen, die Wilhelm der Eroberer 1066 bei Hastings geschaffen hatte, war dabei, sich aufzulösen. In Anbetracht dieser Lage zeigte sich Heinrich nun bereit, die geschaffenen Verhältnisse anzuerkennen. Zu einer ersten Annäherung kam es bei einem eher spontanen Besuch Heinrich III. in Paris zu Weihnachten 1254, wo Ludwig bei dieser Gelegenheit dem englischen König seinen aus Palästina mitgebrachten Elefanten schenkte. Die Tatsache, dass beide Könige über ihre vermittelnden Ehefrauen miteinander verschwägert waren, erleichterte dabei eine Einigung, die am 28. Mai 1258 im Vertrag von Paris verbrieft wurde. König Heinrich III. von England erkannte darin die Verluste seiner Familie in Frankreich zugunsten der französischen Krone an, im Gegenzug bestätigte Ludwig ihm den letzten gehaltenen Besitz, der sich auf die Gascogne konzentrierte. Ludwig war sogar zu territorialen Zugeständnissen bereit, indem er Heinrich mit einigen Gebieten des alten Aquitanien neu belehnte, besonders mit der Saintonge, auf die Prinz Alfons verzichten musste. Der Vertrag wurde auch von den englischen Baronen ratifiziert und trat mit der Huldigung Heinrichs gegenüber Ludwig am 4. Dezember 1259 in Paris in Kraft.
Die vertragliche Einigung zwischen beiden Monarchen enthielt allerdings auch den Keim zukünftiger Konflikte, nämlich die vereinbarte Huldigung (homagium) der englischen Könige als Lehensnehmer von Lehensgebieten in Frankreich gegenüber dem französischen König als Lehensgeber. Ein Unterwerfungsakt, den die Aufnahme der Plantagenets unter die Pairs von Frankreich nicht abmilderte. König Heinrichs III. Nachkommen sollten vergeblich versuchen, dieses Lehnsverhältnis zu beenden, was eine nicht geringe Ursache zum Ausbruch des Hundertjährigen Krieges beisteuerte. Für Ludwig selbst war der Vertrag von Paris mit verhältnismäßig geringen politischen Konsequenzen verbunden. Gegenüber dem König von England räumte er lediglich freie Hand für eine Plantagenet-Nachfolge im Königreich Sizilien gegen die Staufer ein, die allerdings aus demselben Grund wie das offensive Engagement Heinrichs in Frankreich scheiterte, nämlich mangels der erforderlichen Unterstützung durch die englischen Barone.
Verhältnis zu Kaiser und Papst
König Ludwig IX. pflegte sowohl zu den Staufern als auch zum Papsttum ein traditionell gutes Verhältnis, was sich in seiner Regierungszeit allerdings als sehr problematisch gestaltete. Kaiser Friedrich II. befand sich nämlich seit dem Pontifikat Papst Gregors IX. in einem erbitterten Konflikt mit der Kirche, in dem sich Ludwig weitgehend neutral verhielt. Zu Beginn seiner Herrschaft nahm er noch eher eine tendenziell prostaufische Position unter Fortführung einer gemeinsamen Politik gegen England ein. Unter anderem ließ er dem Kaiser 1238 Unterstützung im Kampf gegen den Lombardenbund zukommen, weiterhin heiratete sein Bruder Robert eine Tochter des Herzogs von Brabant, die eine Cousine des Kaisers war. Als der Papst 1240 Robert die römisch-deutsche Krone anbot, lehnte dieser das Angebot unter Berücksichtigung der familiären Bande zu den Staufern ab. Die guten Beziehungen zu den Staufern nahmen auch keinen Abbruch, als Ludwig den französischen Einfluss auf reichsunmittelbare Gebiete ausweitete, wie durch den Erbgang seines Bruders Karl in der Provence als auch durch seine Schiedsurteile im Bezug auf den flämischen Erbstreit, der auch Reichsinteressen berührt hatte. Ludwig konnte letztlich in diesen Fällen von der stillschweigenden Duldung des Kaisers profitieren, der im Konflikt mit dem Papst auf ein gutes Verhältnis zu Frankreich angewiesen war.
Das Einvernehmen mit dem Kaiser sah Ludwig nur dann in Frage gestellt, wenn dieser gegenüber dem Klerus in einer zu aggressiven Weise verfuhr, wie zum Beispiel 1241, als der Kaiser mehrere hohe kirchliche Würdenträger gefangennehmen ließ, die auf dem Weg zur Papstwahl nach Rom waren. Nach einer scharf formulierten Antwort Ludwigs ließ der Kaiser die Würdenträger wieder frei. Über den vermittelnden Grafen von Toulouse strengte Ludwig im Frühjahr 1244 erstmals eine Friedensinitiative zwischen Kaiser und Papst an, die aber trotz ihrer offiziellen Beeidigung nicht zum Tragen kam. Im Dezember 1244 folgte die Exilnahme des Papstes Innozenz IV. in Lyon, nicht zuletzt aufgrund dessen Schutzbedürfniss vor dem Kaiser. Wenn auch Lyon zum Reich gehörte, lag diese Stadt bedingt durch ihre Grenzlage im Zugriffsbereich Ludwigs, der somit zum Garant des persönlichen Schutzes der Kurie wurde. In Lyon konnte der Papst das ein Konzil einberufen, das im Juli 1245 mit der Absetzung des Kaisers endete. Kaiser Friedrich II. wandte sich drauf im September des Jahres direkt an Ludwig, mit der Bitte um eine persönliche Vermittlung. Auch erklärte er sich bereit, Ludwigs Urteil als Schiedsrichter in dieser Sache anzuerkennen. Im November lud Ludwig den Papst zu einer persönlichen Unterredung in Cluny ein, konnte diesem dabei allerdings kein Entgegenkommen abringen. Viel eher war es Papst Innozenz IV. gelungen, Ludwig für seine Sache neutral zu stimmen, indem er die kirchliche Dispens für die Ehe Karls von Anjou mit der Erbin der Provence gewährte.
Obwohl der Papst noch vor Jahresende 1244 über seine Prälaten die Absetzung Friedrichs als Kaiser in Frankreich öffentlich propagieren ließ, erkannte Ludwig diesen weiterhin als solchen an und verweigerte auch seine Unterstützung zu einem förmlichen Kreuzzug gegen diesen. Vielmehr konzentrierte er sich verstärkt auf sein persönliches Kreuzzugsanliegen in das heilige Land. Obwohl dieses durch das Konzil in Lyon bewilligt wurde, behinderte der Papst die Kreuzzugswerbung Ludwigs in Deutschland, da dort antistaufische Kräfte für den Kampf gegen den Kaiser gehalten werden sollten. Trotzalledem stellte sich Ludwig schützend vor den Papst und drohte mit einer militärischen Intervention, als der Kaiser 1247 einen Angriff auf Lyon plante. Unmittelbar vor seiner Abreise im Juni 1248 machte Ludwig persönlich in Lyon halt um noch einen Vermittlungsversuch zu unternehmen, doch scheiterte dieser aufgrund der unerbittlichen Kompromisslosigkeit des Papstes. Seine Niederlage in Ägypten (April 1250) schien Ludwig noch einmal auf die Position des Kaisers einzugehen, denn die öffentliche Mehrheit sowohl im Abendland als auch bei den Christen Outremers machte vor allen den Papst dafür verantwortlich, der wegen seines Konflikts mit dem Kaiser notwendige Kräfte für Kampf gegen die Ungläubigen zurückgehalten habe. Laut Matthäus Paris habe Ludwig im August 1250 seine heimkehrenden Brüder aufgetragen, den Papst zu einem raschen Friedensschluss mit dem Kaiser zu drängen, damit dieser mit einem Kreuzzugsheer ins heilige Land nachrücken könne. Dabei sollen Alfons und Karl auch mit dem Entzug der französischen Schutzgarantien für Lyon gedroht haben, worauf der Papst bei Heinrich III. von England, wenn auch erfolglos, um Asyl in Bordeaux gebeten haben soll.
Der Tod Kaiser Friedrichs II. im Dezember 1250 beendete letztlich die zerfahrene Situation und bedeutete zugleich auch einen Einschnitt im Verhältnis Ludwigs zu den Staufern. Obwohl er Konrad IV. auch weiterhin als rechtmäßigen König sowohl des Reiches als auch von Sizilien anerkannte, näherte sich Ludwig doch zunehmend der päpstlichen Position an. Nach dem Tode Konrads 1254 und der 1258 folgenden Usurpation des sizilianischen Thrones durch Manfred gab Ludwig dem päpstlichen Drängen auf eine Beseitigung der Staufer letztlich nach und erteilte seinem Bruder Karl von Anjou sein Einverständnis zu einem Eroberungszug nach Unteritalien.
Das Ende der Staufer und das damit einsetzende Interregnum markierte einen Wendepunkt im Verhältnis Frankreichs zum Reich. Bedingt durch das Erstarken der französischen Königsmacht bei gleichzeitigem Verfall der kaiserlichen Zentralmacht begann Frankreich seit der Herrschaft Ludwigs zunehmend, seinen Einfluss offensiv auf Reichsgebiet, besonders auf den alten burgundischen und lothringischen Raum, auszudehnen. Tatkräftig traten die französischen Könige nun auch vor allem in Italien auf, wo sie die Machtkämpfe zwischen kaisertreuen (Ghibellinen) und päpstlich (Guelfen) gesinnten Parteien zu ihren eigenen Vorteil nutzten. Ludwigs Sohn Philipp der Kühne sollte schließlich auch der erste französische Monarch werden, der für die Wahl zum römischen (deutschen) König kandidieren sollte.
Primus inter pares
Ludwig genoss über die Grenzen Frankreichs hinaus den Ruf, ein Wahrer des Friedens zu sein, der die Anwendung von Waffengewalt, mit Ausnahme des Kampfes gegen die Heiden, nur als ein Mittel der Verteidigung akzeptierte. Dieses Ansehen erhob ihn unter den anderen Herrschern des christlichen Abendlandes, mehr noch als den Kaiser, in die Position eines Schiedsrichters, dessen Schlichtung und Urteil ohne Gesichtsverlust von den streitenden Parteien gesucht wurde.
Im flämischen Erbfolgestreit zwischen den Brüdern des Hauses Dampierre und des Hauses Avesnes um das Erbe ihrer Mutter Gräfin Margarethe fällte Ludwig 1246 in Paris einen Schiedsspruch (Dit de Paris), der den Dampierre die Grafschaft Flandern und den Avesnes die Grafschaft Hennegau zusprach. Das Besondere dabei war, dass Ludwig im Falle Hennegau in Lehnsverhältnisse des Reiches eingegriffen hatte. Den Interessen des unmittelbaren Lehnsherrn des Hennegaus, dem Bischof von Lüttich, wurde dabei keine Rechnung getragen, ebenso wie der Kaiser sich in diese Angelegenheit nicht einmischte. Während Ludwigs Abwesenheit im heiligen Land sollte der Konflikt in Flandern noch einmal ausbrechen, nicht ohne Zutun seines Bruders Karl von Anjou, der sich einen persönlichen Gewinn daraus erhoffte. Nach seiner Rückkehr 1254 sorgte Ludwig für ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und bestätigte 1256 in Péronne (Dit de Péronne) den in Paris gefällten Entschluss, der zum endgültigen Ende des Konfliktes führte.
1257 musste Ludwig in seiner eigenen Familie über bestehende Lehnsverhältnisse hinweg schlichten. In der Provence war sein Bruder Karl mit seiner Schwiegermutter Beatrix von Savoyen in einen Streit um die Grafschaft Forcalquier geraten, den Ludwig zugunsten Karls entschied. Auch hier mussten die Hoheitsrechte des Reiches auf die Provence ignoriert werden, da es zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch das Interregnum, keine vertretende Instanz mehr besaß.
1259 erschien schließlich der Herr des griechischen Theben und Athen, Guido I. de la Roche, an Ludwigs Hof und erbat von ihm einen Schiedsspruch, der seinen Konflikt mit dem Fürsten von Achaia beenden sollte. Der Fürst hatte Guido I. dazu gezwungen, ihn als Lehnsherren anzuerkennen, doch die Vasallen Guidos wollten dies nicht akzeptieren, weshalb sie ihn zu Ludwig entsandten. Die Tatsache, dass ein Urteil in solch einer Frage nur dem Oberlehnsherrn des lateinischen Griechenlands, Kaiser Balduin II. von Courtenay, erlaubt war, ignorierten sie dabei. König Ludwig entschied für die Interessen Guidos de la Roche und erklärte die erzwungene Huldigung für ungültig. Die Chronik von Morea berichtet, dass die Herrschaft von Athen um das Jahr 1260 durch Ludwig in die Würde eines Herzogtums erhoben wurden sei und der somit dessen Ranggleichheit zum Fürstentum Achaia unterstrichen habe.
1264 ersuchte sogar sein Schwager König Heinrich III. von England Ludwig um sein Urteil. In England war der König in eine sich immer weiter vertiefende Auseinandersetzung mit seinen Baronen um Simon V. de Montfort geraten, die von ihm 1258 die Anerkennung der Provisions of Oxford erzwungen hatten, in welcher der König den Baronen eine stärkere Beteiligung an der Macht zubilligen musste. 1261 erklärte König Heinrich mit Rückendeckung des Papstes die Provisions für ungültig, und die Lage spitzte sich an den Rand eines Bürgerkriegs zu. Um diesen zu vermeiden, wandten sich die Parteien an König Ludwig von Frankreich. In der Mise of Amiens erklärte auch er aus Kollegialität zu seinem Schwager die Provisions für nichtig im Sinne einer Stärkung der Krone von England gegenüber deren Vasallen. Für Ludwig war die Autorität eines Königtums der Ursprung allen Rechts, gegenüber seinen Vasallen Souverän und könne dadurch in seiner Macht auch nicht von diesen beschränkt werden. Dieses spezifische Herrschaftsverständnis stand allerdings den Eigenheiten und dem politischen Selbstbewusstsein der englischen Barone entgegen und sollte sich deshalb auch nicht als durchsetzungsfähig erweisen. In den folgenden Jahren versank England in einen lang anhaltenden Bürgerkrieg.
Die Mongolen
Während der Überwinterung des Kreuzfahrerheers auf Zypern 1248 empfing Ludwig zwei Abgesandte des Großkhans der Mongolen, Gujuk, die ihm ein gemeinsames Bündnis gegen die Sarazenen und eine Konversion des Großkhans zum Christentum in Aussicht stellten. Ein dem Christentum wohlwollendes Entgegenkommen des Großkhans hatte bereits der armenische Königsbruder Sempad während seiner Gesandschaftsreise in die Mongolei in einem an den König von Zypern gerichteten Brief suggeriert, den auch Ludwig zu lesen bekam. Darauf beschloss Ludwig, eine eigene Gesandtschaft unter dem Dominikaner Andreas von Longjumeau in den Altai zu schicken, der das Bündnis mit Gujuk besiegeln sollte. Um die Bekehrung voranzutreiben, gab ihm Ludwig ein Stück vom „wahren Kreuz“ und eine rote Zeltkapelle als Geschenk für den Großkhan mit auf die Reise. Longjumeau sollte allerdings ebenso scheitern wie schon wenige Jahre zuvor der päpstliche Gesandte Johannes de Plano Carpini, denn als er in der mongolischen Residenz eintraf, war Gujuk bereits tot, und der zusammengerufene Kuriltai wurde von seiner Witwe Ogul Qaimish beherrscht. Diese wollte von einem Bündnis nichts wissen und forderte im Gegenzug den König von Frankreich dazu auf, sich zu unterwerfen und Tribut an die Mongolen zu zahlen.
Ludwig empfing Longjumeau 1251 in Cäsarea und entschloss sich trotz des Misserfolges, eine zweite Mission mit dem Franziskaner Wilhelm von Rubruk zu den Mongolen zu entsenden, denn Longjumeau wurde kurz vor seiner Abreise aus der Mongolei Zeuge der Wahl des als religiös tolerant geltenden Möngke, dem außerdem eine Verwandtschaft zum mythischen Priesterkönig Johannes nachgesagt wurde, zum neuen Großkhan. Rubruk sammelte auf seiner langen Reise und Aufenthalt in Karakorum reichhaltige Informationen über die mongolische Gesellschaft und Kultur, doch war seine Mission politisch wie auch religiös ein Fehlschlag, womit die Kontakte Ludwigs zu den Mongolen vorerst endeten.
1262 jedoch erschien in Paris eine große Gesandtschaft des Ilchan Hülagü, der wenige Jahre zuvor das Abbasiden-Kalifat in Bagdad vernichtet hatte, mit einem Bündnisangebot gegen die Mameluken. Zwischen Ludwig und Hülagü sollte es aber trotz jahrelanger Verhandlungen nie zu einem formellen Bündnis kommen, vor allem weil auch Hülagü an der Forderung einer mongolischen Oberhoheit über die Christen im heiligen Land festhielt.
Kreuzzug gegen Tunis und Tod
Seit dem Scheitern seines Kreuzzuges nach Ägypten war Ludwig dazu entschlossen, einen weiteren Zug gegen die Heiden durchzuführen, um die vorangegangene Schmach vergessen zu machen. Nachdem er das heilige Land 1254 verlassen hatte, schickte er regelmäßig Geld und Waffen nach Akkon zum Unterhalt eines ständigen Regiments, welches die Basis eines neuen Unternehmens bilden sollte. Die ohnehin schwankende Existenz der restlichen Herrschaften der Christen im heiligen Land sah sich in den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt, nachdem der Mamelukensultan Baibars I. die Mongolen 1260 bei Ain Djalud geschlagen und Syrien seiner Herrschaft unterworfen hatte. Nacheinander eroberte er darauf Cäsarea, Arsuf, Safed, Jaffa und vernichtete 1268 Antiochia, nur Akkon konnte sich gerade noch halten.
Ludwig erachtete einen neuen Kreuzzug nun dringlicher denn je, obwohl seine unmittelbare Umgebung deutliche Kritik und Ablehnung an diesem Vorhaben äußerte. Diese ignorierend legte er 1267 ein neues Kreuzzugsgelübde ab, das vom Papst bestätigt wurde. Der Transport des Heeres sollte erneut von Aigues-Mortes aus über das Meer verlaufen. Eigens dafür ließ Ludwig erstmals eigene Schiffe bauen, weshalb er als Begründer der französischen Marine angesehen wird. Eine Zusage zur Teilnahme erhielt Ludwig aber von dem englischen Prinzen Eduard Plantagenet und von seinem Bruder Karl von Anjou. Letzterer war mittlerweile König von Sizilien geworden und betrieb eine aggressive Expansionspolitik im östlichen Mittelmeerraum, die gegensätzlicher zu der seines Bruders nicht hätte sein können. Karl schloss unbedenklich Verträge mit den Mameluken, die für Ludwig die zu bekämpfenden Ungläubigen waren, und während Ludwig die Kirchenunion des byzantinischen Kaisers unterstützte, rüstete Karl zu einem Krieg gegen Byzanz. Das Anliegen Ludwigs musste also grundlegende Interessen Karls berühren, dem die Teilnahme an dem Kreuzzug seines Bruders eher deshalb nachgesagt wurde, um auf dessen Verlauf Einfluss nehmen zu können. Warum sich Ludwig für einen Angriff auf den Sultan von Tunis, al-Mustansir entschied, bleibt bis heute umstritten. Angeblich erhoffte er sich dadurch, einen Übertritt des Sultans zum Christentum beschleunigen zu können, den dieser gegenüber Ludwig und Karl auch diplomatisch verlautbaren ließ. Tatsächlich aber war der Sultan aufgrund seiner Unterstützung ghibellinischer Oppositioneller und seiner Weigerung, beanspruchte Tribute zu zahlen, ein Feind Karls von Anjou. Ausgeschlossen wird heute hingegen die These, wonach Ludwig irrtümlich glaubte, Tunis läge in unmittelbarer Nachbarschaft zu Kairo, was ihm eine bessere Ausgangsbasis zu einem Angriff auf die Mameluken gegeben hätte.[12]
Obwohl bereits von Alter und Krankheit gezeichnet, landete Ludwig mit seinem Heer am 18. Juli 1270 bei Karthago, das er schnell einnahm. Der Sultan weigerte sich, seinen Glauben abzulegen, und verschanzte sich in Tunis. Bevor es aber zu einer größeren Schlacht kam, wurde das Kreuzfahrerheer von der Bakterienruhr befallen. Nachdem er vom Tod seines Sohnes Johann Tristan erfuhr, starb der König am 25. August 1270 um drei Uhr nachmittags, zur selben Stunde wie Christus,[13] an der Seuche. Der Legende nach waren seine letzten Worte: „Wir werden einziehen nach Jerusalem.“[14]
Ludwig der Heilige als Christ
Persönlichkeit
Ludwig IX. war einem tiefen christlichen Lebensstil verpflichtet, in dem ihm unter seinen Vorgängern nur König Robert II. der Fromme gleich gekommen sein soll. Geprägt von Frömmigkeit und Barmherzigkeit führte er, soweit es einem weltlichen Herrscher gestattet war, ein Leben in strengster Askese. Sein Alltag war bestimmt von Bescheidenheit, Kargheit, schlichter Kleidung und größtmöglicher Keuschheit. Laut Nangis gestatteten sich Ludwig und seine Frau den Beischlaf nur in den von der Kirche vorgeschriebenen „Zeiten der Umarmung“[15] Große Abscheu empfand er zu Todsünden, nach einer unbedachten Äußerung Joinvilles lieber 30 Todsünden zu begehen als einen Aussätzigen zu küssen tadelte er diesen: „Wisst Ihr denn nicht, dass es keinen so schlimmen Aussatz gibt, wie in Todsünde zu sein? Denn eine Seele in Todsünde gleicht dem Teufel.“[16] Den Krieg betrachtete Ludwig nur dann als Mittel zur Konfliktlösung, wenn er den zwei Grundregeln des christlichen, des „gerechten Krieges“ entsprach: Gegenüber Ungläubigen zu deren Bekämpfung und gegenüber Glaubensbrüdern als Mittel der Verteidigung. Ludwig hatte um 1230 die erste Übersetzung der Bibel in das Französische in Auftrag gegeben,[17] er selbst galt als begeisterter Leser von Heiligenviten, die er auch persönlich für sein lateinunkundiges Umfeld vorlas und übersetzte.[18] Ludwig stand zudem der in seiner Zeit aufkommenden Bewegung der Bettelorden nahe, die er reich beschenkte. Sein angeblich geäußerter Wunsch, selbst eines Tages dem dritten Orden der Franziskaner beizutreten, gilt heute hingegen als bloßes Gerücht. Für den Orden der Zisterzienser gründete er die Abtei von Royaumont, die er oft besuchte, um den Lesungen des Vinzenz von Beauvais beizuwohnen. Weiterhin förderte Ludwig auch die geistigen Wissenschaften, indem er die Gründung eines theologischen Kollegs an der Pariser Universität durch seinen Kaplan Robert von Sorbon unterstützte. Die so entstehende Sorbonne-Universität zog bald die gelehrten Autoritäten seiner Zeit (u. a. Bonaventura, Albertus Magnus, Roger Bacon, Thomas von Aquin) an.
Bei aller ihm entgegengebrachter Bewunderung unter seinen Zeitgenossen für sein frommes, gottgerechtes Leben bot gerade diese Lebensführung auch Anlass zur Kritik, die auch aus Ludwigs engster Umgebung geäußert wurde. Für viele erschien Ludwigs Demut nicht selten als zu übertrieben. Sie lenke ihn ab von seinen Verantwortungen als weltlicher Herrscher. Widerstand kam Ludwig entgegen, sobald er versuchte, seine religiösen Wertvorstellungen anderen Personen oder dem ganzen Königreich aufzuzwingen. So war es vor allem der Klerus, der ein härteres Vorgehen Ludwigs gegen die Prostitution verhinderte, im Wissen, dass ein Verbot der käuflichen Liebe gesellschaftlich nicht durchsetzbar war,[19] 1270 erließ Ludwig erstmals auch Gesetze, welche die Sodomie zu einem Verbrechen erklärte. Gegen seinen Willen wandten sich auch Ludwigs eigene Kinder Johann Tristan, Peter und Blanche, von denen nach seinen Vorstellungen je eines den Dominikanern, den Franziskanern und den Zisterziensern gegeben werden sollte. Doch die Kinder teilten nicht den frommen Lebenswandel ihres Vaters und konnten erst nach heftigem Widerstand und auch mit Einspruch des Papstes einem Ordensleben entgehen. Von Seiten des Klerus, besonders von den Mönchen, wurde Ludwig für seine Finanzpolitik kritisiert, da er die Kosten seiner Kreuzzüge vor allem der Kirche anlastete. Überhaupt waren auch die Kreuzzüge sehr umstritten und verloren unter der französischen Ritterschaft des 13. Jahrhunderts an ideellem Ansehen. Weiterhin war man der Auffassung, der König würde für diese die Belange seines Königreichs vernachlässigen. Diese Auffassung war auch unter dem einfachen Volk vertreten. Eine Frau namens Sarrete warf dem König, der zu Gericht am Fuß der Treppe des Palais de la Cité saß, vor, nur ein „König der Minder- und Predigerbrüder, der Priester und der Kleriker“ zu sein.[20]
Zeit seines Lebens war Ludwig ein ausgiebiger Verehrer und Sammler von Reliquien. Welche Bedeutung er ihnen zumaß, verdeutlicht eine Episode aus dem Jahr 1232, als in der Abtei von Saint-Denis die hochgeschätzte Reliquie eines heiligen Nagels verloren ging. Ludwig verfiel darüber in eine tiefe Trauer und ordnete eine landesweite Suche an, die allerdings erfolglos verlief.[21] Bereits als Kind bekam er von den Franziskanern das Kopfkissen des heiligen Franz von Assisi (hl. 1228) geschenkt.[22] Die bedeutendste Erwerbung Ludwigs war aber die Dornenkrone, die Christus am Tag seiner Kreuzigung getragen hatte. Ihm kamen dabei die finanziellen Nöte des lateinischen Kaisers von Konstantinopel Balduin II. von Courtenay zugute, der 1239 in Frankreich war, .[23] Ludwig kaufte ihm die Dornenkrone ab, die einst durch die heilige Helena nach Konstantinopel gelangte, und nahm sie wenig später in Villeneuve-l’Archevêque in Empfang, von wo aus er und sein Bruder Robert sie barfuß und im Büßergewand nach Paris trugen. Als Aufbewahrungsort für die Leidenswerkzeuge Christi ließ Ludwig die Sainte-Chapelle bauen, die 1248 eingeweiht wurde. Der Abt von Vaux-de-Cernay fertigte eigens für die Krone ein Officium an. Mit dem Besitz der Dornenkrone erlebte die Person Ludwigs wie auch das französische Königtum im Allgemeinen eine Erhöhung seines Prestiges. Erzbischof Gautier von Sens glaubte, dass Frankreich von Christus als Nachfolger Griechenlands (Byzanz) zum Ort der Verehrung seiner siegreichen Passion auserkoren wurde. Papst Innozenz IV. bescheinigte später, dass Ludwig von Christus mit dessen Krone gekrönt worden sei und beschrieb ihn als „allerchristlichen König“ („rex christianissimus“), „Abbild Gottes“ („imago Dei“) und „Beschützer der Kirche“ („patronus ecclesiae“).[24] Im Jahre 1241 kaufte Ludwig dem lateinischen Kaiser zusätzlich den Heiligen Schwamm (den die römischen Soldaten in Essig getränkt und anschließend an den Mund Christi gehalten hatten) und die Heilige Lanze des Longinus ab. Weiterhin erwarb er von der Abtei Saint-Maurice d'Agaune mehrere Reliquien von 24 Märtyrern der Legion des Heiligen Mauritius, für die er in Senlis eine neue Kirche bauen ließ.
Häretiker, Ungläubige und Juden
In seinem religiösen Eifer betrachtete sich Ludwig in seiner Eigenschaft als König auch als Bekämpfer der Feinde des Glaubens, womit Häretiker, Ungläubige und Juden zu verstehen waren. Als größte Bedrohung sah er die Katharer an, für deren Bekämpfung er den Aufbau der Inquisition vorantrieb. Gegenüber Ungläubigen (Muslime, Mongolen) betrachtete Ludwig, neben dem Kreuzzug, die Bekehrung als das geeignete Mittel. Während seines Kreuzzuges in Ägypten ordnete er beispielsweise in Damiette an, die Zivilbevölkerung mit Zwangstaufen für den christlichen Glauben zu gewinnen, statt zu töten. Diese Maßnahmen hatten allerdings ebenso wenig Erfolg wie die Versuche, die Mongolen auf den diplomatischen Weg zu bekehren.
Nahezu obsessiv war Ludwigs Haltung zu den Juden in seinem Königreich. Um diese in ihrem vermeintlichen Irrglauben zu reinigen führte er erstmals in der Geschichte Frankreichs staatlich organisierte Maßnahmen durch. Während seiner gesamten Regierungszeit erließ er mehrere Ordonnanzen, die gezielt gegen die Geldwechselwirtschaft gerichtet waren und damit besonders die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der Juden angriffen. Die Geldwirtschaft der Juden betrachtete Ludwig als Gift eines Skorpions, der sein Königreich lähme.[25] Ideologisch begann Ludwig die Bekämpfung des Judentums am 3. März 1240 mit der landesweit durchgeführten Beschlagnahmung des Buchs Talmud, als einer angeblich gotteslästerlichen Schrift, die gegenüber Jesu und der Jungfrau Maria blasphemisch sei. Trotz eines rhetorischen Sieges jüdischer Gelehrter bei einem am 12. März 1240 einberufenen Streitgespräch, urteilte Ludwig die weitere Verbrennung des Talmuds. Mehrere Tausend Exemplare wurden 1242 in Paris bei einem Autodafé vernichtet. Trotz einer 1247 ergangenen Aufforderung des Papstes, die Verbrennungen einzustellen, wurde der Talmud und sein Besitz in den nächsten Jahren weiter verfolgt. 1252 erfolgte schließlich eine Anordnung zur Verbannung aller Juden aus Frankreich. Der Übertritt (Konversion) zum Christentum sollte ihnen dabei als einzige Möglichkeit gelassen werden, der Ausweisung zu entgehen. Dieses Dekret wurde wenige Jahre später um die Möglichkeit ergänzt, sich durch eine Zuwendung an den königlichen Schatz von dieser Verbannung freizukaufen. So eine Maßnahme wurde allerdings erst unter Ludwigs Enkel, Philipp dem Schönen, erstmals erfolgreich durchgeführt. Deshalb wurden Juden 1269 dazu verpflichtet, sich durch ihre Kleidung kenntlich zu machen – in Anwendung einer Empfehlung des Vierten Laterankonzils von 1215. Für die Männer war dies eine kreisförmige Scheibe, die Rouelle, die auf der Brust befestigt werden musste, für die Frauen eine besondere Haube. In der islamischen Welt wurde zu dieser Zeit eine derartige Markierung ebenfalls praktiziert. Dazu ist allerdings anzumerken, dass Ludwig die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung seiner Maßnahmen ablehnte. Nachdem es zum Beispiel im Anjou zu Pogromen gegen die Juden durch die lokale Bevölkerung kam, ließ Ludwig die Verantwortlichen verurteilen und hinrichten.[26] Dennoch bleibt festzuhalten, dass Ludwigs Vorgehen den Beginn einer öffentlichen Denunziation der Juden und eines staatlich geförderten Antijudaismus in Europa markiert.
Der Heilige
Heiligsprechung
Bereits nach Ludwigs Tod beauftragte Papst Gregor X. den königlichen Beichtvater Geoffroy de Beaulieu mit dem Sammeln von Informationen, die als Grundlage für ein Kanonisierungsverfahren dienen sollten. In der zusammengestellten Vita gelangte Beaulieu zu der Auffassung, dass Ludwig als Heiliger anerkannt werden sollte. Er erkannte in dem König einen neuen Josia, der den Tempel instandsetzen ließ, die Dirnen verbannte, das Gesetzbuch Mose (Deuteronomium) wiederentdeckt und damit den Bund zu Gott erneuert habe. Weiterhin wies er darauf hin, dass Ludwig, wie einst Josia gegen den Pharao bei Meggido, im Kampf gegen die Feinde des Glaubens das Martyrium erreicht habe.[27] Unabhängig davon beauftragte der Papst den Kardinal Simon de Brie, der ein Kanzler Ludwigs gewesen war, mit weiteren Ermittlungen in Frankreich.
Nach dem Tod Gregors X. wurde der Prozess bedingt durch darauffolgende kurze Pontifikate unterbrochen. Erst nachdem Simon de Brie 1281 als Martin IV. selber zum Papst gewählt wurde, kam es zum entscheidenden Durchbruch. Er ließ von 1282 bis 1283 mehr als dreihundert Zeugen, darunter Philipp III., Karl von Anjou und Joinville, befragen und ließ mehrere durch den König bewirkte Wunder recherchieren, von denen sechzig aktenkundig gemacht wurden. Der Tod Martins IV. brachte das Verfahren jedoch erneut ins Stocken, doch erreichte Philipp der Schöne bei Papst Bonifatius VIII. die Wiederaufnahme. Mit der Veröffentlichung der Bulle „Gloria Laus“ am 11. August 1297 in Orvieto wurde Ludwig heiliggesprochen. Dieser Akt stellte ein diplomatisches Entgegenkommen des Papstes zu Philipp dem Schönen dar, nachdem sich beide im Jahr zuvor zerstritten hatten.
Verehrung
Ludwig wurde schon zu Lebzeiten von seinen Zeitgenossen als Heiliger verehrt, was sich nach seiner offiziellen Kanonisation noch verstärkte. Dem Prestige der kapetinischen Dynastie verhalf er zu zusätzlichem Ansehen und festigte ihre Legitimation als Nachfolger der Karolinger. Insgesamt avancierte Ludwig zu einem französischen Nationalheiligen, dem nach ihm nur noch Jeanne d’Arc an Bedeutung gleich kam. Besonders stark war Ludwigs Verehrung unter dem Haus der Bourbonen, die sich direkt auf ihn beriefen und dies unter anderem in ihrer Namensgebung, dem Bau der Kathedrale Saint-Louis in Versailles oder in der Gründung des St. Ludwigsorden verdeutlichten. Unter ihrer Regierung wurden in Frankreich und seinen Kolonien mehrere Ortschaften nach Ludwig benannt, die bekannteste ist dabei St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Während der Restauration wurde die Guillotinierung Ludwigs XVI. 1793 als Reinkarnation des Martyriums Ludwigs IX. betrachtet.
Heute gilt der heilige Ludwig, neben dem heiligen Franz von Assisi und der heiligen Elisabeth von Thüringen als Patron der Franziskaner. Ebenso gilt er als Patron mehrerer Städte wie Paris, Poissy, Berlin, München oder Saarlouis. Zusammen mit seinem Cousin, König Ferdinand III. von Kastilien († 1252, hl. 1671), ist Ludwig der letzte heiliggesprochene König.
Reliquien
Bereits unmittelbar nach Ludwigs Tod bei Tunis geriet dessen Bruder Karl von Anjou mit Philipp III. in einen Streit um den Ort der Beisetzung des königlichen Leichnams. Man erzielte schließlich den Kompromiss, dass das Fleisch durch ein Bad in einer Wein-Essig-Lösung von den Knochen gelöst werden und Karl die Organe seines Bruders erhalten, während Philipp III. die Knochen mit nach Frankreich nehmen sollte. Während des Trauerzugs durch Italien, über den Mont Cenis bis nach Paris wurden die ersten drei Wunder festgehalten – allerdings starben auf dieser Reise auch Ludwigs Bruder Alfons und dessen Frau sowie die Tochter Isabella und deren Ehemann Theobald II. von Navarra.
Nach der Ankunft in Paris wurden die Gebeine in der Abtei von Saint-Denis bestattet. Anlässlich der Erhebung Ludwigs zum Heiligen wurden sie am 25. August 1298 feierlich aus dem Grab gehoben und fortan in einem Schrein hinter dem Hochaltar der Abtei gelagert. 1306 wurde mit der Erlaubnis Papst Clemens V. und unter Protest der Mönche von Saint-Denis der Schädel in die Saint-Chapelle übergeführt und in einem eigenen Schrein neben der Dornenkrone aufbewahrt. Eine Rippe wurde der Kathedrale von Notre Dame gegeben. König Philipp der Schöne schenkte der Basilika San Domenico in Bologna ein Reliquiar seines Großvaters, König Haakon V. von Norwegen erwarb mehrere Finger für eine neue Kirche in Tysnes. Königin Blanche von Schweden erhielt Reliquien für eine der heiligen Birgitta geweihten Kirche in Vadstena, ebenso wie 1378 Kaiser Karl IV. für den Veitsdom in Prag. 1430 bekam der bayrische Herzog Ludwig VII. der Bärtige einige Reliquien geschenkt für seine Residenz Ingolstadt. Während der französischen Revolution wurden die Ludwigsschreine in Saint-Denis und Saint-Chapelle zerstört, und ihr Inhalt ging verloren, somit ist Notre-Dame die einzige Kirche, die noch über eine Reliquienquelle verfügt. 1926 wurde ein Stück an Montreal vergeben und nach dem Zweiten Weltkrieg schenkte der Erzbischof von Paris, Maurice Feltin, der Sankt-Ludwigs-Kirche in Berlin-Wilmersdorf (geweiht 1897) eine Reliquie.
Die Organe Ludwigs wurden von Karl von Anjou auf Sizilien in der Kathedrale von Monreale bestattet, der für den Ort zwei Wunder beanspruchte, die aber nicht anerkannt wurden. Unklar ist, wo das Herz Ludwigs verblieb, da keine Aufzeichnungen über dessen Verbleib erhalten sind.[28] Die Organe blieben mehrere Jahrhunderte in Monreale, bevor sie der letzte Bourbonenkönig von Sizilien, Franz II., auf der Flucht vor den Truppen Garibaldis 1860 zuerst mit nach Gaeta und Rom und anschließend mit in sein Exil nach Garatshausen nahm. Dort stiftete Kaiser Franz Joseph den Reliquien einen Schrein, doch König Franz vermachte sie testamentarisch dem Kardinal Lavigerie. Der brachte sie nach Karthago, dem Sterbeort Ludwigs, wo sie in der 1890 geweihten Kathedrale St. Louis einen neuen Aufbewahrungsort bekamen. Nach der Unabhängigkeit Tunesiens 1956 wurden sie in die Saint-Chapelle übergeführt.
Familiäres
Nachfahren
Die Kinder von Ludwig IX. und Margarete der Provence sind:
- Blanche (* 4. Dezember 1240; † 29. April 1243),
- Isabelle (*2. März 1242; † 27. April 1271 in Hyères),
- ∞ am 6. April 1255 in Melun mit König Theobald II. von Navarra († 1271, als Theobald V. Graf der Champagne),
- Ludwig (* 21. oder 24. Februar 1244; † 11. Januar 1260),
- Philipp III. der Kühne (* 1. Mai 1245 in Poissy; † 5. Oktober 1285 in Perpignan), späterer König von Frankreich,
- Johann (* 1246; † 10. März 1247),
- Johann Tristan (* 8. April 1250 in Damiette; † 3. August 1270 vor Tunis), Graf von Nevers und Valois,
- Peter (* 1251; † 7. April 1284 in Salerno), Graf von Alençon,
- Blanche (* 1253 in Jaffa; † 17. Juni zwischen 1320 und 1323),
- ∞ am 30. November 1268 in Burgos mit Infante Ferdinand de la Cerda († 1275),
- Margarete (* 1255; † 1271),
- ∞ 1270 mit Herzog Johann I. dem Siegreichen von Brabant († 1294),
- Robert (* 1256; († 1275) 7. Februar 1317), Graf von Clermont-en-Beauvaisis, Stammvater des Hauses Bourbon und
- Agnes (* 1260; † 19. Dezember 1325 oder 1327 in Lantenay),
- ∞ 1273 mit Herzog Robert II. von Burgund († 1306).
Die Chronisten und Enseignements
- Jean de Joinville: Adliger Amtsträger am Hofe Ludwigs des Heiligen. Berichtet ausführlich in Le Livre des saintes paroles et des bons faits de nostre saint roi Louis (heute unter dem Titel Vie de Saint Louis bekannt) über das Leben des Königs. Er war der erste Laie der eine Biographie über einen Heiligen schrieb.
- Geoffroy de Beaulieu: Dominikaner und Beichtvater des Königs. Seine Vita et sancta conversatio piae memoriae Ludovici quondam regis Francorum gab den Anstoß zur Heiligsprechung Ludwigs.
- Guillaume de Chartres: Dominikaner und Kapelan des Königs während des Kreuzzuges nach Ägypten. Blieb im Umfeld des Hofes und nahm am Kreuzzug gegen Tunis teil. Schrieb ein Libellus über den König und ergänzte das Werk Beaulieus.
- Guillaume de Saint-Pathus: Franziskaner, war Beichtvater der Königin Margarete und nach ihrem Tod der ihrer Tochter Blanche. In sein La Vie et les Miracles de Monseigneur Saint Louis beschreibt er besonders Ludwigs Alltagsleben und dokumentiert einige Wunder.
- Guillaume de Nangis: Archivar in Saint-Denis. Schrieb eine Weltchronik (Chronicon) in der er sich besonders Ludwig dem Heiligen widmete (Vita Sancti Ludovici IX).
Weitere zeitgenössische Chronisten, die über Ludwig berichteten, waren unter anderem Salimbene von Parma, Matthäus Paris, Primat von Saint-Denis und der anonyme Ménestrel von Reims
Ludwig selbst verfasste zwei Fassungen eines Fürstenspiegels, die Enseignements, welche er seinen Kindern Philipp III. und Isabella hinterließ. Die sehr intim gehaltene Sprache dieser Texte lassen darauf schließen, dass Ludwig sie persönlich niedergeschrieben hatte, vermutlich unmittelbar vor dem Aufbruch zu seinem letzten Kreuzzug. Darin mahnt er seine Kinder zu einem gottgefälligen Lebens- und Herrschaftswandel an. Philipp solle in seinem Handeln als König die Liebe seines Volkes gewinnen, da nur dies einen guten König ausmache. Ludwig wolle lieber den Thron in der Hand eines „Schotten aus Schottland“ wissen, als das Philipp das Land schlecht regiere. An seinem Sohn gerichtet fügte Ludwig außerdem eine Morallehre des Krieges an, in der er den Krieg grundsätzlich als schlecht erachte, da dessen Opfer vor allem die armen Menschen seien. Ein König solle sich vor der Erklärung eines Krieges stetts gut und langte beraten lassen und abwägen ob überhaupt triftige Kriegsgründe vorliegen. Seiner Tochter empfahl Ludwig eine Bescheidenheit an Kleidung und Schmuck und ermahnte sie zum Gehorsam gegenüber ihrem Mann und ihren Eltern. Beiden Kindern aber gab er als höchste Tugend die Liebe und Dankbarkeit zu Gott an, welche sich in einem Leben ohne Sünde äußern und die allem anderen übergeordnet sein sollten. Dabei hob er die Pflichten zur Frömmigkeit und Barmherzigkeit hervor und empfahl eine regelmäßige Beichte, die Teilnahme an der Messe, das Gebet und eine Freigiebigkeit an Almosen für die Armen.
Die Enseignements wurden erstmals 1912 herausgegeben von Henri-François Delaborde.[29] Viele der oben genannten Chronisten haben Texte aus den Enseignements in ihren Werken einfließen lassen. Sie wurden aus den mehrheitlich lateinischen Urtexten von David O'Connell rekronstruiert.[30] Die Enseignements Ludwigs des Heiligen bilden den zweiten überhaupt von einem König verfassten Fürstenspiegel nach dem des Königs Stephan I. den Heiligen von Ungarn, mit dem sie oft verglichen werden.
Anmerkungen
- ↑ Dieser Beiname wurde zum Beispiel in der Chronik eines Spielmannes, der dem Prinzen Alfons von Poitiers gedient hatte, verwendet. Ein Fragment dieser Chronik ist in den Recueil des historiens des Gaules et de la France (Bd. XXIII, S. 146) enthalten. Bibliothèque nationale de France, Paris.
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, Kapitel IV
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, S. 227
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, S. 198
- ↑ M. Boulet-Sautel: Jean de Blanot et la conception du pouvoir royale au temps de Louis IX. (1976)
- ↑ Papst Honorius III. verbat 1218 der Universität von Paris, das römische Recht zu lehren, Papst Gregor IX. gestattete es jedoch 1235 der Universität von Orléans.
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, Teil 1, Kapitel XXI - Die heute in Vincennes zu sehende Eiche wurde erst im 20. Jahrhundert gepflanzt, gilt aber in der allgemeinen Vorstellung immer noch als die Eiche des heiligen Ludwig.
- ↑ Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, XXVIII 38
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, Kapitel XXVI, S. 51
- ↑ Nangis: Chronicon, S. 399–401
- ↑ Parker Library (Corpus Christi College, Cambridge), MS 16, fol. 4r
- ↑ M. Mollat: Le passage de Saint Louis à Tunis. Sa place dans l'histoire des croisades, in Revue d'histoire économique et sociale (1972)
- ↑ Joinville: Vie de Saint Louis, Seiten 63 und 284
- ↑ J. LeGoff: Ludwig der Heilige, Teil I, Kapitel 4 - Guillaume de Saint-Pathus bestätigte diese Legende in seiner Vita
- ↑ Jean-Louis Flandrin: Un temps pour embrasser, 3. Teil, Kap. 6
- ↑ Beaulieu: Vita et sancta conversatio piae memoriae Ludovici quondam regis Francorum, S. 10
- ↑ Vermutlich war auch seine Mutter die Auftraggeberin.
- ↑ Saint-Pathus: La Vie et les Miracles de Monseigneur Saint Louis
- ↑ J. LeGoff: Ludwig der Heilige, Teil III, Kapitel 8, S. 719
- ↑ Saint-Pathus: La Vie et les Miracles de Monseigneur Saint Louis, S. 118
- ↑ Nangis: S. 320 bis 326
- ↑ L. Wadding: Annales Minorum (Band II, 1931)
- ↑ Während der Abwesenheit Kaiser Balduins II. in Frankreich hatten dessen Barone die Dornenkrone bereits an Venedig verkauft. Um diplomatische Schwierigkeiten mit Frankreich zu vermeiden, erkannte Venedig aber ein Vorverkaufsrecht an Ludwig IX. an. Die Krone wurde auf den Seeweg nach Venedig gebracht, wo sie einige Tage für die Bevölkerung zur Besichtigung freigegeben wurde. Danach wurde sie auf dem Land unter dem Schutz eines Geleites, das Kaiser Friedrich II. gestellt hatte, nach Frankreich gebracht.
- ↑ siehe dazu Robert Branner: St. Louis and the Court Style in Gothic Architecture (Zwemmer, 1986)
- ↑ L. Aurigemma: Le Signe zodiacal du scorpion dans les traditions occidentales de l’Antiquité gréco-latine à la Renaissance (Paris, 1976)
- ↑ G. Nahon: Les ordonnances de Saint Louis, S. 23
- ↑ Die offizielle Anerkennung als Märtyrer wurde Ludwig IX. allerdings verwehrt
- ↑ Le Goff: Ludwig der Heilige, Teil I, Seite 272. 1843 wurden bei Restaurierungsarbeiten in der Saint-Chapelle neben dem Altar Fragmente eines Herzens gefunden. Die Frage, ob es sich um das Herz Ludwigs IX. handelt, wird kontrovers diskutiert.
- ↑ Henri-François Delaborde: Le texte primitif des enseignements de Saint Louis à son fils (Paris, 1912)
- ↑ David O'Connell: The teachings of Saint Louis (Chapel Hill, 1972); französische Herausgabe Les propos de Saint Louis (1974)
Literatur
- Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont: La Vie de Saint Louis, roi de France. Hrsg. von J. de Gaulle in 6 Bänden, Paris 1847-1851.
- William Chester Jordan: Louis IX and the challenge of the crusade. A study in rulership. Princeton 1979.
- Antoine F. de Lévis-Mirepoix: Saint Louis, roi de France. Paris 1970.
- Régine Pernoud: Le siècle de Saint Louis. Paris 1970.
- Gerard Sivéry: Saint Louis et son siècle. Paris 1983.
- Alain Saint-Denis: Le siècle de Saint Louis. Paris 1994.
- Jacques Le Goff: Ludwig der Heilige. Klett-Cotta, Stuttgart 2000, ISBN 3-608-91834-5.
- Dirk Reitz: Die Kreuzzüge Ludwigs IX. von Frankreich 1248/1270. Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-7068-5 (zugleich Dissertation, TU Darmstadt 2004).
- Sindy Schmiegel: Gerechtigkeitspflege und herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. Herrschaftsauffassungen des 13. Jahrhunderts im Vergleich. Dissertation, Universität Passau 2007 (Volltext)
- Anja Rathmann-Lutz: "Images" Ludwigs des Heiligen im Kontext dynastischer Konflikte des 14. und 15. Jahrhunderts. Berlin 2010, ISBN 978-3-05-004660-0.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Stanislaus I. Leszczyński
Stanislaus I. Leszczyński (eigentlich Stanisław Bogusław Leszczyński; * 20. Oktober 1677 in Lemberg, Galizien, heute Ukraine; † 23. Februar 1766 in Lunéville, Lothringen, heute Frankreich) war ein polnischer Adeliger, Magnat, Beamter im Staatsdienst (als Wojewode, Starost und Mundschenk), Reichsgraf im Heiligen Römischen Reich und Staatsmann aus dem Adelsgeschlecht der Leszczyńskis. Er wurde im Verlauf des Großen Nordischen Krieges 1704−1709, sowie erneut im Machtvakuum des Polnischen Thronfolgekrieges 1733−1736, als König von Polen und Großfürst von Litauen, gewähltes Staatsoberhaupt von Polen-Litauen.
Seine Schwiegervaterschaft mit dem französischen Königshaus brachten ihm schließlich 1737 die Herzogtümer Lothringen und Bar ein, die nach seinem Tode endgültig an Frankreich fielen.
Leben
Stanislaus wurde als Sohn der Anna Leszczyńska, geborene Jabłonowska und des Grafen Rafał Leszczyński zu Leszno, geboren. Vor seiner Wahl zum König bekleidete er verschiedene Ämter im Königreich, so war er ab 1696 Starost von Odolanów, ab 1697 Großmundschenk der Krone Polens und ab 1699 Wojewode von Posen (Wojewodschaft Posen). Die Mitglieder der Familie Leszczyński waren seit 1473 auch Reichsgrafen im Heiligen Römischen Reich. Er stand als Diplomat im Staatsdienst der Könige Jan III. Sobieski und seines Nachfolgers August II. 1698 heiratete Stanislaus die Gräfin Katharina Opalińska in Krakau. Der 1699 geborenen Tochter Anna folgte 1703 die Geburt der zweiten Tochter Maria.
Der 1699 in Moskau zwischen Zar Peter I., König August II. von Polen und Friedrich IV. von Dänemark vereinbarte Krieg gegen das Königreich Schweden entwickelte sich anders als geplant. Statt der erhofften territorialen Gewinnen im Baltikum gelangen August II. keine militärischen Erfolge gegen König Karl XII. von Schweden, im Gegenteil. Ab 1702 war polnisches Territorium unmittelbar zum Aufmarschgebiet und Kriegsschauplatz schwedischer Truppen geworden.
Nach dem Sieg von Krakau 1702 und der Eroberung von Thorn durch Karl XII. war die militärische und wirtschaftliche Position Augusts II. aussichtslos. Aufgrund der verheerenden wirtschaftlichen Folgen, spaltete sich der polnische Adel in unterschiedliche Lager auf. Die Konföderation von Warschau drängte auf eine Beendigung des Krieges. Ihr schloss sich Stanislaus Leszczyński an und führte ab 1704 die Friedensverhandlungen mit Karl XII.
Erste Regierungszeit
Das Vertrauen Karls XII. in Stanislaus Leszczyński war maßgeblich für die Unterstützung bei der Wahl zum König und Großfürst. Stanislaus konnte sich dabei gegen den von Frankreich aufgestellten Kandidaten François-Louis de Bourbon, Prince de Conti behaupten. Auch gegen die Kandidatur des polnischen Magnaten Jerzy Dominik Lubomirski und des litauischen Fürsten Radziwiłł, gewann Stanislaus die Wahl vom 12. Juli 1704 und wurde von Anhängern der Konföderation von Warschau gewählt. Die Anhänger der Konföderation von Sandomir blieben der Wahl fern und verweigerten Stanislaus I. Leszczyński die Gefolgschaft. Am 4. Oktober 1705 fanden die Krönungsfeierlichkeiten in Warschau statt.
Die Besetzung des Kurfürstentums Sachsen und der drohende Staatsbankrott veranlassten am 13. Oktober 1706 den ständisch beeinflussten Geheimen Rat zur Unterzeichnung des Friedensschlusses mit Schweden, dem Altranstädter Frieden. Am 31. Dezember 1706 unterzeichnete August II. den in seiner Abwesenheit beschlossenen Vertrag und damit den Verzicht auf die polnisch-litauische Krone.
Das politische Schicksal von Stanislaus I. war eng an das militärische von Karl XII. gebunden. In der Schlacht bei Poltawa besiegten die russischen Truppen das schwedische Heer. Karl suchte mit seinen geschlagenen Truppen Zuflucht bei Sultan Ahmet III. im Osmanischen Reich. Unmittelbar darauf kündigte August II. die Bedingungen des Altranstädter Friedens. 1709 wurde er von einem großen Teil des polnischen Adels zum legitimen König erklärt.
Erstes Exil
Mit nur wenigen eigenen Anhängern und geringen schwedischen Truppen floh Stanislaus I. Leszczyński über Stettin und Kristianstad nach Stockholm. Die Bitte um Zustimmung der Abdankung als polnischer König wurde Stanislaus I. von Karl XII. verwehrt. Dieser hoffte auf die militärische Hilfe von Ahmet III. Damit war für Stanislaus, der wie viele seiner Unterstützer sein Eigentum verloren hatte, eine Rückkehr nach Polen ausgeschlossen. Stanislaus I. folgte Karl XII. nach Bender und erhielt 1714 von diesem als Übergangslösung, bis zur Rückgewinnung von Polen, Asyl im schwedisch regierten Herzogtum von Pfalz-Zweibrücken, wo er einen eigenen Hof unterhalten durfte, der jedoch die finanziellen Kräfte des Territoriums bald überspannte. Hier starb seine älteste Tochter Anna Leszczyńska.
Nach dem Tod Karls XII., 1718, musste Stanislaus das Herzogtum verlassen und bat Herzog Leopold Joseph von Lothringen um Zuflucht. Um sich vor den von August II. ausgehenden Anschlägen auf seine Person zu schützen, begab er sich mit seiner Familie in Sicherheit der französischen Garnisonsstädte, Landau und Weißenburg im Elsass.
Auf Vermittlung von Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf wurde nach 1723 die Hochzeit der Tochter Maria Leszczyńska mit Ludwig XV. vorbereitet und am 4. September 1725 in Fontainebleau vollzogen. 1725 übersiedelte Stanislaus mit seiner Gemahlin nach Chambord.
Zweite Regierungszeit
Im Polnischen Thronfolgekrieg (1733–1735/1738) unterstützte König Ludwig XV. die Bestrebungen von Stanislaus Leszczyński die polnische Krone zurückzugewinnen. Stanislaus kehrte nach dem Tod Augusts II. aus dem Exil in Frankreich nach Polen zurück und ließ sich am 11. September 1733 mit einer deutlichen Mehrheit der Wahlmänner ein zweites Mal zum König und Großfürsten wählen. Er wurde jedoch durch eine militärische Koalition aus Österreich, Russland und Kursachsen, sowie eines Teils des polnischen Adels, die die Wahl Augusts III. und dessen Krönung am 17. Januar 1734 unterstützten, gestürzt und entmachtet.
In dem am 3. Oktober 1735 in Wien zwischen Haus Österreich und Frankreich geschlossene Präliminarfrieden erkannte Frankreich den sächsischen Kurfürsten als König von Polen an. Der Vertrag wurde bis 1. Mai 1737 im Definitivfrieden auch von Polen, Russland, Spanien und Piemont-Sardinien unterzeichnet. Am 18. November 1738 kam es zur Veröffentlichung des Friedens von Wien und zur Bestätigung der Friedenspräliminarien von 1735.
Zweites Exil
Stanislaus floh zuerst nach Danzig und fand anschließend 1734 Zuflucht bei Friedrich Wilhelm I. in Königsberg. Frankreich gab ein militärisches Eingreifen auf und einigte sich mit dem Haus Österreich im Wiener Präliminarfrieden 1735.
Ein Resultat der Vertragsverhandlungen war der Austausch der Herzogtümer Bar und Lothringen gegen das Großherzogtum Toskana nach dem Tod des letzten Großherzogs Gian Gastone de' Medici.
Ab 1736 wurde Stanislaus in das Herzogtum Bar eingesetzt. Nach dem Tod von Gian Gastone de' Medici wurde auch Lothringen an Frankreich übertragen, worauf Stanislaus seine Residenz in die Schlösser von Commercy und Lunéville verlagerte. Zur Verwaltung der Herzogtümer wurde ein französischer Intendant de Justice, Police et Finances mit Sitz in Nancy eingesetzt, der die vereinbarte Angliederung nach dem Tod von Stanislaus vorbereitete. Als Pension erhielt Stanislaus jährlich 2 Millionen Livre. In den folgenden Jahren entfaltete sich am Hof von Stanislaus in Lunéville ein bedeutendes kulturelles Leben.
Die Gemahlin von Stanislaus, Katharina Gräfin Opalińska, starb 1747 im Alter von 67 Jahren in Lunéville. Wie sie wurde Stanislaus nach seinem Tode 1766 in der von Emmanuel Héré erbauten Kirche Notre-Dame de Bon-Secours in Nancy beigesetzt. Beide Herzogtümer wurden unmittelbar danach an Frankreich angeschlossen.
Kinder
- Anna Leszczyńska (1699–1717), polnische Prinzessin;
- Maria Leszczyńska (1703–1768), polnische Prinzessin und ab 1725 Königin von Frankreich;
Adaptionen in Literatur und Musik
- Giuseppe Verdis Oper Un giorno di regno thematisiert Leszczyńskis Rückkehr nach Polen im Jahre 1733.
Literatur
- Campbell Thomas. 1842. Frederick the Great: His Court and Times, Friedrich, der Grosse king of Prussia Friedrich, Frederic Shoberl, Stanislaus Lesczinski.
- Luynes, Duc de. 1860-1865. Mémoires. Paris.
- Boyé, Pierre. 1898. La cour polonaise de Lunéville (1737–1766). Nancy.
- Boyé. Pierre. 1910. Les châteaux du roi Stanislas en Lorraine. Nancy.
- Boyé, Pierre. 1939. Le Chancelier Chaument de la Galaizière et sa famille. Nancy.
- Boyé, Pierre. 1939. Le mariage de Marie Leszcynska et l'europe, Nancy.
- Chapotot, Stéphanie. 1999. Les jardins du roi Stanislas en Lorraine. Metz: Editions Serpenoise.
- Rau-von der Schulenburg, Julia. 1973. Emmanuel Héré, Premier architecte von Stanislas Leszczynski in Lothringen. 1705-1763. Frankfurter Forschungen zur Architekturgeschichte. Bd. 4., Berlin.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Philipp IV. (Frankreich)
Fontainebleau; † 29. November 1314 in Fontainebleau), aus der Dynastie der Kapetinger war von 1285 bis 1314 ein König von Frankreich und (als Philipp I.) König von Navarra.
Er etablierte Frankreich als Großmacht in Europa und errichtete mit einer kompromisslosen Autorität ein modernes frühabsolutistisches Staatswesen, welches der mittelalterlichen französischen Monarchie eine bis dahin nie gekannte Machtentfaltung ermöglichte. Besondere Bedeutung besitzt seine Regentschaft wegen der Überführung des Papsttums nach Avignon und der Zerschlagung des Templerordens. Sein Beiname ist zeitgenössisch und bezieht sich auf sein Aussehen, welches dem Ritterideal seiner Zeit entsprochen haben soll.
Leben
Herkunft und Jugend
Philipp war der zweite Sohn des Königs Philipps III. des Kühnen und dessen erster Ehefrau Isabella von Aragón, die 1271 starb. Sein älterer Bruder war der 1263 geborene Prinz Ludwig, der damit auch der designierte Nachfolger des Vaters war. Im Jahr 1274 verheiratete sich der Vater ein zweites Mal mit Maria von Brabant und brachte damit Unruhe in den königlichen Haushalt. Denn Maria von Brabant versuchte, ihren Einfluss auf das politische Tagesgeschehen geltend zu machen gegen die Partei der Königinmutter Margarete von der Provence und des Kämmerers Pierre de la Brosse. Unterstützt wurde sie dabei vom Onkel des Königs, Karl von Anjou, der über Maria seinen eigenen Einfluss auf die französische Politik festigen wollte.
Karl von Anjou versuchte, das französische Königtum für eigene Interessen zu instrumentalisieren, als Druckmittel gegen König Peter III. von Aragon, der ihm ein ernstzunehmender Gegner um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum war. Gegenstand dieser Interessen wurde auch Philipp, der im Mai 1275 mit der Erbin des Königreichs Navarra und der Grafschaft Champagne, Johanna I., verlobt wurde. Navarra sollte so in eine gemeinsame Front gegen Aragon eingespannt werden. Als im Jahr darauf der Kronprinz verstarb, fiel darüber Pierre de La Brosse, der des Giftmordes angeklagt und anschließend hingerichtet wurde. Obwohl der Kämmerer Maria von Brabant der Tat beschuldigt hatte, verdrängte diese, und mit ihr Karl von Anjou, die Königinmutter vom Hof. Philipp selbst stieg damit in der Nachfolge an die erste Stelle auf.
Nachdem Karl von Anjou in der sizilianischen Vesper 1282 die Insel Sizilien an Aragon verloren hatte, gewann er den Papst für sich, der zu einem Kreuzzug gegen Aragon aufrief. König Philipp III. entschloss sich auf Drängen seiner Frau, dieses Unternehmen durchzuführen, die ablehnende Haltung Prinz Philipps ignorierte er dabei. Der Feldzug wurde ein Desaster, den der König im Oktober 1285 in Perpignan mit dem Leben bezahlte. Philipp ließ den Feldzug umgehend abbrechen und nahm diplomatische Kontakte zu Aragon auf.
Regierung
Am 6. Januar 1286 wurde Philipp in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt und gesalbt. Seine erste Regierungsmaßnahme war die Beseitigung der Grabenkämpfe am Hof, indem er Maria von Brabant von dort verdrängte und die Großmutter Margarete von der Provence zu einem Rückzug in ein Kloster bewegen konnte.
Philipp gedachte seine Herrschaft über einen königlichen Rat auszuüben, was zwar nicht ungewöhnlich für einen König seiner Zeit war, wohl aber dass er sich bei der Besetzung dieses Rates auf qualifizierte Personen wie Rechtskundige und Finanzfachleute verließ, ungeachtet ihrer ständischen Herkunft. Die bekanntesten von ihnen waren Pierre Flote, Guillaume de Nogaret und Enguerrand de Marigny. Auch ließ Philipp im verstärkten Maße getroffene Entscheidungen dieses Rates von einem seiner Vertreter öffentlich verkünden und begründen, was in seinem Umfeld den Eindruck erweckte, der König sei von seinen Ratgebern abhängig und werde von diesen beherrscht - eine Frage, die noch heute die Geschichtswissenschaft beschäftigt. Der Bischof von Pamirs, Bernard Saisset, urteilte nach einer Audienz bei dem König: „der König war nicht Mensch, noch Bestie, sondern eine bloße Statue“.
Eine bedeutende Erneuerung in Philipps Regierungszeit war die von ihm vorangetriebene Etablierung eines institutionalisierten Justizwesens und die damit verbundene Entstehung der Rechtswissenschaften. Philipp griff dabei auf die Provinzparlamente zurück, die dem König ursprünglich als Rat gebende Organe dienten, welche er in königliche Gerichte umwandelte, die fortan das Recht vertraten und durchsetzten. Da die Richter aller Parlamente von der Krone ernannt wurden, wurde das königliche Recht zu einem staatlichen Recht und damit zu einem Instrument königlicher Machtausübung. Diese Justiz basierte besonders auf dem römischen Recht, welches vor allem von den Legisten aus den Rechtsuniversitäten des Languedoc vermittelt wurde und den König zu der Auffassung gelangen ließ, Kaiser in seinem Reich zu sein. Zu diesem Zweck wurden die Universitäten von Montpellier (1289) und Orléans (1312) gegründet, die Gerichte des Adels oder der Geistlichkeit wurden dadurch zunehmend verdrängt. Philipp berief sich in seinen machtpolitischen Auseinandersetzungen in erster Linie auf sein königliches Recht, welches er gegen alle seine Gegner, ob unbotmäßige Untertanen oder den Papst, verwendete und nicht davor zurückschreckte, dieses auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Dabei nahm er keine Rücksicht auf althergebrachte Rechtsauffassungen oder Traditionen des Gewohnheitsrechts, womit seine Herrschaft unter seinen Zeitgenossen den Anstrich einer Tyrannei erhielt.
Ein weiterer Meilenstein unter Philipps Regentschaft war der Durchbruch des dritten Standes, der Bürger, als eine politische Größe in Frankreich. Wie kein anderer König vor ihm stützte Philipp seine Macht auf diesen wirtschaftlich starken Stand als Verbündeten gegen den auf Privilegien pochenden Adel oder gegen die viel zu selbständige Geistlichkeit. In seinem Konflikt gegen den Papst ließ Philipp 1302 den dritten Stand erstmals Sitze im königlichen Parlament einnehmen, weshalb er damit als Begründer der Generalstände angesehen wird. Zweck dieser Maßnahme war die Demonstration eines geschlossenen Volkswillens gegen den Machtanspruch des Papstes. Zudem gab Philipp zu diesem Anlass dem Gremium erstmals eine geregelte Form und arretierte dieses in Paris.
Philipp war seine gesamte Regierungszeit - bedingt durch sein hohes außenpolitisches Engagement - mit finanziellen Lasten verbunden, die ihn ständig dazu zwangen, neue Einnahmequellen zu erschließen. Dabei griff er neben Steuererhöhungen und der Besteuerung des Adels und des Klerus in besonderen Maßen auf Verringerungen des Edelmetallgehaltes neu geschlagener Münzen und auf mehrfach vorgenommene Entwertungen älterer Münzen zurück. Mittels polizeistaatlicher Mittel zwang er seine Untertanen dazu, seine schlechten Münzen zu benutzen, was ihm den Ruf eines „Falschmünzerkönigs“ eintrug. Im Gegenzug führte diese Politik zu einem Bedeutungsverlust der Münzen des Adels und der Bischöfe, die einst ihr Münzrecht von der Vergabe königlicher Privilegien seitens Philipps Vorgänger bezogen und damit ihre wirtschaftliche Stärke begründet hatten. Im letzten Jahr seiner Regierung formierte sich deshalb der Adel in denjenigen Provinzen, welche sich gegen diese Eingriffe der Krone in die Münze und gegen die immer höhere Besteuerung auch mit Waffengewalt zu Wehr zu setzen bereit war. Im Zusammenhang mit der Gewinnung neuer Finanzmittel steht auch, neben der Zerschlagung des Templerordens 1307, die 1306 vorgenommene Ausweisung von über 100.000 Juden aus Frankreich und der damit einhergehenden Enteignung ihres Vermögens. Erst Philipps Sohn gewährte ihnen die Rückkehr. Gleiches wiederholte er in den Jahren 1309 bis 1311 mit den „Lombarden“, das heißt den italienischen Kaufleuten und Bankiers. Letztlich hatten all diese Maßnahmen keinen Erfolg, seinem Nachfolger hinterließ Philipp eine leere Kasse.
Philipps Tod am 29. November 1314 nach einem Jagdunfall wurde von seinen Untertanen als Befreiung von einer Gewaltherrschaft angesehen. Viele seiner engsten Ratgeber wurden von seinen Söhnen verbannt oder gar hingerichtet. Seine schärfsten polizeilichen und fiskalen Zwangsmittel wurden zurückgenommen, und doch wurden seine administrativen und politischen Neuerungen bewahrt und fortgeführt. Letztlich hinterließ er ein in seinen Fundamenten gefestigtes Königtum, welches sich seit ihm als ein Staat definierte und diesem die Kraft verlieh, auch die gefahrvollsten Stürme wie den hundertjährigen Krieg zu überstehen. Bestattet wurde er in der Abtei von Saint-Denis, deren Grablegungen seiner Vorgänger er neu gestalten ließ.
Der aquitanische Konflikt
Einen grundsätzlichen Konflikt erbte Philipp von seinen Vorgängern in Bezug auf das Verhältnis der französischen Krone zum englischen König. Seinen Ausgangspunkt hatte er nach der Zerschlagung des sogenannten angevinischen Reichs der Dynastie Plantagenet durch Philipps Ur-Urgroßvater Philipp II. August im Jahr 1204, was zu einem Verlust nahezu aller festländischen Territorien für die Plantagenets führte. König Heinrich III. von England scheiterte mit dem Versuch, diese Gebiete zurückzuerobern und erkannte im Vertrag von Paris (1259) seinen verringerten Besitzstand in Frankreich an, der sich um die Gascogne und den Westen des alten Aquitanien (zusammen auch Guyenne genannt) konzentrierte. Zudem verpflichtete er sich und seine Nachkommen, für diese Gebiete den französischen König als Lehnsherren anzuerkennen und diesem entsprechend zu huldigen, womit die englischen Könige unter die Pairs von Frankreich aufgenommen wurden.
Die Beendigung dieses Lehnsverhältnisses setzte sich König Eduard I. von England zum Ziel und versuchte, die Herauslösung der Guyenne aus der französischen Oberhoheit zu erreichen, was nur auf deren Kosten zu bewerkstelligen gewesen wäre. Philipp lehnte diese Bestrebungen ab und erreichte erfolgreich nach seinem Herrschaftsantritt 1286 die geforderte Huldigung Eduards. Dennoch kam es zu fortgesetzten Spannungen zwischen beiden Herrschern, insbesondere in den rechtlichen Verhältnissen, zu welcher der englische König zu dem französischen zu stehen habe. Zu einem kriegerischen Konflikt artete dieser Streit 1293 aus, nachdem es im Hafen von Boulogne zu Übergriffen englischer Seeleute auf französische gekommen war, bei dem es zu einigen Todesopfern kam. Philipp zitierte Eduard nach Paris, damit dieser vor dem Pairsgericht für diesen, für damalige Verhältnisse an sich belanglosen Vorfall, Stellung nehmen solle. Doch Eduard war zu diesem Zeitpunkt mit einer um sich greifenden Erhebung der Schotten gegen die englische Herrschaft beschäftigt und war daher auf der Insel unabkömmlich.
Eduard bot stattdessen einen Kompromiss an. Philipp sollte seine Burgen in der Guyenne besetzen als Strafmaßnahme für sein Versäumnis, vor dem Gericht zu erscheinen. Nachdem er die Revolte in Schottland beendet habe, wolle Eduard nach Frankreich kommen, um sich zu verantworten. Dabei sollte es zu einer erneuten Huldigung kommen, wonach Philipp ihn erneut mit der Guyenne belehnen sollte. Auf diese Weise würden beide Monarchen ihr Gesicht wahren und Philipp konnte sich außerdem als mildtätiger Herr gegenüber seinen Vasallen erweisen. Tatsächlich besetzte Philipp 1294 einige Burgen Eduards, doch forderte er ihn erneut auf, unverzüglich vor dem Gericht zu erscheinen, mit der Drohung, ihn seiner Lehen für verlustig zu erklären und diese der Krondomäne einzugliedern. Dies bedeutete faktisch den Beginn eines Krieges zwischen beiden Königen.
Der Flandernkrieg
Unterwerfung Flanderns
Eduard I. von England fand in dem Grafen Guido I. von Flandern einen Verbündeten, dessen Interessen ähnlicher Natur waren. Der Graf von Flandern konnte sich einst nur mit der Hilfe der französischen Krone in dem flämischen Erbfolgekrieg gegen seine Halbbrüder behaupten, auf Kosten von Machteinbussen seiner gräflichen Würde. König Philipp der Schöne stützte seinen Einfluss in Flandern vor allem auf die Patrizier in den Städten. Obwohl diese ihre wirtschaftliche und politische Stärke durch ihren Tuchhandel mit England begründeten, waren sie auf gute Beziehungen mit dem König bedacht, der ihre Handelsprivilegien mit England akzeptierte und sie vor dem Zugriff eines starken Grafen schützte. Graf Guido strebte danach, seine gräfliche Würde zu ihrer alten fast souveränen Stellung zurückzuführen und sich vom königlichen Einfluss zu befreien, womit er damit in einem Gegensatz zu König Philipp stand.
Im Jahr 1294 nahm Graf Guido enge diplomatische Beziehungen zum König von England auf und verlobte eine seiner Töchter mit dem Prince of Wales. Philipp verweigerte dazu seine notwendige Einwilligung und der Graf musste nachhaltige Treue schwören. Dennoch setzte der Graf seine Politik fort und gewann in Grammont (Dezember 1296) den deutschen König Adolf von Nassau, der ein Erstarken Frankreichs im lothringisch-niederländischen Raum verhindern wollte, und weitere Reichsfürsten für seine Sache. Nachdem Philipp den Grafen aufforderte, diese Handlungen zu erklären, kündigte dieser am 20. Januar 1297 sein Vasallitätsverhältnis zu Frankreich auf. Der König berief darauf ein Pairsgericht ein, welches den Grafen des Hochverrats und der Felonie verurteilte und ihm sein Lehen entzog. Weiterhin erreichte Philipp beim Papst die Verhängung des Kirchenbanns über Graf Guido und des Interdikts über Flandern.
Die militärische Bekämpfung des antifranzösischen Bündnisses ging Philipp entschlossen an. In die Guyenne entsandte er seinen Bruder Karl von Valois, der dort nur auf geringen englischen Widerstand stieß und nach einer erfolgreichen Unterwerfung dieser Provinz 1295 sein Heer nach Flandern führte. Dorthin hatte inzwischen Graf Robert II. von Artois ein Heer geführt, wo er eine Stadt nach der anderen, wie Kortrijk, Dünkirchen, Bergen und Brügge, einnehmen konnte. Begünstigt wurden diese schnellen Erfolge durch die für Frankreich positiv gesinnten Patrizier und der dem Grafen versagten Unterstützung des deutschen Königs, der mittels einer Zahlung französischen Goldes und nach päpstlichem Druck auf einen Krieg trotz seines Bündnisses mit Flandern und England verzichtete. Nachdem die königlichen Truppen am 26. August 1297 Lille eingenommen hatten, war Graf Guido, der sich nur noch in Gent halten konnte, bereit unter päpstlicher Vermittlung am 9. Oktober in Vyve-Saint-Bavon einen Waffenstillstand einzugehen. Dieser wurde 1298 in Tournai um zwei Jahre verlängert.
Zwischenzeit
Nach Auslaufen des Waffenstillstandes 1300 gab Graf Guido den Kampf auf. Bereits ein Jahr zuvor wurde sein einzig wirklicher Bündnispartner, Graf Heinrich III. von Bar, gefangen genommen und Eduard I. versöhnte sich mit Frankreich, nachdem Philipp die Besetzung der Guyenne aufgehoben hatte und diesem seine Schwester, wie auch dem Prince of Wales seine Tochter zur Frau versprochen hatte. Eine Weiterführung des Kampfes war für den Grafen unter diesen Umständen aussichtslos. Trotz des Ehrenwortes Karls von Valois auf ein freies Geleit wurde Guido mit seinem ältesten Sohn Robert von Béthune bei der Zusammenkunft mit dem König von diesem in ritterliche Haft genommen, Guido in Compiegne, Robert in Bourges. Flandern wurde der Verwaltung königlicher Statthalter anvertraut. Philipp erschien persönlich 1301 in Flandern, wo er die Seeblockade Gents durch Eduard I. von England auflöste und neue Festungen anlegte. In einem 1301 in Brügge unterzeichneten Vertrag wurden die neuen Herrschaftsverhältnisse bestimmt.
Aufstand der Flamen
Trotz dieses Erfolges büßte die Krone in der flämischen Bevölkerung schnell an Ansehen und Rückhalt ein. Ausschlaggebend war hier Philipps rigide Finanzpolitik, der trotz des Endes des Krieges die erhobene Kriegssteuer nicht abschaffen wollte. Dies versetzte die schon seit längerem sozial benachteiligten Handwerker in Aufruhr, welche einige Häuser der wohlhabenden Patrizier und Tuchhändler angriffen. Daraufhin ließ der Statthalter Jacques de Châtillon die Städte Brügge und Gent mit einer Besatzung versehen. Doch am Morgenläuten des 18. Mai 1302 drangen die Bürger von Brügge in die Unterkünfte der königlichen Soldaten ein und töteten wahrscheinlich mehrere Hundert von ihnen (Brügger Frühmette).
Der Aufstand ergriff alle flämischen Städte, die sich hinter dem Grafen Johann I. von Namur, einem jüngeren Sohn Graf Guidos, sammelten. Philipp reagierte darauf mit der Entsendung eines Heeres unter Robert von Artois. Wider Erwarten wurden die französischen Ritter am 11. Juli 1302 in der Schlacht der goldenen Sporen bei Kortrijk (Coutrai) von dem Bürgerheer der Flamen vernichtend geschlagen. Mehr als siebenhundert Ritter verloren ihr Leben, darunter die gesamte militärische Führung Frankreichs.
Unter dem Eindruck dieses Schlages einigte sich Philipp mit Eduard I. von England im Frieden von Paris 1303 auf eine Rückkehr ihrer Beziehungen auf den Status vor Beginn ihres Krieges. Zu einer Lösung der grundlegenden Probleme zwischen den Monarchen ist es dabei nicht gekommen, womit dieser Konflikt noch unter ihren Nachkommen weitergetragen wurde und erst mit dem Ende des hundertjährigen Krieges auch sein Ende fand. Philipp allerdings gewann somit freie Hand und sogar die Unterstützung Eduards gegen Flandern, indem der englische König die flämischen Kaufleute aus England verwies und somit den wirtschaftlichen Druck auf die Aufständischen erhöhte. Philipp zog am 22. Juli 1304 in Arras ein neues Heer zusammen und zog am 9. August in Tournai ein. Wenige Tage später vernichtete seine Flotte unter Raniero Grimaldi bei Zierikzee die überlegene Flotte der Flamen und am 17. August 1304 siegte schließlich das französische Heer, angeführt vom König, in der Schlacht bei Mons-en-Pévèle.
Der brüchige Frieden in Flandern
Ungeachtet dieser Erfolge sollte Philipp zu seinen Lebzeiten Flandern nie vollständig befrieden können. Am 24. Juni 1305 unterzeichnete der neue Graf von Flandern, Robert III., den Frieden von Athis-sur-Orge, indem er wieder unter die Oberhoheit Frankreichs zurückkehrte. Die Burgvogteien Lille, Douai und Béthune mussten an die Krone übergeben werden, weiterhin wurden den flämischen Bürgern erdrückende Entschädigungszahlungen und die Schleifung ihrer Stadtbefestigungen auferlegt. Die in den vergangenen Jahren zu politischem Selbstbewusstsein erlangten Bürger lehnten diesen Vertrag aber ab, weshalb die Krone über die Städte Flanderns faktisch keine Kontrolle erreichte. Der königliche Großkammerherr Enguerrand de Marigny handelte im Juli 1312 in Pontoise die „flandrischen Abtretungen“ aus, wonach die Krone im Besitz der drei Vogteien blieb und zugleich auf den finanziellen Ausgleich verzichtete.
Doch auch dies konnte den Frieden nicht erzwingen. Nach Philipps Tod sollten die Flamen unter der Führung Graf Roberts III. erneut gegen die Krone aufbegehren und erst 1320 unter der Regentschaft Philipps V. des Langen zu einem endgültigen Frieden auf Basis des Vertrags von Pontoise bereit sein. Der Ausgang dieses Konflikts steht den Motivationen König Philipps IV. zu dessen Beginn 1297 entgegen. Zwar hatte er das flämische Grafenhaus wieder unter die Botmäßigkeit Frankreichs gezwungen, doch emanzipierten sich im Gegenzug die flämischen Bürger in ihren Städten von der königlichen Hoheit, die sie nur noch formell anerkannten. Dies begründete die faktische Souveränität Flanderns nördlich der Lys, doch sollte dieses reiche Land erst in den Verträgen von Arras 1482, Senlis 1493 und Cambrai 1529 dem französischen Königreich gänzlich verloren gehen.
Konflikt mit dem Papst
König Philipp IV. führte zu Beginn seiner Regierung ein entspanntes Verhältnis zum Papsttum. Damit führte er die traditionell freundschaftlichen Beziehungen der französischen Krone zum Oberhaupt der römischen Kirche fort, die das gesamte hohe Mittelalter bestand hatte, im Gegensatz zu den römisch-deutschen Königen und Kaiser, die immer wieder in machtpolitische Konflikte mit dem Pontifikat gerieten. Philipp selbst war auf den Papst als Vermittler angewiesen in seinen Bemühungen, nach dem aragonesischen Kreuzzug seines Vaters das Verhältnis zu Aragon wieder zu normalisieren. Und mit Erfolg konnte 1295 in Anagni unter dem Schirm Papst Bonifatius VIII. ein formeller Frieden zwischen beiden Königreichen erreicht werden. Als wichtiger Bündnispartner erwies sich der Papst dem König, als er dem deutschen König mit dem Bann bedrohte, falls dieser sich militärisch zugunsten Flanderns engagiere.
Erste Verstimmungen 1296 und Entspannung 1297
Der Krieg Philipps gegen England und Flandern führte allerdings auch zu einer ersten Konfrontation der königlichen Autorität mit der universellen Selbstbestimmung des Papstes und seines Klerus. Wieder waren finanzielle Gründe Philipps der ausschlaggebende Punkt, der dringend Geld für seine Kriege benötigte und daher auch den Klerus besteuerte und zugleich einen Anspruch auf den Zehnten stellte. Für Papst Bonifatius VIII. war dies unhaltbar: er reagierte darauf mit der Bulle Clericis laicos, die den Bischöfen in Frankreich verbot, Steuern an Laien zu zahlen. Damit verbunden war die Androhung des Kirchenbanns gegen Geber und Empfänger der Steuern. Diese Drohung verfehlte ihr Ziel und Philipp reagierte mit einem Ausfuhrverbot von Edelmetallen, Münzen, Edelsteinen, Waffen und Pferden nach Italien, was dort zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führte. Weiterhin erklärte Philipp die Geistlichkeit Frankreichs zu Gliedern des Staates, die sich als Grundbesitzer in Frankreich den allgemeinen Lasten nicht entziehen dürfen.
Angesichts der negativen wirtschaftlichen Konsequenzen für Italien und damit für den Papst sah sich dieser zum Einlenken gezwungen. Noch im Jahr 1296 veröffentlichte er die Bulle Ineffabilis und schließlich im Frühjahr 1297 die Bulle Etsi de statu, in denen er die Bestimmungen der Clericis laicos revidierte. Die Beziehungen wurden weiter verbessert, nachdem Bonifatius VIII. den Großvater Philipps, König Ludwig IX., kanonisierte. Philipp ließ sogar, seinen persönlichen Standpunkt ignorierend zu, dass der Papst sich als Privatmann in dem Krieg gegen England und Flandern als Vermittler einschaltete. Als er dabei aber zu ungunsten der Position Philipps entschied, lehnte der König jede weitere Bemühungen durch den Papst ab unter dem Hinweis, dass es diesem nicht zustehe, über weltliche Belange zu urteilen.
Eskalation
Damit vollführte Philipp einen erneuten Bruch mit dem Papst, der dieses Mal nicht zu beheben war. Der Papst nahm in den folgenden Jahren offen Position für den Grafen Guido von Flandern und forderte dessen Freilassung. Weiterhin demonstrierte er gegenüber dem König seinen Handlungsspielraum in Frankreich, indem er in Pamiers ein neues Bistum einrichtete, ohne sich darüber mit dem König zu unterreden. Besetzt wurde das neue Bistum mit dem Abt von Saint-Antonin zu Pamiers Bernard Saisset. Der war seit längerem ein Intimfeind des Königs, seitdem dieser in Auseinandersetzungen des Abtes mit dem Grafen Roger Bernard III. von Foix zugunsten des Grafen gewirkt hatte.
1301 eskalierte die angespannte Situation, nachdem Saisset öffentlich die Forderung des Papstes, den Grafen von Flandern frei zu lassen, unterstützte. Diese an sich bedeutungslose Episode nutzte Philipp als Vorwand für eine Konfrontation mit dem heiligen Stuhl. Er berief eine Untersuchungskommission ein, welche den Verdacht des Hochverrates des Bischofs untersuchen sollte. Belastende Zeugenaussagen, darunter die der Grafen von Foix und Comminges, spielten dem König in die Hände, der im Oktober 1301 den Bischof von Pamiers verhaften ließ und ihm in Senlis den Prozess machte. Der Papst sah hier die Unabhängigkeit der geistlichen Justiz und seine Oberhoheit über diese bedroht und sandte im Dezember 1301 die Bulle Ausculta fili an den Hof zu Paris, in der er die Bischöfe Frankreichs wie auch den König dazu aufforderte, nach Rom zu kommen, um die Verhältnisse zwischen weltlichen und geistlichen Machkompetenzen zu klären. Philipp verhinderte die Veröffentlichung der Bulle durch ihre Verbrennung und ließ eine Fälschung dieser anfertigen, die einen weitaus schärferen Ton seitens des heiligen Stuhles gegen die Krone suggerierte, weiterhin berief er seinen ihm ergebenen Rat ein, der den Beschluss fasste, eine „öffentliche Meinung“ gegen den Papst in Frankreich mobil zu machen. Zu diesem Anlass wurde am 10. April 1302 eine Versammlung der Pairs, Prälaten und erstmals auch bürgerlichen Vertretern der Städte in Notre-Dame einberufen, wo der königliche Rat Pierre Flote eine Klagerede gegen die Übergriffe der Kurie vortrug und die Einberufung einer französischen Nationalsynode durch den Papst in Rom als einen Angriff auf die Rechte und Freiheiten des Königs verstand (Dekretale Per Venerabilem).
Darauf verfassten Adel und Bürger für das römische Kardinalskolleg eine Erklärung, die ganz im Sinne Philipps ausfiel. Auch der noch zögernde Klerus sah sich auf königlichen Druck gezwungen, eine entsprechende Ablehnung dem Papst zukommen zu lassen. Der Papst verwarf diese Erklärung und ermahnte den König, sich von den diabolischen Einflüsterungen seiner Räte zu befreien. Jene Bischöfe, die nicht zur befohlenen Synode erscheinen würden, bedrohte er mit der Absetzung. In dieser Zeit mobilisierten beide Seiten ihre Theologen, um eine Schlacht der publizistischen Argumente zu führen, welche die Frage nach der päpstlichen Gewaltenfülle beinhaltete. Auf päpstlicher Seite waren dies besonders Aegidius Romanus und Jakob von Viterbo, auf französischer Johannes von Paris (Jean Quidort). In den Herbsttagen 1302 erschienen trotz der königlichen Sanktion vierzig französische Bischöfe zu der Synode in Rom, in welcher der Papst in der Bulle Unam Sanctam unverhüllt den päpstlichen Weltherrschaftsanspruch formulierte und für alle weltlichen Fürsten verbindlich erklärte.
Das Attentat von Anagni
Der Papst hoffte auf eine Durchsetzung seiner Position, nachdem sein ärgster Gegner Pierre Flote bei Coutrai gefallen war, doch nahm seine Position als erster königlicher Rat der nicht minder entschlossene Guillaume de Nogaret ein. Im Frühjahr 1303 berief Philipp eine erneute Versammlung der Pairs und Prälaten im Louvre ein, wo er Nogaret als Ankläger auftreten ließ, der den Papst der verschiedensten Verwerfungen bezichtigte, allen voran das der Häresie, welches das einzige Vergehen war, das einen Prozess gegen das Kirchenoberhaupt erlaubte. Unter Nogarets Leitung kam die Versammlung zu der Auffassung, dass man Bonifatius VIII. nicht mehr als rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche anerkennen könne und ermächtigte den König dazu, eine Kirchenversammlung einzuberufen, um einen neuen Papst wählen zu lassen. Obwohl sich bereits Zeitzeugen darüber bewusst waren, dass es einer königlichen Versammlung nicht annähernd zustand, über das Oberhaupt der Christenheit zu befinden, nahm Philipp diesen Beschluss an. Dem Weltherrschaftsanspruch des Papstes setzte er damit seine politische und juristische Souveränität entgegen, die über dem König keine weitere Autorität anerkannte.
Über die Anschuldigungen gegen den Papst sollte ein Generalkonzil befinden, mit dessen Einberufung Nogaret betraut wurde, der sich nach Italien begab, um dort Verbündete unter den nicht geringen Gegnern des Papstes, vornehmlich aus dem Hause Colonna, zu finden. Bonifatius seinerseits versuchte vergebens, durch Gunstbeweise Albrecht I. als den römischen König für sich zu gewinnen. Im Sommer 1303 zog sich Bonifatius wieder in seine Sommerresidenz Anagni zurück, wo er für den 8. September des Jahres die Exkommunikation gegen Philipp plante. Nogaret, der in der Zwischenzeit das Generalkonzil auf den Weg gebracht hatte, sah sich zum Handeln gezwungen. Unterstützt durch Truppen der Colonnas drang er in der Nacht vom 6. auf den 7. September in den Palast des Papstes in Anagni ein und nahm diesen, der eine Flucht aus Altersgründen ablehnte, unter Arrest. Am 9. September gelang es der Bevölkerung der Stadt den Palast zu stürmen, was dem Papst die Flucht nach Rom ermöglichte.
Das „Attentat von Anagni“ war gescheitert. Und doch sollte Philipp als Sieger aus diesem Konflikt hervor gehen, nachdem der Papst am 11. Oktober 1303 fiebergeschwächt bei einem Wutanfall, ausgelöst durch seine Behandlung durch die Soldateska, verstarb. Mit ihm starb auch sein formulierter Anspruch auf die Weltherrschaft und das Ansehen des heiligen Stuhls, welches sich in gewalttätigen Erhebungen der Stadtbevölkerung Roms niederschlug.
Das babylonische Exil
Bonifatius' Amtsnachfolger, Benedikt XI., befreite sich mit Hilfe der Orsinis aus Rom und nahm in Perugia seine Residenz. Dort sprach er zwar den Bann gegen Nogaret und die Colonnas aus, doch nahm er jede gegen Philipp gerichtete Maßnahme seines Vorgängers in sechs Bullen zurück. 1304 starb er, Gerüchten zufolge durch Gift, welches Philipp ihm bestellt haben soll.
Darauf wurde auf dem fünfzehn Monate dauernden Konklave in Perugia, welches ganz von französischen Kardinälen dominiert wurde, der Erzbischof von Bordeaux als Clemens V. zum neuen Papst gewählt. Dieser hatte zuvor die Gunst Philipps gewonnen, als er nicht nur die Aufhebung der Sanktionen gegen Frankreich versprach, sondern auch bereitwillig den Zehnten für fünf Jahre der Krone überließ und außerdem Philipp ein Mitspracherecht bei der Ernennung von Kardinälen einräumte. Aufgrund der Unruhen, die in Italien ausgebrochen waren, verzichtete Clemens auf eine Reise dorthin und nahm seine Residenz in Lyon, wo er in Gegenwart Philipps gekrönt wurde. Lyon gehörte damals noch formell zum Heiligen Römischen Reich. Nachdem sich dieser Status aber zugunsten Frankreichs geändert hatte, zog er 1309 nach Avignon. Doch letztlich wurde das Papsttum auch dort zu einer Marionette des französischen Königtums, denn Avignon lag in der Provence, das zwar noch zum römisch-deutschen Reich gehörte, aber von der französischstämmigen Königsfamilie von Neapel regiert wurde, die zu ihren Vettern in Frankreich engste politische Beziehungen pflegte.
Das babylonische Exil der Kirche in Avignon bedeutete für das Papsttum einen epochalen Einschnitt in seiner Geschichte. Dort wo Kaiser Heinrich IV. über zweihundert Jahre zuvor gescheitert war, hatte Philipp IV. triumphiert. In Avignon sank das Papsttum von seinem Anspruch, universeller Herr über das christliche Abendland zu sein, an dem es noch lange verbal festhielt, zu einem französischen Provinzfürstentum herab. Auch nach dem Ende des Exils siebzig Jahre später, sollte der Papst nie wieder die Machtposition einnehmen, wie sie einst von Gregor VII. gegen den Kaiser begründet und von Innozenz III. auf seinen Gipfel geführt wurde.
Die Auflösung des Templerordens
Philipp nahm den Papst als neues Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen sogleich in Anspruch, nachdem er die Zerschlagung des Templerordens beschlossen hatte. Grund für diesen Entschluss war wieder einmal die angespannte Haushaltslage des Königs, aber auch die seinem Zugriff verwehrte militärische und besonders finanzielle Stärke dieser Organisation, deren unabhängiger Status im Widerspruch zu Philipps Auffassung königlich-staatlicher Autorität stand. Der Orden kontrollierte praktisch die gesamten Bankgeschäfte der Krone und war dabei nur dem Papst zur Rechenschaft verpflichtet. Seine Unabhängigkeit gegenüber dem König hatte der Orden mehrfach bewiesen, indem er offen Papst Bonifatius VIII. und mehrere Revolten der Pariser Bevölkerung gegen die andauernden Münzverschlechterungen des Königs unterstützt hatte. Als Reaktion darauf hatte Philipp bereits 1295 den Staatsschatz aus dem Turm des Temple in den Louvre überführen lassen.
Philipp nutzte in seinem Vorhaben die bereits weit verbreitete Kritik an dem Orden, der scheinbar nicht bereit war, nach dem Fall Akkos und dem endgültigem Verlust Outremers an die Muslime 1291 sich ein neues Betätigungsfeld im Kampf gegen die Heiden zu suchen, dies im Gegensatz zu den Deutschherren oder Johanniter, die den Kampf in das Baltikum und in das Mittelmeer verlagerten. Weiterhin erweckten die höchst verschwiegenen und als arrogant empfundenen Tempelritter in der einfachen Bevölkerung Verdacht. Nachdem ein Bürger von Béziers 1306 beim König von Aragon kein Gehör für seine Anklagen gegen den Orden gefunden hatte, nahm Philipp diese dankbar auf, doch wartete er, bis der Großmeister Jacques de Molay einer Einladung Papst Clemens V. folgend nach Frankreich kam. Der Papst gab anschließend im August 1307 in Poitiers dem König sein Einverständnis für einen Prozess gegen die Templer. An einem Freitag dem 13. Oktober wurden in einer von Nogaret streng koordinierten Aktion die meisten Ordensangehörigen verhaftet. Man klagte sie wegen Ketzerei, Götzenanbetung, sodomistischer Praktiken und anderer Verfehlungen an. Die anschließenden Verhöre nahm der königliche Beichtvater Imbert vor. Nachdem es auf dem Konzil von Vienne 1311 zu unerwarteten Beifallsbekundungen des Klerus für den Orden kam, der sich besonderes aufgrund der durch Folter erzwungenen Geständnisse der Ritter einschließlich des Großmeisters entzündete, richtete Philipp einen Appell an den Papst. Der löste am 22. März 1312 aus „apostolischer Machtvollkommenheit“ den Orden auf.
Der finanzielle Erfolg hielt sich für Philipp in Grenzen, da der Papst den Großteil des Ordensvermögens an die Johanniter überantwortete. Lediglich für die Prozesskosten wurde die Krone ausgezahlt, die entsprechend hoch ausgefallen sein sollen. An einer großen Anzahl Ordensritter wurde ein Autodafé vollzogen, da diese nach dem Konzil von Vienne ihre Geständnisse zurückgenommen hatten und daher von den Inquisitionsgerichten als rückfällige Ketzer behandelt wurden. Am 19. März 1314 wurden in Paris der Großmeister und der Ordensmeister der Normandie als letzte verbrannt.
Reichspolitik
Seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts hatte sich im Verhältnis Frankreichs zum Heiligen Römischen Reich ein grundlegender Wandel vollzogen, der von dem Aufstieg der französischen Königsmacht bei gleichzeitigem Verfall der kaiserlichen Zentralmacht im Reich, besonders mit dem Ende der Staufer 1250 und des einsetzenden Interregnum, gekennzeichnet war. Zunehmend traten die französischen Könige als Offensiv- und Schiedsmacht auch im Reich auf, wo sie die unterschiedlichen Interessenslagen der Reichsfürsten für eigene Zwecke nutzten. Bezeichnend war dabei die Kandidatur König Philipps III. als erstem französischem König für die römische Königswürde 1273, wo er aber gegen Rudolf von Habsburg unterlag.
Philipps hartnäckig geführtes Engagement im flämischen-lothringischen Raum führte zwangsläufige zu Interessenskonflikten mit Fürsten und Königen des Heiligen Römischen Reiches. Im 1294 geschlossenen Bündnis des Grafen Guido I. von Flandern mit Eduard I. von England waren auch Reichsfürsten wie Graf Heinrich III. von Bar oder Herzog Johann II. von Brabant involviert, die im Grenzraum zu Frankreich beheimatet waren und ihre Position von dessen Macht gefährdet sahen. Auch der römische König Adolf von Nassau trat diesem Bündnis bei, doch wurde dieser während des Flandernkrieges durch französisches Gold, päpstlichen Druck und durch eine Allianz einiger Reichsfürsten gegen ihn neutralisiert. Zu König Albrecht I. waren die Beziehungen entspannter. Zwar gehörte dieser als Herzog von Österreich noch zu den Gegnern Frankreichs, doch war er als König an einem freundschaftlichen Einvernehmen mit Philipp interessiert. Bei einem persönlichen Treffen beider Herrscher im Dezember 1299 bei Vaucouleurs wurden erstmals sogar Gebietsabtretungen des Reiches an Frankreich vereinbart, die 1301 im Vertrag von Brügge auch besiegelt wurden. Die Grenze wurde an die Maas verschoben, wodurch vor allem der Graf von Bar in Vasallität zu Frankreich geriet, damit verbunden war auch die Übernahme der Oberhoheit über die Bischofsstädte Toul und Verdun durch Frankreich. Weitere Zugewinne konnte Philipp auch im alten burgundischen Regnum verzeichnen, wo die römisch-deutschen Herrscher kaum Präsenz zeigten und das Land dem Territorialadel überlassen hatten, König Albrecht I. erkannte bereitwillig die Abtretung der Franche-Comté an. Den Metropolitensitz Lyon annektierte Philipp 1307 nach einem schnellen militärischen Einsatz. Bereits sein Großvater hatte vom Erzbischof die Gerichtsbarkeit der Stadt übertragen bekommen, um ihn als Verbündeten gegen die Grafen von Forez zu gewinnen. Die andauernde Fehde zwischen Erzbischof und Graf nahm Philipp als Vorwand, um die Stadt zu besetzen und deren Zugehörigkeit zu Frankreich zu erklären.
Nach der Ermordung Albrechts 1308 unternahm Philipp erneut einen Versuch, das deutsche Königtum an Frankreich zu binden, indem er als Kandidaten seinen Bruder Karl von Valois vorschlug. Die bereits bestehende Abhängigkeit einiger Reichsfürsten und nicht zuletzt die des Papstes schienen ihm günstige Chancen für dieses Vorhaben zu geben. Dabei unterschätzte er die ablehnende Haltung der meisten Reichsfürsten gegen einen starken französischen König im Reich und den noch bestehenden Einfluss des Papstes auf den deutschen Klerus. Zusammen mit dem Erzbischof von Köln forcierte Papst Clemens V. erfolgreich die Wahl des Grafen von Luxemburg zum neuen König. Da dieser ebenfalls in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich stand, gab sich Philipp mit der Wahl zufrieden. Die Beziehungen zu König Heinrich VII. verschlechterten sich, als dieser nach der Annexion Lyons seine Kontakte zu Frankreich abbrach und verstärkt im lothringischen Raum Präsenz zeigte. Als Heinrich VII. nach Italien zog, um dort eine Restauratio imperii anzustreben, unternahm Philipp folglich alles, um dies zu verhindern, da Frankreich dort besonders wirtschaftlich von dem Zusammenbruch der kaiserlichen Macht nach dem Ende der Staufer profitiert hatte. In den anti-staufischen Guelfen um deren Haupt König Robert von Neapel besaß Frankreich in Italien einen natürlichen Verbündeten. Aber nachdem es den Guelfen nicht gelang, die durch den Papst veranlasste Kaiserkrönung Heinrichs zu verhindern, konnte erst dessen Tod 1313 während eines Feldzuges gegen Robert von Neapel den Einfluss Frankreichs in Italien wahren.
Familie
Ehe und Nachkommen
Am 16. August 1284 heiratete er Königin Johanna I. von Navarra (1273–1305), eine Tochter König Heinrichs I. des Dicken und der Blanche d'Artois. Er hatte mit ihr folgende Kinder:
- Ludwig X. der Zänker (Louis le Hutin; * 4. Oktober 1289 in Paris; † 5. Juni 1316 in Vincennes), König von Frankreich und Navarra
- Margarethe (Marguerite; * 1287; † 1294)
- Isabella (Isabeau; * 1292 in Paris; † 21. November 1358)
- ∞ 1308 mit König Eduard II. von England († 1327)
- Blanka (Blanche; * 1291; † nach 1294)
- Philipp V. der Lange (Philippe le Long; * 1293; † 3. Januar 1322 in der Abtei Longchamp bei Paris), König von Frankreich und Navarra
- Karl IV. der Schöne (Charles le Bel; * 18. Juni 1294 in Creil; † 1. Februar 1328 in Vincennes), König von Frankreich und Navarra
- Robert (* 1297; † August 1307 in Saint-Germain-en-Laye)
Philipp IV. war als Privatmann einem frommen Lebensstil verpflichtet, was sich im zunehmenden Alter in eine bigotte Strenge steigerte. Er ließ kurz vor seinem Tod seine drei Schwiegertöchter verhaften und einsperren, nachdem sie von seiner Tochter Isabella des Ehebruchs beschuldigt wurden. (siehe: Tour de Nesle)
Rezeption in Buch und Film
Der französische Schriftsteller Maurice Druon wurde von der Geschichte Philipps des Schönen und der seiner Familie zu einer siebenbändigen Romanreihe „Les Rois maudits“ (deutsch: Die unseligen Könige; 1955 bis 1977) inspiriert. Die ersten sechs Bände wurden 1972 von dem Sender France 2 unter demselben Titel in sechs Teilen verfilmt, mit Georges Marchal in der Rolle König Philipps des Schönen. 2005 folgte eine gleichnamige belgische TV-Produktion in fünf Episoden, die Rolle des Königs übernahm hier Tchéky Karyo.
Literatur
- Joachim Ehlers: Geschichte Frankreichs im Mittelalter. Stuttgart 1987 [überarb. Neuauflage, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-89678-668-5].
- Jean Favier: Un roi de marbre. Philippe le Bel, Engueran de Marigny. Fayard, Paris 2005, ISBN 2-213-62649-9.
- Jean Favier: Philippe le Bel. Paris 1978.
- Elisabeth Lalou: Philipp IV. der Schöne. In: Lexikon des Mittelalters Bd. 6, München/Zürich 1993, Sp. 2061-2063.
- Joseph R. Strayer: The Reign of Philip the Fair. University Press, Princeton/N.J. 1980, ISBN 0-691-05302-2.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Karl VII. (Frankreich)
Karl VII. der Siegreiche, frz. Charles VII, le Victorieux ‚der Siegreiche‘, le Bien Servi ‚der Wohlbediente‘ (* 22. Februar 1403 in Paris; † 22. Juli 1461 in Mehun-sur-Yèvre), war von 1422 bis 1461 König von Frankreich. Er beendete erfolgreich den Hundertjährigen Krieg und stellte Frankreichs Position als dominierende Großmacht in Europa wieder her. Außerdem begründete er die Epoche der Loire-Könige.
Leben
Karl VII. war der fünfte Sohn von Karl VI. von Frankreich und dessen Gemahlin Isabeau von Bayern. Zwei seiner vier älteren Brüder hießen ebenfalls Karl, starben aber vor seiner Geburt. Der zweite auf Karl getaufte Sohn war der erste Dauphin.
Er wurde nach dem Tod seiner älteren Brüder 1417 Dauphin und Regent, aber 1418 von den Bourguignons (der Partei der Herzöge von Burgund) aus Paris vertrieben und nahm in Bourges seine Residenz (siehe Bürgerkrieg der Armagnacs und Bourguignons). Dort stützte er sich besonders auf die Anhänger des Hauses Orléans und Armagnac. Als er jedoch auf Anstiften Du Châtels den Burgunderherzog Johann Ohnefurcht auf der Yonne-Brücke zu Montereau am 10. September 1419 hatte ermorden lassen, ging das Haus Burgund durch den Vertrag von Troyes eine Allianz mit England ein. Diese konnten ganz Nordfrankreich unter ihre Kontrolle bringen, auf deren Seite auch Karls eigene Mutter Isabeau trat. Sein englischer Gegenspieler, König Heinrich V., entthronte Karl durch das Pariser Parlement, trotz Widerspruchs zur Lex Salica (1421) und nach Heinrichs und Karls VI. Tod (1422) wurde dem erst einjährigen Sohn des englischen Königs der Erbanspruch auf den französischen Thron übertragen. Der Anspruch des kindlichen Heinrich VI. wurde jedoch weiterhin weder vom französischen Adel noch von der Kirche anerkannt.
Karl VII. galt als klug und tapfer (deswegen auch sein Beiname der Siegreiche), ritterlich und impulsiv, zuweilen aber auch als dünkelhaft und zaudernd. Dank seiner fähigen Berater wie Kanzler Guillaume Juvénal des Ursins, Bertrand und Ludwig von Jouvenel, Jacques Cœur, der Finanzier, und Agnès Sorel traf er dennoch erfolgreiche Entscheidungen (Beiname der „Wohlbediente“ im Sinne von „wohlberaten“).
1423 bei Cravant (Yonne) und 1424 in der Schlacht von Verneuil (Eure) vollständig geschlagen, wurde das Heer des „Dauphins“ Karl durch die verbündeten Engländer und Burgunder hinter die Loire getrieben, so dass man Karl spottweise den „König von Bourges“ nannte. Ohne Rücksicht auf die politische Lage verbrachte Karl zu Chinon seine Zeit mit üppigen Festen und zahlreichen Mätressen. Nur Orléans wurde von Dunois gehalten, und endlich verschaffte Jeanne d'Arc Karl den Sieg und ermöglichte 1429 die Krönung in Reims. Trotz des glücklichen Aufschwungs seiner Sache versank aber Karl sogleich wieder in Tatenlosigkeit. Ein Versuch gegen Paris endete mit dem Rückzug nach Chinon. Indes versöhnte sich 1435 Burgund mit Karl durch den für ihn sehr opfervollen Vertrag von Arras, während die Engländer durch den Tod Bedfords einen unersetzlichen Verlust erlitten. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Engländer unaufhaltsam zurückgedrängt, da Karl, durch seine Geliebte Agnès Sorel veranlasst, mehr Tätigkeit und Eifer entwickelte. Im April 1436 wurden die Engländer aus Paris und bis Oktober 1453, mit Ausnahme von Calais (bis 1558 englisch), gänzlich aus Frankreich vertrieben.
Inzwischen begründete Karl durch die Pragmatische Sanktion von Bourges im Jahr 1438 die Freiheit der gallikanischen Kirche. Vor allem ordnete er die Finanzen und die Rechtspflege und sorgte nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges für den inneren Frieden.
Nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges waren die Söldner ohne Verdienst und durchzogen als Räuberbanden das Land. Karl versuchte, diesem Unwesen Einhalt zu gebieten, indem er Teile dieser Söldner für ein stehendes Heer verpflichtete und andere in Konflikten im Heiligen Römischen Reich einsetzte. Armagnaken genannt, verbreiteten sie Furcht und Schrecken.
Außerdem beschnitt er durch Verordnungen die Vorrechte des Adels gegenüber den unteren Klassen, was einen offenen Aufstand, die so genannte Praguerie, hervorrief, dem sich auch der Dauphin Louis anschloss. Die wiederholten Empörungsversuche desselben und die Furcht vor einem Giftanschlag beherrschten die letzten Lebensjahre des Königs. Karl starb 1461 zu Mehun-sur-Yèvre in Berry.
Nachfahren
Im April 1422 vermählte er sich mit Maria von Anjou. Sie hatten folgende Kinder:
- Ludwig XI. (* 3. Juli 1423; † 30. August 1483), nachmaliger König von Frankreich
- Radegunde (* 1425; † 19. März 1445) – Siegmund von Habsburg-Tirol, dem Münzreichen versprochen, aber vor der Eheschließung verstorben
- Johann (*/† 1426)
- Katharina (* 1428; † 13. Juli 1446) ∞ Herzog Karl der Kühne von Burgund
- Jakob (* 1432; † 2. März 1438)
- Yolande (* 23. September 1434; † 28. August 1478) ∞ Herzog Amadeus IX. von Savoyen
- Johanna (* 1435/1440; † 4. Mai 1482) ∞ Herzog Jean II. de Bourbon
- Philipp (* 4. Februar 1436; † 2. Juli 1436)
- Marguerite (* Mai 1437; † 24. Juli 1438)
- Johanna (* 7. September 1438; † 26. Dezember 1446)
- Marie (* 7. September 1438; † 14. Februar 1439)
- Marie (*/† 1441)
- Magdalena (* 1. Dezember 1443; † 24. Januar 1495) ∞ Gaston von Foix (1444–1470), Mutter von König Franz von Navarra und Königin Katharina von Navarra
- Karl (* 28. Dezember 1446; † 12. Mai 1472), nachmalig Duc de Berry
Mit seiner langjährigen Geliebten Agnès Sorel hatte er 4 Kinder
- Charlotte de Valois (* 1434/1446; † 15. Juni 1477) ∞ Jacques de Brézé (Haus Brézé)
- Marie Marguerite (* 1436/1444; † 1473) ∞ Olivier de Coëtivy (Haus Coëtivy)
- Jeanne (* 1439/1448; † 1467)
- eine Tochter (* 1449/Februar 1450; † 3. Februar 1449/Februar 1450)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Karl der Kühne
Karl I. der Kühne (französisch: Charles Ier le Téméraire oder le Hardi, niederländisch: Karel de Stoute, englisch: Charles the Bold) (* 10. November 1433 in Dijon; † 5. Januar 1477 bei Nancy) war Herzog von Burgund und Luxemburg aus der burgundischen Seitenlinie des französischen Königshauses der Valois. Seine Eltern waren Philipp III. «der Gute» und Isabella von Portugal. Zu Lebzeiten seines Vaters trug er den Titel eines Grafen von Charolais. Er ist der berühmteste und letzte Herzog aus dem Haus Valois-Burgund.
Leben
Jugend und Weg zur Macht
Karl wurde in Dijon als Sohn von Philipp III. dem Guten, Herzog von Burgund aus einer Seitenlinie der französischen Königsfamilie der Valois, und Isabella von Portugal geboren. Zu Lebzeiten seines Vaters trug er den Titel eines Grafen von Charolais. Zwanzig Tage nach seiner Geburt wurde er bereits zum Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies geschlagen. Er wurde unter der Aufsicht des Herrn d'Auxy erzogen und soll große Hingabe zum Studium, aber auch zu Übungen im Kriegshandwerk gezeigt haben. Karl wuchs am Hof seines Vaters auf, der zu einem der glanzvollsten der Epoche gehörte und ein Zentrum für Kunst, Handel und Kultur war. Die Politik seines Vaters war über viele Jahre von dem Bemühen geprägt, einerseits seine zahlreichen Herrschaftsgebiete zu einem einheitlichen Staatsgebilde zu vereinen und nach damals modernsten Gesichtspunkten zu verwalten und andererseits sich von der Lehenshoheit des französischen Königs bzw. des deutschen Kaisers zu lösen. Um dies zu erreichen schreckte Philipp auch vor der Allianz mit England, dem Erzfeind Frankreichs, nicht zurück. Der daraus erwachsende kriegerische Konflikt zwischen Frankreich und Burgund endete erst 1435 mit dem Vertrag von Arras. Burgund erhielt einige zusätzliche Gebiete und wurde faktisch zu einem unabhängigen Staat; Philipps Sohn sollte eine französische Prinzessin ehelichen.
Gemäß dem Vertrag von Arras wurde Karl 1440 mit sieben Jahren mit Katharina von Valois, der zwölfjährigen Tochter des französischen Königs Karl VII. verheiratet. Katharina von Valois starb 1446 im Alter von 18 Jahren. Die Ehe blieb kinderlos. 1454 wollte Karl Margareta von York, die Tochter des Herzogs von York, heiraten. Sein Vater wählte jedoch seine Nichte Isabelle de Bourbon, die gleichzeitig auch die Cousine des Königs von Frankreich war, als Frau für ihn. Ihre Tochter Maria von Burgund war das einzige überlebende Kind Karls und Alleinerbin aller seiner Besitzungen.
Karl lernte den Dauphin und späteren französischen König Ludwig XI. kennen, als dieser als Flüchtling zwischen 1456 und 1461 am burgundischen Hof lebte, nachdem er sich mit seinem Vater entzweit hatte. Als Ludwig zum König aufstieg, wandte er sich jedoch gegen seinen ehemaligen Verbündeten und löste beispielsweise die Pfandschaft der Somme-Städte aus, die sein Vater im Vertrag von Arras Philipp dem Guten überlassen hatte. Die französischen Adelshäuser verbündeten sich daraufhin 1465 gegen den König in der «Liga des Öffentlichen Wohls» (Ligue du Bien public), an deren Spitze Karl von Berry und Karl der Kühne standen. Nach der unentschiedenen Schlacht bei Montlhéry musste Ludwig dem Adel erhebliche Zugeständnisse machen. Im Vertrag von Conflans erhielt Karl die Städte an der Somme zurück.
Während der Verhandlungen zwischen Ludwig und Karl starb Karls zweite Frau, Isabella von Bourbon. Verhandlungen über eine Ehe zwischen Karl und Anne de Beaujeu, der Tochter Ludwigs XI., blieben ergebnislos.
Am 12. April 1465 übergab Philipp der Gute alle Regierungsgeschäfte an Karl, der fortan versuchte, die Politik seines Vaters fortzuführen.
Revolten und erneuter Kampf mit Frankreich
Der Friede zwischen Karl und Ludwig XI. hatte nur für kurze Zeit Bestand.
Am 25. August 1466 nahm Karl Dinant ein, das er plünderte und niederbrannte. Zur selben Zeit verhandelte er erfolgreich mit Lüttich. Nach dem Tod seines Vaters am 15. Juni 1467 flammten die Feindseligkeiten mit den Bürgern von Lüttich jedoch wieder auf, die mit einem Sieg Karls bei Sint-Truiden endeten. Karl wurde Vogt des Fürstbistums Lüttich, dessen Besitzungen das heutige Belgien von Norden nach Süden durchzogen.
Durch diese frühen Erfolge des Herzogs von Burgund alarmiert und aus Angst, einige offene Punkte des Vertrages von Conflans erfüllen zu müssen, erbat Ludwig im Oktober 1468 ein Treffen mit Karl und begab sich bei Péronne in seine Hände. Im Zuge der Verhandlungen wurde Karl über eine erneute Revolte Lüttichs informiert, die Ludwig im Geheimen angezettelt hatte. Nach viertägigen Beratungen, wie er mit seinem Gegner umgehen sollte, der sich so ungeschickt in seine Hände begeben hatte, entschied Karl, mit Ludwig zu verhandeln, und erreichte, dass Ludwig ihn bei der Niederschlagung der Revolte in Lüttich unterstützte.
Nach Ablauf der einjährigen Waffenruhe, die dem Vertrag von Péronne folgte, klagte Ludwig XI. Karl des Verrats an, zitierte ihn vor das Parlement von Paris und nahm 1471 einige Städte an der Somme ein. Der Herzog antwortete mit dem Einmarsch einer großen Armee in Frankreich, nahm Nesle in Besitz und richtete ein Blutbad unter den Einwohnern an. Nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf Beauvais zog Karl mit seinen Truppen bis nach Rouen, wo er innehielt. Karl schloss nun ein Bündnis mit Eduard IV. von England zur Eroberung Frankreichs, während Ludwig Verhandlungen mit dem deutschen Kaiser, den Habsburgern und der Eidgenossenschaft führte, um Karl an der Ostgrenze zu beschäftigen.
Karl schlug das erneute Angebot Ludwigs XI. aus, seine Tochter Anne zur Ehefrau zu nehmen. Nach dem Tod seines Vaters nicht mehr an den Vertrag von Arras gebunden, ließ Karl Margareta von York nach Brügge bringen und heiratete sie dort in einer prunkvollen Zeremonie im Sommer 1468. Karl wurde bei diesem Anlass in den Hosenbandorden aufgenommen. Das Paar blieb kinderlos.
Innenpolitische Reformen
Karl führte an seinem Hof den überschwänglichen Luxus und die Prachtentfaltung seines Vaters fort. Beim Treffen in Trier mit dem Kaiser hat Karl nach Angaben seiner Rechnungskammer alleine für die Einkleidung seiner Höflinge die ungeheure Summe von 38'819 flandrischen Pfund ausgegeben.[1] Legendär waren auch die berühmten Tapisserien, die der Herzog zu jeder Gelegenheit anfertigen ließ. Aus der Burgunderbeute von Grandson sind einige dieser für die damalige Zeit sehr luxuriösen Wandteppiche erhalten.
Daneben richtete Karl seine Bemühungen in den Aufbau seiner militärischen und politischen Macht. Seit Beginn seiner Herrschaft war er mit der Reorganisation von Armee und Verwaltung seiner Ländereien beschäftigt. Er behielt die Prinzipien der feudalen Rekrutierung bei, errichtete aber ein System strenger Disziplin unter seinen Truppen, die er durch Söldner, besonders aus England und Italien, verstärkte. Außerdem entwickelte er seine Artillerie weiter.
Unter seiner Leitung fand eine weitgehende Zentralisierung der Verwaltung der burgundischen Herrschaftsgebiete in den heutigen Niederlanden und Belgien statt. Die zwei Rechnungskammern von Lille und Brüssel (die Rechnungskammer Den Haag war schon 1463 in derjenigen von Brüssel aufgegangen) wurden aufgelöst und in einer neu gegründeten Rechnungskammer in Mecheln zentralisiert. In derselben Stadt gründete Karl auch ein Parlement, das für die burgundischen Gebiete im Norden zuständig war. Dazu bestanden weiterhin die Parlemente von Beaune, St. Laurent-lès-Chalon und Dole, die für das Herzogtum Burgund, den im Reich gelegenen Teil des Herzogtums und die Pfalzgrafschaft Burgund zuständig waren. Die Neugründung von Mecheln wurde unter anderem auch dadurch nötig, dass durch den Vertrag von Péronne 1468 die Zuständigkeit des Parlements von Paris für die burgundischen Länder aufgehoben worden war.
Karl beschäftigte sich ausgiebig mit militärischen Angelegenheiten. Nach zeitgenössischen Berichten verging kaum ein Tag, an dem er nicht eine oder zwei Stunden mit dem Aufschreiben und der Konzeption seiner Verordnungen verbrachte. Jedes Jahr ließ er seinen Offizieren Heeresordnungen (Ordonnanzen) verteilen, mit rigorosen Anweisungen betreffend Organisation, Disziplin, Umgangsformen und Vorgehensweise.
Ab 1471, als sich Karl nach dem Vertrag von Péronne erneut im Krieg mit Ludwig XI. befand, stand sein Bemühen, ein stets kampfbereites Heer, das überwiegend aus Söldnern bestand, zu schaffen. Er stellte Ordonnanzkompanien auf, wobei er Adlige seines Hofes mit der Ordonnanz vom 19. April 1472 als Kompanieführer (frz. dizainiers – hier: Zehner(führer) = Führer von 10 Einheiten), denen eine Einheit von 10 Lanzen (ca. 70–90 Kämpfer) unterstand, zum Dienst im Heer abkommandierte. Auch der Rest seines Hofes wurde zunehmend militarisiert und in der Hofordnung von 1474 erscheint der Hof schließlich als eine Art Armee, in der jedes Amt zugleich eine feste militärische Einheit bildet.[2]
Vergrößerung der Macht
1469 verpfändete ihm Sigismund, Erzherzog von Österreich, die Grafschaft Pfirt, die Landvogtei Oberelsass und den Breisgau, behielt sich aber das Recht zur späteren Auslösung des Pfands vor. Karl sollte Sigismund auch bei seinem Kampf gegen die Eidgenossen behilflich sein. (→Schweizer Habsburgerkriege)
Zwischen 1472 und 1473 konnte sich Karl die Nachfolge im Herzogtum Geldern erkaufen, weil er den geldrischen Herzog Arnold gegen die Rebellion seines Sohnes unterstützt hatte. Noch nicht mit dem Titel «Großherzog des Westens» zufrieden, ergriff er das Projekt, ein unabhängiges Königreich Burgund zu errichten. Während seine Gebiete, die im Königreich Frankreich lagen, bereits durch die Verträge von 1468 bzw. 1471 von der Lehenshoheit Frankreichs gelöst waren, unterstanden seine östlichen Gebiete immer noch dem Heiligen Römischen Reich.
Unter dem Vorwand, eine burgundische Beteiligung an einem Kreuzzug gegen die Türken ins Auge zu fassen, traf er sich deshalb am 30. September 1473 mit Kaiser Friedrich III. in Trier. Hauptgegenstand des Treffens waren die Verhandlungen um eine Eheschließung zwischen Karls einzigem Kind Maria und dem Sohn des Kaisers, Maximilian. Karl forderte im Austausch für sich die Königskrone. Karl erschien in Trier in einer goldenen Rüstung mit einer Leibgarde von 250 Mann und einer Armee von über 6000 Mann in Begleitung einiger Reichsfürsten aus seinem Einflussbereich. Der Kaiser und sein Sohn hatten zwar noch ein größeres Gefolge, entfalteten aber weit weniger Prunk. In Trier waren auch die Kurstimmen von Mainz, Trier und Brandenburg vertreten. Während der Verhandlungen fanden zum Teil aufwendige Bankette, Empfänge und Turnierspiele statt. Am 4. November fanden die beiden Parteien einen Kompromiss: Karl verzichtete zwar auf die Krönung zum Römischen König, was ihn zum Nachfolger des Kaisers gemacht hätte, sollte aber eine neu zu schaffende Königskrone von Burgund bzw. Friesland erhalten. Die Kurfürsten verweigerten diesem Handel jedoch ihre Zustimmung. Nachdem Karl mit dem Herzogtum Geldern belehnt worden war, fand die für den 18. und dann für den 21. November angekündigte Königskrönung nicht statt, und der Kaiser reiste am 25. November überstürzt aus Trier ab. Warum genau die Verhandlungen scheiterten, ist unklar. Entscheidend scheint aber die Rolle der Kurfürsten gewesen zu sein. Karl bestand auf ihrer Zustimmung zu seiner Krönung, während der Kaiser der Meinung war, diese Entscheidung stehe ihm alleine zu. Weiter befremdeten sich die Kurfürsten und die Umgebung des Kaisers über den Luxus, den Karl zur Schau stellte, auch dass er z. B. einen Hermelinkragen trug, der in der Länge denjenigen der Kurfürsten übertraf.[3]
Untergang
Im darauffolgenden Jahr verstrickte sich Karl in eine Reihe von Schwierigkeiten und Kämpfen, z.B. die erfolglose Belagerung von Neuss, die am Ende zu seinem Untergang führen sollten. Nicht zuletzt waren auch die Intrigen und Ränke des französischen Königs Ludwig XI. für das Scheitern Karls ausschlaggebend. Karl überwarf sich mit Sigismund von Österreich, dem er seine Besitzungen im Elsass für die vereinbarte Summe nicht zurückgeben wollte, mit der Eidgenossenschaft, welche die Reichsstädte im Elsass bei ihrem Aufruhr gegen die Tyrannei des burgundischen Gouverneurs Peter von Hagenbach unterstützte und letztendlich auch mit René von Lothringen, dem er die Erbfolge Lothringens strittig machte, das die beiden Hauptteile von Karls Ländereien, die Grafschaft Flandern und das Herzogtum von Burgund, trennte.
Alle diese Gegner, aufgestachelt und unterstützt von Ludwig, brauchten nicht lange, um sich gegen ihren gemeinsamen Feind zu verbünden. Karl erlitt eine erste Niederlage, als er versuchte, Ruprecht von der Pfalz, Erzbischof von Köln, in der Kölner Stiftsfehde zu unterstützen. In diesem Zusammenhang belagerte er die Stadt Neuss von Juli 1474 bis Juni 1475 zehn Monate lang, wurde aber durch die Ankunft der Armee Kaiser Friedrichs III. dazu gezwungen, die Belagerung aufzuheben und abzuziehen. Zusätzlich wurde die Expedition seines Schwagers Eduard IV. von England gegen Ludwig durch den Vertrag von Picquigny am 29. August 1475 gestoppt. Karl schloss deshalb am 17. November 1475 Frieden mit Kaiser Friedrich III. und wandte sich gegen das Herzogtum Lothringen, wo er erfolgreich die Hauptstadt Nancy nach einer Belagerung einnehmen konnte.
Zu seinem Ende führte schließlich jedoch der Krieg mit der Niederen Vereinigung, die aus den elsässischen Reichsstädten, dem Bistum Basel, Herzog Sigismund von Österreich und der Eidgenossenschaft bestand. Eine erste Niederlage gegen die aufstrebende Militärmacht der Eidgenossen erlitt ein burgundisches Heer am 13. November 1474 bei Héricourt. Damit wurde die in der Schweiz als Burgunderkriege bekannte Reihe von Schlachten eröffnet, die zum Untergang Karls führten. Karl marschierte von Nancy her gegen die Eidgenossenschaft ins Waadtland, wo er sich mit verbündeten Adligen aus dem Herzogtum Savoyen vereinigte. Bei Grandson traf er zum ersten Mal auf eidgenössische Truppen, die er nach der Belagerung der Festung trotz ihrer Kapitulation erhängen und ertränken ließ. Am 2. März 1476 wurde er vor Grandson von einer eidgenössischen Armee angegriffen, wobei er eine schwere Niederlage erlitt. Er konnte mit einer Handvoll Gefolgsleuten fliehen, seine Artillerie und die riesige Beute fielen jedoch den Eidgenossen als «Burgunderbeute» in die Hände.
Karl flüchtete nach Lausanne, wo er mit dem verbündeten Savoyen eine neue Armee von 20.000 Mann aufstellte, um erneut gegen die eidgenössische Reichsstadt Bern zu ziehen, die das Haupt der anti-burgundischen Koalition in der Eidgenossenschaft war. Am 6. Mai 1476 bestätigte er in Lausanne auch die Eheabsprache zwischen seiner Tochter Maria und Erzherzog Maximilian von Österreich, die Eheschließung wurde jedoch vorläufig noch nicht vollzogen, weil der vorgesehene Hochzeitstermin vom 11. November platzte. Anfang Juni zog Karl mit seinem Heer gegen Bern und belagerte ab dem 9. Juni Murten, wo er am 22. Juni von einem Heer der Eidgenossenschaft und des Herzogs René von Lothringen angegriffen wurde. Sein technisch überlegenes Heer wurde ähnlich wie in Grandson überrascht und durch die Wucht der eidgenössischen Infanterie in der Schlacht bei Murten vernichtend geschlagen. Die Herzogin von Savoyen sah sich zum Friedensschluss mit der Eidgenossenschaft genötigt, die burgundischen Besitzungen in der Waadt waren verloren.
Karl kehrte nach Burgund zurück und wandte sich im Herbst gegen Lothringen, das sich im offenen Aufstand gegen die burgundische Besatzung befand. Herzog René versicherte sich der eidgenössischen Unterstützung und setzte zur Rückeroberung seines Herzogtums an. Karl brach am 25. September von Gex aus mit einem Heer, für das eine Stärke von unter 10.000 bis maximal 15.000 Mann angegeben wird, in Richtung Lothringen auf, wo René die Hauptstadt Nancy belagerte. Wenige Tage bevor Karl in Lothringen eintraf, fiel Nancy in die Hände der Lothringer. Obwohl der Winter bevorstand und gegen den Ratschlag seiner Offiziere, legte Karl am 22. Oktober um Nancy einen Belagerungsring. Mitten im Winter, am 5. Januar 1477, kam es vor den Toren der Stadt zur Schlacht bei Nancy, als Herzog René verstärkt durch Zuzug aus der Eidgenossenschaft Karl zum Kampf stellte. Das eidgenössisch-lothringische Heer war mit 15.000 bis 20.000 Mann dem durch die Belagerung schon geschwächten Heer Karls zahlenmäßig klar überlegen, doch stellte sich der Burgunderherzog trotz des ungünstigen Kräfteverhältnisses zur Schlacht, die in einer katastrophalen Niederlage für die Burgunder endete.
Karl der Kühne starb in dieser Schlacht, sein gefrorener, durch mehrere Wunden stark entstellter und durch Ausplünderung nahezu nackter Leichnam, der zudem von Wölfen angefressen worden war, wurde zwei Tage später nahe eines Weihers gefunden.[4] Einer von Karls Dienern identifizierte den Leichnam schließlich anhand einiger Narben und anderer Körpermerkmale als den des Burgunderherzogs. Karls siegreiche Feinde erbeuteten u. a. seinen an Ludwig XI. gesandten Helm, seinen 1478 dem Herzog von Mailand geschenkten Ring, seinen als Siegeszeichen am Straßburger Münster aufgehängten Waffenrock und seine nach Mailand verkaufte Ordenskette mit dem Goldenen Vlies.[5] Herzog René ließ Karls Leichnam zunächst wie eine Trophäe aufbahren und ihn anschließend in seiner Hofkirche St. Georges in Nancy bestatten. Zwei Schrifttafeln setzten eine antiburgundische Note. Karl V., der Urenkel Karls des Kühnen, veranlasste schließlich die Überführung der sterblichen Überreste des letzten Burgunderherzogs in die Liebfrauenkirche in Brügge, wo sie sich in einem standesgemäßen und sehr aufwändig gestalteten Grabmal heute noch befinden.
Kampf um das Erbe Karls des Kühnen
Nach dem Tod Karls blieb Maria im Alter von 19 Jahren als einzige Erbin zurück. Margareta von York, die Witwe Karls, führte als Beschützerin Marias Heiratsverhandlungen mit dem französischen König und dem römisch-deutschen Kaiser. Die ältesten Söhne beider Herrscher waren zu diesem Zeitpunkt noch unverheiratet und Maria stellte mit ihrem riesigen Erbe die beste Partie Europas dar. Die Ehe zwischen Erzherzog Maximilian von Österreich und Maria war zwar seit dem 6. Mai 1476 abgesprochen, aber beim Tod Karls noch nicht vollzogen. König Ludwig XI. von Frankreich verschlechterte seine Verhandlungslage drastisch, als er kurz nach dem Tod Karls die an Frankreich angrenzenden Teile des Herrschaftsgebiets Karls besetze. Das Herzogtum Burgund, die Freigrafschaft Burgund, die Picardie, Ponthieu und Boulogne fielen so wieder unter die Kontrolle der französischen Krone. In diesem günstigen Moment brachte Kaiser Friedrich die Verhandlungen mit Hilfe der Ludwig feindlich gesinnten Margareta von York zum Abschluss, so dass die Verheiratung in Stellvertretung am 21. April abgeschlossen werden konnte. Am 19. August 1477 heirateten Maximilian und Maria in Gent. Auf diese Weise konnte Maximilian nach dem Tod seines Vaters die Erbschaft Karls mit der Hausmacht der Habsburger vereinen und wurde damit zum mächtigsten Fürsten im damaligen Europa. Die burgundische Erbschaft war einer der entscheidenden Schritte beim Aufstieg des Hauses Habsburg zur Weltmacht.
Sofort nach der Heirat zwischen Maximilian und Maria kam es zum Krieg zwischen Maximilian und Ludwig XI. um das Erbe Karls. Sie schlossen zwar im September 1477 einen vorläufigen Waffenstillstand, 1478 begann der Krieg jedoch wieder, als das Parlement von Paris die französischen Lehen Karls für erledigt erklärte. Maximilian konnte von den von Ludwig beanspruchten Teilen des Erbes seiner Frau nach seinem Sieg in der Schlacht bei Guinegate 1479 Flandern und Artois zurückgewinnen. Nach dem frühen Tod Marias am 27. März 1482 und einem Aufstand in Gent musste Maximilian 1482 mit Ludwig den Frieden von Arras abschließen. Das Herzogtum Burgund, die Freigrafschaft Burgund, Artois, die Picardie, Ponthieu, Boulogne, Vermandois und Mâcon fielen an Frankreich. Maximilian behielt Flandern und die übrigen Besitzungen Karls im heutigen Belgien und den Niederlanden. Später erhielt Maximilian im Frieden von Senlis 1493 auch die Freigrafschaft und Artois zurück. Die Grafschaft Charolais blieb zwar im Besitz Maximilians bzw. seines unmündigen Sohnes Philipp, dem eigentlichen Erben Marias, unterstand jedoch der französischen Lehenshoheit.
Das burgundische Erbe wurde von Maximilian und seinen Nachkommen hoch gehalten. Seine Kinder mit Maria wuchsen im flandrischen Gent auf und sein Sohn Philipp der Schöne trug seinen Namen in Anlehnung an Philipp den Guten. Dessen Sohn wurde in Erinnerung an den letzten Burgunderherzog mit dem Namen Karl getauft und stieg als Kaiser Karl V. zu einem der mächtigsten Herrscher der damaligen Welt auf. Mit Philipp und Karl kam das burgundische Erbe an die spanische Linie der Habsburger, die bis ins 18. Jahrhundert die Gebiete schrittweise an Frankreich und die unabhängig gewordenen Niederlande verloren.
Familiäres
Ehefrauen und Nachkommen
Karl heiratete drei Mal und hatte ein Kind:
In erster Ehe am 19. Mai 1440 in Blois Katharina von Valois (* 1428; † 30. Juli 1446), Tochter von König Karl VII. von Frankreich und Maria von Anjou. Aus dieser Ehe gingen keine Nachkommen hervor.
In zweiter Ehe am 30. Oktober 1454 in Lille Isabelle de Bourbon (* 1437; † 25. September 1465 in Antwerpen), Tochter von Karl I., Herzog von Bourbon und Agnes von Burgund. Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor:
- Maria von Burgund (* 13. Februar 1457 in Brüssel; † 27. März 1482 in Brügge) ∞ (1477) Maximilian I., Sohn von Friedrich III., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und sein Nachfolger.
In dritter Ehe am 3. Juli 1468 in Damme Margaret of York (* 3. Mai 1446 in Fotheringhay Castle; † 23. November 1503 in Mechelen), Tochter von Richard Plantagenet, 3. Duke of York, und Schwester von König Eduard IV. von England. Aus dieser Ehe gingen keine Nachkommen hervor.
Karl der Kühne in der Beurteilung der Nachwelt
Karl der Kühne wurde oft als der letzte Repräsentant des feudalen Geistes angesehen, ein Mann, der keine anderen Fähigkeiten als seine blinde Tapferkeit besaß. Oft wurde er im Gegensatz zu seinem Gegner Ludwig XI. gestellt, der für die moderne Politik stand. In Wahrheit besaß er große Fähigkeiten und Kultur, eine strenge Moral und war verschiedener Sprachen mächtig. Obwohl er nicht von gelegentlicher Härte freigesprochen werden kann, besaß er das Geheimnis, die Herzen seiner Untertanen zu gewinnen, die ihm auch in schwierigen Zeiten niemals die Unterstützung verwehrten. Da er nur seine Tochter Maria hinterließ, erbten die Habsburger den Länderkomplex seines Hauses und erweiterten sich zum Haus Österreich und Burgund, was einen wesentlichen Grundstein für ihre spätere Weltgeltung ausmachte. Karl V. war zeitlebens stolz, von ihm abzustammen.[6]
In der schweizerischen Geschichtsschreibung wird für die drei Schlachten der Burgunderkriege oft auf den zeitgenössischen Spruch Karl der Kühne «verlor in Grandson den Hut, in Murten den Mut und in Nancy das Blut» verwendet. Anstelle von '«den Hut»', welchen er angeblich wirklich verloren haben soll [1], existiert auch eine geläufigere Version, in der nur allgemein von «das Gut» gesprochen wird. Tatsächlich wurde nach der Schlacht bei Grandson von der Stadt Basel ein Herzogshut aus goldenem Samt, bestickt mit Perlen und Edelsteinen, aus dem Besitz Karls für 47.000 Gulden zusammen mit zwei weiteren Schmuckstücken an Jakob Fugger verkauft.[7]
Porträts
Alle identifizierten Einzelporträts Karls als Erwachsener gehen auf das Porträt zurück, das sich heute in Berlin in den Staatlichen Museen befindet (Gemäldegalerie, Kat. Nr. 545). Das Bild entstand um 1460 und zeigt Karl noch als Grafen von Charolais. Es wird heute allgemein Rogier van den Weyden zugeschrieben, während man es längere Zeit entweder für eine Werkstattkopie oder für eine eigenhändigen Replik hielt. Es scheint das einzige, von Karl akzeptierte, offizielle Staatsporträt gewesen zu sein und entspricht der Beschreibung Karls durch Georges Chastellain. Das Bild befand sich später im Besitz seiner Enkelin, Margarete von Österreich in Schloss Mecheln. Es gelangte 1821 mit der Sammlung Solly nach Berlin.[8]
Wappen
Das Wappen Karls war mit demjenigen seines Vaters identisch. Es enthielt das Wappen der burgundischen Seitenlinie des Hauses Valois als Grafen von Tours (goldene Lilien auf blauem Grund, eingefasst durch rot-weiß gestreiftes Band) sowie die Wappen der Herzogtümer Burgund (goldene diagonale Streifen auf blauem Grund, eingefasst von rotem Band), Limburg (roter Löwe auf silbernem Grund) und Brabant (goldener Löwe auf schwarzem Grund). In der Mitte war das Wappen der Grafschaft Flandern platziert – durch seine Urgroßmutter Margarete von Flandern kamen die Grafschaften Flandern, Artois, Rethel und Nevers und die Pfalzgrafschaft Burgund an das Haus Burgund. Die Devise Karls des Kühnen war der Spruch «Je lay emprins» – «ich habe es gewagt». Auf heraldischen Darstellungen ist auch der heilige Georg zu sehen, den Karl neben dem heiligen Andreas als Patron von Burgund für sich als persönlichen Patron annahm.
Titel
- 1433–5. Januar 1477: Graf von Charolais als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Herzog von Burgund als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Graf von Artois als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Pfalzgraf von Burgund als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Graf von Flandern als Karl II.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Markgraf von Namur als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Herzog von Brabant und Herzog von Lothier (Niederlothringen) als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Herzog von Limburg als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Graf von Hennegau als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Graf von Holland und Friesland als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Graf von Seeland als Karl I.
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477 Graf von Auxerre
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477 Graf von Mâcon
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477 Graf von Boulogne
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477 Graf von Ponthieu
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477 Graf von Vermandois
- 15. Juni 1467–5. Januar 1477: Herzog von Luxemburg als Karl II.
- 23. Februar 1473–5. Januar 1477: Herzog von Geldern als Karl I.
- 1477: Graf von Eu
Literatur
Sachbücher:
- Karl der Kühne (1433–1477): Kunst, Krieg und Hofkultur / hrsg. von Susan Marti [et al.]. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 2008. (NZZ Libro). Publikation zur Ausstellung vom 25. April bis 24. August 2008 im Historischen Museum in Bern. ISBN 978-3-03823-413-5
- Thea Leitner: Habsburgs goldene Bräute. Durch Mitgift zur Macht. Piper, München 2005, ISBN 3-492-23525-5.
- Hans-Joachim Lope: Karl der Kühne als literarische Gestalt. Ein themengeschichtlicher Versuch mit besonderer Berücksichtigung der französischsprachigen Literatur Belgiens. Lang, Frankfurt/M. 1995, ISBN 3-631-40334-8.
- Susan Marti u.a. (Hrsg.): Karl der Kühne (1433–1477). Kunst, Krieg und Hofkultur. Belser, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-7630-2513-8 (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung).
- Klaus Schelle: Karl der Kühne. Der letzte Burgunderherzog. Heyne, München 1982, ISBN 3-453-55097-8
- Werner Paravicini: Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund. Frankfurt 1976.ISBN 3-7881-0094-X
Belletristik:
- Werner Bergengruen: Karl der Kühne. Roman. Verlag die Arche, Zürich 1976, ISBN 3-7160-1067-7.
- Heinrich Keller: Karl der Kühne, Herzog von Burgund. Ein vaterländisches Schauspiel in 5 Aufzügen. Orell & Füssli, Zürich 1813.
- Melchior Meyr: Karl der Kühne. Historische Tragödie. Kröner, Stuttgart 1862.
- Giovanni Pacini: Carlo di Borgogna. Oper in 3 Akten. Libretto von Gaetano Rossi, Venedig 1835
Einzelnachweise
- ↑ Marti, Karl der Kühne, S. 270.
- ↑ Marti, Karl der Kühne, S. 220.
- ↑ Marti, Karl der Kühne, S. 264f. und 270.
- ↑ von Rodt, E.: Die Feldzüge Karls des Kühnen und seiner Erben. Hurter, Schaffhausen 1843, S. 412. – Anderen Darstellungen zufolge soll der Leichnam des Herzogs aus dem Schlamm dieses Weihers geborgen bzw. auf seiner zugefrorenen Oberfläche gefunden worden sein.
- ↑ Joseph Calmette: Die großen Herzöge von Burgund. Paris 1949, dt. München 1996, S. 342f.
- ↑ Dieser Text stammt ursprünglich aus der Encyclopedia Britannica von 1911, aus der englischen Wikipedia übersetzt.
- ↑ Marti, Karl der Kühne, S. 277.
- ↑ Dirk De Vos: Rogier van der Weyden. Gesamtwerk. Hirmer Verlag, München 1999, S. 308–310.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Richard Neville, 16. Earl of Warwick
Richard Neville, 16. Earl of Warwick (* 1428; † 14. April 1471), war ein englischer Adliger. Er war unter seinen Zeitgenossen auch als „Warwick der Königsmacher“ bekannt. Als reichster Mann Englands außerhalb der königlichen Familie nutzte er seinen Reichtum und seine Macht dazu, den aus dem Haus Lancaster stammenden König Heinrich VI. abzusetzen und den zum Haus York gehörenden Eduard IV. einzusetzen und dann später, nach einem Zerwürfnis mit König Eduard, nochmals Heinrich VI. wieder zurück auf den Thron zu bringen.
Neville war der älteste Sohn von Richard Neville, 5. Earl of Salisbury und Alice Montagu, Countess of Salisbury. Sein jüngerer Bruder war John Neville, 1. Marquess of Montagu, und kurze Zeit auch Earl of Northumberland. Neville heiratete Anne de Beauchamp, die Schwester von Henry de Beauchamp, 1. Duke of Warwick. Als dieser starb, verfiel zwar der Titel eines Duke of Warwick, der Titel des Earls wurde an seine Tochter Anne Beauchamp, 15. Countess of Warwick, die noch ein 2-jähriges Kind war, übertragen. Lady Warwick starb mit fünf Jahren, und Richard Neville erhielt den Titel durch seine Frau (die denselben Namen wie ihre Nichte, die verstorbene Countess trug). So konnte er zwei große Grafschaften mit Anwesen in den englischen Midlands und in der walisischen Mark unter seine Kontrolle bringen.
Als angeheirateter Neffe von Richard Plantagenet, 3. Duke of York spielte Neville eine Schlüsselrolle in den Rosenkriegen. Er benutzte seinen Einfluss und seine Bekanntheit, um den Einfluss des Herzogs von York unter Heinrich VI. zu steigern, obwohl er dessen Unterstützung zeitweise aussetzte, als er 1460 vor dem Parlament den Thron für sich beanspruchte. Neville wurde nach dem Tod seines Vaters in der Schlacht von Wakefield im Jahr 1460 der größte und einflussreichste Landbesitzer in England. Durch die Unterstützung seines Militärs, insbesondere bei der Schlacht von Towton, die mit einem überwältigenden Sieg der Yorkisten endete, setzte er Eduard IV. auf den Thron. Die beiden hatten eine sehr enge Beziehung während der ersten Regierungsjahre Edwards, als Neville für ihn die Lancastrischen Rebellionen in den nördlichen Grafschaften niederschlug. Neville übte ab 1460 das Amt des Lord Warden of the Cinque Ports aus.
In den späten 1460er Jahren trennten sich die beiden. Der Zusammenbruch ihrer Beziehung hatte verschiedene Gründe, aber hauptsächlich lag es an der heimlichen Heirat Eduards mit Elizabeth Woodville im Jahr 1464, während Neville gerade eine französische Heiratsoption für seinen König verhandelte. Zu dieser Beleidigung gesellte sich bald Verbitterung über die Bevorzugung der Woodvilles am Hofe. Auch andere Faktoren trugen zu Nevilles Ärger bei, wie Edwards Sympathien für eine Allianz mit Burgund, während Warwick Frankreich bevorzugte, und Edwards Widerstreben, seinen Brüdern George Plantagenet, 1. Duke of Clarence, und Richard, Duke of Gloucester die Hochzeit mit Warwicks Töchtern Isabella und Anne zu erlauben.
1469 hatte Warwick eine Allianz mit Eduards eifersüchtigem Bruder George geschlossen, mit dem er seine älteste Tochter Isabella im gleichen Jahr verheiratete. Sie schlugen Eduards Truppen in der Schlacht von Edgecote Moor, nahmen den König gefangen und regierten einige Monate in seinem Namen. Allerdings blieb neben einer großen Anzahl englischer Adliger auch Warwicks Bruder John Neville dem König loyal. Eduard IV. wurde bald durch eine von seinem jüngsten Bruder Richard geführten Armee befreit. Warwick wurde 1470 als Verräter angeklagt und war gezwungen, nach Frankreich zu fliehen, wo er eine Allianz mit seiner alten Feindin Margarete von Anjou, Ehefrau Heinrichs VI., schloss. Als Ergebnis verheiratete er seine jüngere Tochter Anne mit Margaretes Sohn, Edward, dem Prinzen von Wales.
Margarete misstraute Nevilles Absichten und bestand darauf, dass er seine Ehrlichkeit unter Beweis stelle, indem er mit einer Armee nach England zurückkehre. Noch 1470 führte Neville ein neu aufgestelltes Heer auf die Insel und fand diesmal auch Unterstützung durch seinen Bruder John von Norden her. Eduard IV. musste fliehen, während Neville Heinrich VI. am 30. Oktober wieder auf den Thron brachte.
Warwick plante nun, seine Allianz mit Ludwig XI. von Frankreich zu festigen, indem er Frankreich half, in Burgund einzufallen, wofür Ludwig ihm als Belohnung die bis dato burgundischen Ländereien Zeeland und Holland versprach. Diese Neuigkeiten erreichten Karl den Kühnen, den Herzog von Burgund, der Eduard wiederum mit einer Armee bei dessen Rückkehr nach England im Jahr 1471 Waffenhilfe leistete. Neville erhielt Unterstützung durch Margarete, die mit ihrem Sohn ebenfalls nach England übersetzte. Neville wurde zusammen mit seinem Bruder John geschlagen und in der Schlacht von Barnet im Jahr 1471 getötet. Seine Tochter Isabella blieb mit dem Herzog von Clarence verheiratet. Anne, deren Ehemann, der Prinz von Wales, später in der Schlacht von Tewkesbury getötet wurde, heiratete später Richard, Duke of Gloucester, den späteren Richard III. von England.
Als Earl of Salisbury folgte George Plantagenet, den Titel Earl of Warwick übernahm Edward Plantagenet.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Paul Beneke
Paul Beneke (* Anfang des 15. Jh., † um 1480) war ein deutscher Hanseadmiral und Ratsherr aus Danzig.
Leben
Im Krieg der Hanse gegen England besiegte Beneke die englische Flotte in der Seeschlacht von Zween 1468. In den nachfolgenden Jahren kaperte er zahlreiche englische Schiffe u.a. mit der „Peter von Danzig“. 1474 bat England um Frieden, der daraufhin am 28. Februar 1474 geschlossene Friede von Utrecht gab der Hanse wieder alle Handelsprivilegien zurück.
Als Folge dieses Sieges empfing auch der französische König Ludwig XI. die Danziger Kapitäne Jakob Voß und Nikolaus Veddric an seinem Hofe zu Mont Saint Michel und verbürgte der Hanse auf zehn Jahre Frieden und Handelsvergünstigungen.
Zu den berühmtesten Kaperzügen Benekes gehört der Überfall auf das unter burgundischer Flagge segelnde Handelsschiff "Thomas Portinari" (in einigen Quellen auch "St. Thomas" genannt). An Bord befand sich ein Triptychon zum Jüngsten Gericht, das der flämische Künstler Hans Memling im Auftrag eines italienischen Kaufmanns für eine Medici-Kirche in Florenz gemalt hatte. Beneke schaffte das Bild nach Danzig. Später wurde es - florentinischen Protesten zum Trotz - von Bürgermeister Reinhold Niederhoff der Marienkirche vermacht. Dort hängt heute eine Kopie, das Original befindet sich im Danziger Nationalmuseum.
Literatur
- Karl Koppmann: Beneke, Paul. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 329 f.
- Kapitel 3: Paul Beneke, in: Wilhelm Wolfslast: Helden der See. Band 1. Entdecker und Admirale, Berlin 1944, S. 40-54.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Albrecht III. (Mecklenburg)
(Weitergeleitet von Albrecht von Mecklenburg)
Albrecht III., Herzog zu Mecklenburg, in der Literatur häufig ungenau als Albrecht von Mecklenburg (* um 1338; † 1. März 1412) war von 1364 bis 1389 schwedischer König und von 1384 bis zu seinem Tod (regierender) Herzog zu Mecklenburg.
Leben
Albrecht war der zweite Sohn von Herzog Albrecht II. zu Mecklenburg und dessen Frau Eufemia, die eine Schwester des schwedischen Königs Magnus Eriksson war. Albrecht stand nach dem amtierenden König Magnus II. und dessen Sohn Håkon an dritter Stelle der Thronfolge.
Im Jahr 1363 kam der schwedische Reichsrat unter Leitung von Bo Jonsson Grip an den Hof von Mecklenburg. Sie hatten sich gegen König Magnus erhoben und wollten ihn als Machthaber absetzen. Für die Aufgabe ihrer Treue und Untergebenheit wurden sie des Landes verwiesen. Aufgrund der Ermunterung durch den Reichsrat fiel Albrecht mit Unterstützung seines Vaters, der mecklenburgischen Hansestädte und einiger norddeutscher Fürsten im selben Jahr in Schweden ein. Mit Stockholm und Kalmar ergaben sich langjährige deutsche Handelsstützpunkte kampflos, noch im Februar 1364 erhielt Albrecht in Stockholm den Königstitel, während er in Värmland, Dalarna und einigen Teilen Västergötlands nicht anerkannt wurde. Die Huldigung erfolgte am Stein von Mora.
Es schloss sich ein achtjähriger Bürgerkrieg an. In der Nähe von Enköping wurden Magnus und Håkon 1365 in der Schlacht bei Gata durch deutsche Kämpfer besiegt und Magnus gefangengenommen, woraufhin Håkon vom dänischen König Waldemar Atterdag Unterstützung erhielt. Magnus kam erst 1371 wieder frei. Zusätzlich sank Albrechts Ansehen im schwedischen Volk, vor allem weil er große Teile des schwedischen Landes an deutsche Gefolgsleute verpfändete. Mit bäuerlicher Unterstützung stand Håkon bald mit seinem Heer in Norrmalm bei Stockholm (heute Stockholmer Stadtgebiet), woraufhin der Reichsrat 1371 im Wege trilateraler Verhandlungen durchsetzte, dass Albrecht zwar seine Krone behalten durfte, die faktische Macht aber in seine, des Rates, Hände und damit in die seines mächtigsten Mannes, Bo Jonsson Grip überging, wodurch der Bürgerkrieg zunächst beendet werden konnte und Magnus Eriksson die Freiheit zurückerhielt.
Als Bo Jonsson 1386 starb, machte Albrecht einen neuen Versuch, die Königsmacht wiederherzustellen. Er gedachte, die Vormundschaft für Bo Jonssons Witwe und Kinder zu übernehmen und wollte einige adlige Güter einziehen. Daraufhin wandten sich Bo Jonssons Testamentsvollstrecker an die dänische Königin Margarethe I. um Hilfe. Diese intervenierte sogleich in Südschweden und besiegte Albrecht 1389 in der Schlacht bei Åsle in der Nähe von Falköping. Dabei wurde Albrecht gemeinsam mit seinem Sohn Erich gefangengenommen. Die Freigabe 1395 erfolgte nach dreijährigen Verhandlungen unter Beteiligung der Lübecker Bürgermeister Hinrich Westhof und Johann Niebur unter der Bedingung, dass Albrecht den schwedischen Thron an Margarete übergebe, falls er nicht innerhalb von drei Jahren eine festgelegte Geldsumme bezahlen könne. So nahm Margarete 1398 das bis dahin von der Hanse besetzte Stockholm mit dem Einverständnis Lübecks in Besitz.
Nach seiner Niederlage kehrte Albrecht nach Mecklenburg zurück und übernahm das Herzogtum Mecklenburg. Während seiner Abwesenheit regierte vermutlich seinen Neffe Johann IV. als Alleinregent, der auch später Mitregent blieb.
Albrecht starb 1412 und wurde im Kloster Doberan begraben.
Familie
Albrecht III. war zweimal verheiratet.
In erster Ehe heiratete er Richardis, eine Tochter des Grafen Otto von Schwerin. Mit ihr hatte er mindestens drei Kinder:
- Erich (* nach 1359; † 26. Juli 1397), 1395-1397 Regent zu Gotland.
- Richardis († nach 1400), verheiratet mit Johann, Herzog von Görlitz.
- (eine weitere Tochter), durch Urkunden belegt als: herczogen Albrecht von Mekelimburg sone tochter eyne, weliche denne die iungiste ist.
In zweiter Ehe heiratete er Agnes († 1434), die eine Tochter des Herzogs Magnus von Braunschweig war. Agnes wurde in der Albrechtskapelle der Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius von Gadebusch begraben, wo ihre Grabplatte (heute im Chor der Kirche) erhalten ist. Mit ihr hatte er einen Sohn:
Literatur
- Ludwig Fromm: Albrecht III. (Herzog von Mecklenburg-Schwerin). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 273–276.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Erik IV. (Daenemark)
Erik IV. Plovpenning (= Pflugpfennig) (* 1216; † 10. August 1250 bei Missunde) war ein Sohn des dänischen Königs Waldemar II. und dessen Frau Berengaria von Portugal. Er war ab 1232 Mitkönig seines Vaters in Dänemark und ab 1241 alleiniger König zur großen Verärgerung seiner beiden Brüder Abel und Christoffer I., die Teilhabe an der Macht forderten.
Konflikte
Dies führte zu langwierigen Kriegen über viele Jahre, wobei Abel, Herzog in Schleswig, Unterstützung von seinen holsteinischen Schwägern erhielt. 1244 kam es anlässlich eines geplanten Kreuzzuges gegen Estland zu einem Vergleich, der aber nur von kurzer Dauer war.
Um diese Kämpfe zu finanzieren, erhob Erik 1249 eine Steuer auf jeden Pflug, wovon er seinen Beinamen bekam. Das schien eine gerechte Steuer zu sein, da die Anzahl der Pflüge im Land in einem konstanten Verhältnis zum bearbeiteten Land stand. Es handelte sich also eigentlich um eine flächenbezogene Grundsteuer, die sich an der Zahl der Pflüge orientierte. Zwar konnten alle den kleinen Betrag bezahlen, aber die ruppige Art, sie einzutreiben, erzeugte Unmut, so dass der König 1249 sogar vor aufgebrachten Bauern in Schonen fliehen musste.
Außerdem stand er in Konflikt mit der Kirche in Dänemark. Er musste sich einen Brief vom Papst beschaffen, um die Bischöfe zwingen zu können, die von ihm bestimmten Priester an seinen Kirchen einzusetzen. Andererseits begann er, auf eigene Kosten für die Franziskaner ein Kloster in Roskilde zu bauen. Aber Krieg und Unfriede hinderten ihn an der Vollendung seiner Arbeit.
Tod
1250 gelang es ihm, den größten Teil von Abels südjütischen Herzogtum zu erobern, und er traf sich mit Abel für einen Vergleich. Nach diesem Treffen wurde er auf Geheiß seines Bruders am 10. August 1250[1] [2] in der Nähe von Missunde ermordet. Nach einer Überlieferung wurde ihm auf einem Boot der Kopf abgeschlagen und sein Leib in der Schlei versenkt. Der aufgetauchte Leichnam wurde in Schleswig beigesetzt. 1258 wurden seine sterblichen Überreste in die St.-Bendts-Kirche in Ringsted überführt, wo er bestattet liegt. Über seinem Grab sind Fresken mit Szenen aus seinem Leben und von seinem Tod zu sehen.
Wegen seiner Rom-Treue, die ihn 1239 sogar zum päpstlichen Favoriten für den deutschen Kaiserthron machte, und seiner Ermordung wurde er als Märtyrer und Heiliger verehrt, allerdings nicht kanonisiert.[3] Sein Gedenktag ist der 10. August.
Nachkommen
Aus seiner Ehe mit Jutta von Sachsen hatte er folgende Töchter:
- Sophie von Dänemark ∞ König Waldemar Birgersson von Schweden.
- Jutta von Dänemark, Nebenfrau von König Waldemar Birgersson von Schweden.
- Agnes von Dänemark, Äbtissin von St. Agnete in Roskilde
- Ingeborg von Dänemark ∞ König Magnus Lagabøte von Norwegen.
Sonstiges
Theodor Fontane erwähnt die Ermordung Eriks IV. in seiner Schilderung Der Schleswig-Holsteinsche Krieg im Jahre 1864.[4] Er gibt dabei als Tag – wie einige andere Quellen auch – den 9. August an. Doch geschah der Mord am Tag des Heiligen Laurentius von Rom.
Literatur
- Ekkart Sauser: Erich (Erik) Plovpenning. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 21, Nordhausen 2003, ISBN 3-88309-110-3, Sp. 376.
- "Erzählung vom Tode Koenig Erich Plogpennings" (in: Ludwig Weiland (Hg.), Holsteinische Reimchronik. Monumenta Germaniae Historica, Deutsche Chroniken II, S. 632f.; mittelniederdeutsche Erzählung aus Hannover, Landesbibliothek, Ms. XXI 1283, Bl. 57r; Ende 15. Jahrhundert)
Einzelnachweise
- ↑ http://www.xxx
- ↑ http://xxx
- ↑ Ekkart Sauser: ERICH (Erik) PLOVPENNING, König von Dänemark. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 21, Nordhausen 2003, ISBN 3-88309-110-3, Sp. 376.
- ↑ http://www.xxx
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Johann I. (Holstein-Kiel)
Johann I. (* um 1229; † 20. April 1263) war Graf von Holstein-Kiel (1261–1263) aus dem Geschlecht der Schauenburger.
Leben
Johann war der älteste Sohn von Graf Adolf IV. von Schauenburg und Holstein und dessen Gemahlin Heilwig von der Lippe. Nachdem sich sein Vater 1239 ins Kloster zurückzog, regierte Johann gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Gerhard zuerst unter Regentschaft. Er war in ständige Streitigkeiten mit seinem Bruder und dem Bischof von Minden verwickelt. Bei der Teilung 1261 erhielt er Wagrien, Ostholstein und Segeberg und residierte in Kiel. Stormarn, Plön und Schauenburg fielen an seinen Bruder Gerhard, der in Itzehoe residierte. Die Brüder schlossen 1255 einen Handelsvertrag mit Lübeck ab. Das von Dänemark zurückgewonnene Rendsburg trat Johann seinem Bruder Gerhard ab und erhielt dafür Segeberg. Nach seinem Tod regierten seine Söhne gemeinsam unter der Regentschaft ihres Onkels, teilten jedoch 1273 den Besitz in die beiden Linien Kiel und Segeberg, die nach Adolfs Tod 1308 wieder mit Kiel vereinigt wurde.
Nachkommen
Johann heiratete 1249/50 Elisabeth († 1293/1306) eine Tochter Herzog Albrechts I. von Sachsen, sie hatten sechs Kinder.
- Elisabeth von Holstein († um 1284) ∞ Graf Nikolaus I. von Schwerin-Wittenburg († 1323)
- Heilwig (* um 1251; † vor 1308) ∞ (1262) Markgraf Otto IV. von Brandenburg (* um 1238; † 1308/09)
- Adolf V. Graf von Holstein-Segeberg (* um 1252; † 1308) ∞ Euphemia von Pommern († nach 1316).
- Johann II. Graf von Holstein-Kiel (* 1253; † 1321)
- Agnes († 1286/1287) ∞ Fürst Waldemar von Mecklenburg-Rostock (* vor 1262; † 1282)
- Albrecht († 1300) 1283 Dompropst in Hamburg
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Gerhard I. (Holstein-Itzehoe)
Gerhard I. (* 1232; † 21. Dezember 1290) war der einzige Graf von Holstein-Itzehoe.
Leben
Er war der zweite Sohn von Adolf IV. (Schauenburg und Holstein) und Heilwig von der Lippe.
Als sein Vater sich 1238 in ein Kloster zurückzog, regierte er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Johann, anfangs unter der Vormundschaft von deren Onkel Herzog Abel von Schleswig. Als Adolf IV. 1261 starb, teilten Johann und Gerhard Holstein in die Grafschaften Holstein-Kiel und Holstein-Itzehoe, wobei Gerhard den Teil mit Stormarn, Plön und Schauenburg übernahm und in Itzehoe residierte und Johann den Teil mit Kiel, Wagrien, Ostholstein. Er baute dort die Herrschaft mit Rodungsbesiedlung planvoll aus, sodass mehrere Orte entstanden. 1255 schlossen die Brüder ein Handelsabkommen mit Lübeck. Gerhard bekam Rendsburg vom Bruder Johann, welches er von Dänemark zurückgewann und trat dafür Segeberg ab. Er half den Neffen in Schleswig gegen Dänemark und sicherte so das Gebiet Eckernförde. Er siegte 1262 in der Schlacht auf der Lohheide. Als sein Bruder 1263 starb, wurde er als Vormund der Söhne von Johann Regent von Kiel und Segeberg. Er stritt viel mit den Erzbischöfen von Bremen, mit Lübeck und dem Landadel und baute die Verwaltung aus.
Als Gerhard I. starb, teilten seine Söhne Gerhard, Adolf und Heinrich 1290 die Grafschaft Holstein-Itzehoe in die drei Grafschaften Holstein-Plön, Holstein-Schauenburg und Holstein-Rendsburg auf.
Ehen und Nachkommen
Er heiratete ca. 1250 Elisabeth von Mecklenburg († ca. 1280), eine Tochter von Johann I. von Mecklenburg und hatte mit ihr folgende Kinder:
- Liutgard, (* ca. 1251; † 1289), verheiratet mit Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg, dann verheiratet mit Graf Albrecht von Anhalt
- Johann (* 1253; † ca. 1272), Kanonikus in Hamburg
- Gerhard II. (* 1254; † 1312) Graf von Holstein-Plön
- Adolf VI. (* 1256; † 1315) Graf von Holstein-Schauenburg
- Heinrich I. (* 1258; † 1304) Graf von Holstein-Rendsburg
- Elisabeth († vor 1284), verheiratet mit Graf Burchard von Wölpe
- Albrecht († zwischen 1272 und 1281)
- Bruno
- Otto
- Mechthild, verheiratet mit Graf Johann von Wunstorf
- Hedwig (* vor 1264; † ca 1325), verheiratet mit König Magnus von Schweden
Ca. 1280 heiratete er Adelheid (* ca. 1237; † 1285), eine Tochter des Markgrafen Bonifatius II. von Montferrat (* ca. 1203; † 1253).
Literatur
- K. Jansen: Gerhard I. (Graf von Holstein und in Schauenburg). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, S. 737.
- Wilhelm Koppe: Gerhard I.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, S. 265 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Abel
(* 1218; † 29. Juni 1252) war Herzog von Schleswig (1232–1250) und König von Dänemark (1250–1252).
Leben
Abel war Sohn von König Waldemar II. von Dänemark und seiner zweiten Frau Berengaria von Portugal.
Nach dem Tod des Vaters bestieg Abels älterer Bruder Erik IV. von Dänemark den dänischen Thron. Schon bald kam es zu Konflikten zwischen den beiden Brüdern. Im Krieg 1248 zerstörten Truppen des Königs mehrere schleswigsche Handelsplätze, darunter Flensburg, das in dieser Quelle zum ersten Mal überhaupt genannt wird. 1250 bat Abel König Erik IV., vorgeblich zu Versöhnungsgesprächen, in seine Residenzstadt Schleswig. Dort ließ er den König, angeblich auf einem Boot, ermorden und die Leiche in der Schlei versenken. Um dieses blutige Ereignis ranken sich zahlreiche Legenden. Abel bestieg am 1. November 1250 selbst den Königsthron, nachdem er 24 Ritter gefunden hatte, die auf dem Thing in Viborg seine Unschuld beschworen (doppelter Zwölfer-Eid). Er wurde aber am 29. Juni 1252 bei einer Expedition gegen die Friesen auf Eiderstedt, von denen er höhere Abgaben verlangte, ermordet. Nach einer Legende spukte er in der Domkirche von Schleswig, weshalb man ihn bei Gottorp in ein Sumpfloch warf und ihm zur Sicherheit einen Pfahl durch die Brust trieb. Seine Witwe wurde die zweite Frau Birger Jarls von Schweden. Als König folgte ihm sein Bruder Christoph I. nach, während sein Sohn Waldemar Herzog von Schleswig wurde. Abels Nachkommen regierten das Herzogtum Schleswig bis zum Aussterben des Mannesstammes 1375. Der Grabstein Abels befindet sich im Wald in der Nähe des Barockgartens von Schloss Gottorf.
Ehe und Nachkommen
1237 heiratete Abel Mechthild von Holstein, eine Tochter des Grafen Adolf IV. von Schauenburg und Holstein und hatte mit ihr folgende Kinder:
- Waldemar (* 1238; † 1257), Herzog von Schleswig 1252–1257
- Sophie (* 1240; † nach 1284) ∞ Bernhard I. (Anhalt) († 1286/87), Fürst von Anhalt-Bernburg
- Erich († 1272), Herzog von Schleswig 1260–1272
- Abel (* 1252; † 1279, Herr von Langeland 1261-79
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Die Abelssage.
Mit König Erichs Thronbesteigung hatte sein Bruder, Herzog Abel von Schleswig, durch Intriguen[VL 1] und offene Feindseligkeiten ihn zu stürzen und sich seines Thrones zu bemächtigen gesucht, doch da Erich ihn besiegte, hatte er sich unterwerfen müssen. Da bekam plötzlich der König Nachricht, daß ungeachtet des Friedens Graf Johann von Holstein mit Heeresmacht Rendsburg belagere, und Abel ihm wahrscheinlich hülfreiche Hand leiste. Sogleich brach der König gegen die Holsteiner auf; unterwegs aber kehrte er in Schleswig bei seinem Bruder ein, um diesen zur Eintracht zu gewinnen. Abel empfing ihn auf seinem Schlosse, das auf der jetzt sogenannten Möweninsel lag,[VL 2] und bewirthete ihn freundlich. Aber während Erich nach der Tafel mit einem Ritter am Brettspiel saß, berieth Herzog Abel sich mit Lauge Gudmundsön und Inge Pust, wie er den König aus dem Wege räumen möchte. Als sie sich einig waren, suchte der Herzog einen Zank mit dem König. Darum ging er auf ihn zu und schalt ihn wegen des Unheils, das er über sein Haus gebracht habe. „Denkst du noch daran“, sagte er, „wie du vor zwei Jahren diese Stadt verbranntest, und meine Tochter nackend und barfuß aus dem Thore gehen mußte?“ - Der König antwortete „Ich glaube, lieber Bruder, daß ich noch Geld genug im Beutel [85] habe, um deiner Tochter ein Paar neue Schuhe zu kaufen.“ Da ließ der Herzog ihn sogleich fesseln und in ein Boot werfen, das mit ihm die Schlei hinunterfuhr Bei Brodersbye holte ein zweites Boot das des Königs ein; der König fragte, wer es leite. Als man ihm antwortete, es sey Lauge Gudmundsön, so wußte der König, daß er sterben müsse, und befahl, ihm einen Mönch von der Brodersbyer Kapelle zu holen, was auch geschah.[VL 3] Davon heißt der Ort noch jetzt Messunde.[VL 4] Als Erich gebeichtet hatte, schlug man ihm auf Lauge’s Befehl das Haupt herunter, und versenkte den Leichnam in die Schlei, beschwert mit Steinen und Ketten, von welchen noch heute einige Glieder in dem Schleswiger Dom gezeigt werden.
Zur Nachtzeit aber sah man an der Stelle, wo der König versenkt war, blaue Flammen auf dem Wasser tanzen, und des Tages lagerten sich dort dichte Möwenschwärme und riefen unaufhörlich Erich! Erich! - Das währte zwei Monate hindurch; da tauchte der Leichnam wieder auf und wurde von Fischern nach Schleswig gebracht, wo er heimlich im Dom bestattet ward.[VL 5] Seitdem verschwanden die Flammen; die Möwen aber flogen auf und lagerten sich um Albelsburg, wo sie ihre Nester bauten und sich auf keine Weise vertreiben ließen. Die Burg ist seitdem längst in [86] Trümmer gesunken, die Möwen aber bewohnen noch immer und jetzt allein die Insel, und rufen. Erich! Erich![VL 6]
Abel war nun König, aber Ruhe fand er nicht mehr und fiel zwei Jahre später in einem Kampfe gegen die Friesen, der Rademacher Wessel Hummer aus Pellworm erschlug ihn auf dem Milderdamm bei Stapelholm. Auch ihn bestattete man wie seinen Bruder im Dome zu Schleswig; aber es duldete ihn nicht im Grabe. Nachts, wenn die Mönche ihr Gebet absangen, erhub sich Gepolter und Stöhnen und störte sie in ihrem heiligen Amte. Nachdem sie vergebens versucht hatten, den ruhelosen Geist zu bannen, ließen sie die Leiche ausgraben und in einen Sumpf im Pöhlerwald[VL 7] versenken und einen Pfahl durch den Sarg und den Körper in die Erde treiben, damit er sich nicht wieder erheben könne. Noch jetzt zeigt der Bauer der dortigen Gegend die Stelle. - Allein es ist Alles vergebens gewesen. In der Nacht steigt der todte König aus seinem Sumpfgrabe und schwingt sich auf ein kleines feuriges Roß; zwei feurige Hunde begleiten ihn. So unter Pfeifen und Hörnerschall braus’t die wilde Jagd hoch durch die Luft hin, über das Gehölz, über die Domkirche dem Möwenberge zu; um diesen wird die Runde gemacht, dann geht es weiter bis nach Missunde hin zu der Stätte des Brudermordes, dann wieder zurück in das Grab im Pöhlersumpf. Das ist [87] König Abel’s wilde Jagd, die manchen noch Lebenden erschreckt hat. In der Sommernacht aber des zehnten August, am Todestage König Erich's, jagt er wilder als sonst, und Hörnerruf, Gestöhn und Rüdengebell schallen laut durch die Nacht.
Anmerkungen der Vorlage
- ↑ „intrekeert“ sagen die Leute.
- ↑ Die Geschichtschreiber setzen die Burg bald aus die jetzige Freiheit, bald nach der Schiffsbrücke oder dem Bischofshof. Ob die Jürgensburg gemeint ist, die Dankwerth, Heldvader und Andre erwähnen, und von der noch heute theils in dem Wall auf der Insel selbst, theils in einer zur Stadt führenden Steinbrücke Spuren vorhanden sind, bleibe dahingestellt.
- ↑ Dahlmann erzählt fast ebenso; aber nicht Einer sondern Mehrere haben uns so mündlich erzählt.
- ↑ Vielleicht von Sund und Messe; so leitet das Volk wenigstens ab. Die bekannte Ableitung ist von missus in undas.
- ↑ Andere erzählen, daß in der Schlei zwischen Loitmark und Arnis nach dem Angelschen Ufer zu ein großer Stein sey, worunter König Erich begraben liegt. Allnächtlich kehrt er sich um, wenn die Uhr zwölf schlägt, - oder, wie die Rationalität sagt, wenn er sie zwölf schlagen hört.
- ↑ Andre sagen, daß die Möwen der Herzog und seine Gesellen sind, die so arg auf der Insel haus’ten, daß Gott sie in Möwen verwandelte, und es ihnen auflegte, daß sie jährlich sollten geschossen werden. Daher das Möwenschießen, ein Volksfest der Schleswiger. So viel ihrer auch getödtet werden, kommen sie doch jährlich wieder. Vor hundert Jahren ist das Möwenschießen einmal unterblieben; da blieben die Möwen sieben ganze Jahre aus.
- ↑ Bei der jetzigen Stampfmühle.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der freien Quellensammlung Wikisource übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikisource. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikisourceseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren, bzw. Versionsgeschichte”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite.
|
 |
 |
|
Johann II. (Kastilien)
Johann II. von Kastilien (* 6. März 1405 in Toro; † 20. Juli 1454 in Valladolid) war König von Kastilien und León.
Er war der Sohn von Heinrich III. und dessen Frau Katharina von Lancaster, Tochter von John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster und Konstanze von Kastilien. Er folgte seinem Vater am 25. Dezember 1406 als im Alter von 22 Monaten nach. Während seiner Minderjährigkeit führten seine Mutter und sein Onkel Ferdinand von Antequera die Regierungsgeschäfte. Diese Doppelregentschaft gestaltete sich sehr konfliktreich und spaltete das Land in zwei Lager. Nachdem Katharina und Ferdinand 1416 gestorben waren, setzte der Erzbischof von Toledo, Sancho de Rojas, durch, dass der König 1419 anlässlich seiner Hochzeit mit Marie von Aragon für volljährig erklärt wurde und offiziell die Macht übernahm.
Seine Regentschaft stand von Anfang an unter dem Zeichen der Konfrontation mit dem heimischen Adel. Zu seinen Gegnern zählten auch die Söhne seines Onkels, darunter Johann von Aragon, seit 1425 König von Navarra. Erst um 1430 gelang es ihm, sich mit Hilfe von Álvaro de Luna gegen Ferdinands Söhne durchzusetzen. Nach einem Sieg Johanns gegen das Emirat von Granada in der Schlacht von La Higueruela 1431 wurde ein kurzfristiger Frieden durch die Ehe von Johanns Sohn Heinrich mit Bianca von Navarra (auch Blanka von Aragon genannt), der Tochter seines Konkurrenten, bestätigt. Diese Ehe wurde jedoch nie vollzogen und wurde später aufgelöst. Erst 1445 gelang de Luna der entscheidende Sieg, der jedoch die Thronstreitigkeiten und Aufstände der verschiedenen Adelsparteien nicht beendete.
Trotz seiner Regierungszeit von insgesamt 49 Jahren war Johann ein schwacher König, der unter dem Einfluss seines Günstlings Álvaro de Luna stand. De Lunas Einfluss endete, als Johanns zweite Ehefrau Isabella, der Tochter des Johann von Portugal, eine Verschwörung zu seinem Sturz unterstützte, an der vermutlich auch Johann von Aragon beteiligt war. 1453 wurde de Luna hingerichtet. Johann starb ein Jahr später und hinterließ ein zerrissenes, finanziell ruiniertes Land.
Nachkommen
Erste Ehe mit Marie von Aragon (1396–1445), Tochter von Ferdinand I. von Aragón:
Heinrich IV. der Impotente (* 5. Januar 1425; † 14. Dezember 1474)
Zweite Ehe mit Isabella von Portugal (1428–1496):
Isabella I. (Kastilien) (* 22. April 1451; † 26. November 1504), die als Isabella die Katholische in die Geschichte einging
Alfons (* 15. November 1453; † 5. Juli 1468)
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Erik VII. (Daenemark)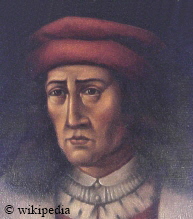
Erich von Pommern (eigentlich Bogislaw) (* um 1382 in Rügenwalde, Pommern-Stolp; † 1459 ebenda) war von 1412 bis 1439 alleiniger König der Kalmarer Union.
Erich war Großneffe und Erbe der bedeutenden dänisch-norwegischen Regentin Margarethe I., deren Favorit er für ihre Nachfolge war. Er trat also ein großes Erbe an. Er war verheiratet mit Prinzessin Philippa (1394–1430), Tochter Heinrichs IV. von England.
Er wurde als Jugendlicher – aber nach skandinavischem Erbrecht Volljähriger – schon 1397 in Kalmar, Schweden gekrönt und war gleichzeitig:
- Erik VII. von Dänemark
- Eirik III. von Norwegen
- Erik XIII. von Schweden
Später wurde er:
- Erich I. von Pommern(-Stolp)
Leben und Wirken
Schon zu seiner Kindheit wurde er, der ihr nächster männlicher Erbe war, von Margarethe auserkoren, König der drei skandinavischen Staaten zu werden. Er war der Sohn des Herzogs Wartislaw VII. von Pommern-Stolp und dessen Frau Maria, Tochter Herzogs Heinrich III. von Mecklenburg und Nichte des schwedischen Königs Albrecht von Mecklenburg, und erhielt von diesen den bei der pommerschen Herzogsdynastie der Greifen häufig vergebenen Namen Bogislaw.
Margarethe veranlasste bereits 1388 die Anerkennung des Erbrechts des Jungen als König von Norwegen durch die norwegischen Stände. Ein Jahr später holte sie ihn nach Kopenhagen, bereitete ihn auf sein späteres Amt vor und wirkte im Hintergrund bis zu ihrem Tode 1412 als eigentliche Herrscherin des Reichsverbundes. Mit seiner Annahme als König von Norwegen wurde ihm der passendere Namen Erik gegeben. Kurz darauf wurde er auch zum König von Dänemark gewählt. Die Krönung für die gesamte Kalmarer Union erfolgte am 17. Juni 1397.
1406 heiratete Erik Philippa, eine Tochter des englischen Königs Heinrich IV.. Diese Verbindung sollte ihm bei der Stabilisierung seines nordeuropäischen Großreiches helfen. Seine Regierung war geprägt von Konflikten mit der Hanse, dem Deutschen Orden und den schauenburgischen Grafen von Holstein Herzogtum Holstein. Die Ausgaben dafür musste vor allem Schweden tragen.
Erik führte 1429 den Sundzoll auf dem Öresund ein, der den Konflikt mit der Hanse verschärfte und in abgewandelter Form bis 1857 existierte. Er gründet außerdem die Stadt Malmö in Schonen (schwedisch: Skåne). Malmö trägt daher den pommerschen Greif im Wappen.
Der für Dänemark nachteilige Frieden von Vordingborg machte ihn verbunden mit einem Aufstand in Schweden für den Reichsrat angreifbar.
1439 wurde Erik zunächst vom dänischen, dann auch von den übrigen Reichsräten abgesetzt, nachdem er sich nach Gotland zurückgezogen hatte. In Dänemark folgte ihm sein Neffe Christoph III., Sohn seiner Schwester Katharina (1390–1426), nach. Als 1448 der schwedische Reichsverweser dort als Karl VIII. zum König gewählt wurde und Gotland angriff, ging Erik nach Rügenwalde in Pommern. Nach dem Tod seines Vetters Bogislaw IX. 1446 übernahm er dessen Herzogtum Pommern-Stolp. Erich von Pommern starb 1459 und wurde in der Stadtpfarrkirche zu Rügenwalde/Pommern begraben. Da er keine eigenen Nachkommen hatte, sondern nur die Tochter seines Vetters Bogislaw IX. von Pommern-Stargard (1418-1446) namens Sophia als Erben hatte, entbrannte sowohl um sein nicht unbeträchtliches Vermögen als auch um sein Herrschaftsgebiet ein Streit zwischen den anderen Herzögen von Pommern. Die Nichte ehelichte Herzog Erich II. von Pommern-Wolgast. Gegen ihn stellten sich sein Bruder Wartislaw X. und der Stettiner Herzog Otto III. Ein Sohn aus der Ehe Sophias mit Erich II. war Pommerns bedeutendster Herzog Bogislaw X.
Literatur
- Heinz Barüske: Erich von Pommern. Ein nordischer König aus dem Greifengeschlecht. Rostock 1997, ISBN 3-356-00721-1.
- Gottfried von Bülow: Erich I., Herzog von Pommern. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 206 f.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Heinrich IV. (England)
Heinrich IV., Herzog von Hereford, Herzog von Lancaster, auch Henry Bolingbroke (engl.: Henry IV.; * April oder Mai 1366 oder 1367 auf Bolingbroke Castle, Lincolnshire; † 20. März 1413 in London) war, nachdem er zuvor Richard II. entthront hatte, König von England von 1399 bis 1413. Er war der Sohn und Erbe von John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster, und der erste englische König aus dem Hause Lancaster, welches später in den sogenannten Rosenkriegen um seinen Machterhalt kämpfte.
Seine weiteren Titel waren: Ritter des Hosenbandordens, Earl of Derby, Earl of Hereford, Earl of Northampton, Earl of Lincoln und Earl of Leicester.
Leben
Heinrich IV. war der einzige überlebende Sohn von John of Gaunt, dem dritten überlebenden Sohn von Edward III., aus dessen erster Ehe mit Blanche of Lancaster, Tochter und Erbin von Henry of Grosmont, 1. Duke of Lancaster. Damit gehörte er einer Nebenlinie des Königshauses Plantagenet an und war der Erbe des Herzogtums Lancaster mit seinen umfangreichen Ländereien. Über die Geburt von Heinrich lässt sich mit Sicherheit nur sagen, dass er auf Bolingbroke Castle das Licht der Welt erblickte, weshalb er auch Henry Bolingbroke genannt wurde. Das genaue Geburtsdatum ist allerdings nicht überliefert. Am häufigsten findet man allerdings Angaben, welche seine Geburt im April oder Mai des Jahres 1366 beziehungsweise 1367 ansiedeln.[1]
Während der Auseinandersetzungen seines Cousins Richard II. mit den Parlamenten befand sich Heinrich zunächst wie die Mehrheit des englischen Adels auf der Seite der Opposition gegen den König. Im Gnadenlosen Parlament von 1388 gehörte Heinrich zu den Wortführern der Anklage, die mehrere Todesurteile gegen Parteigänger Richards durchsetzten. Als der König in den folgenden Jahren wieder an Macht gewann, wechselte Heinrich auf die Seite von Richard II. 1390/91 und 1392 unternahm er Preußenfahrten,[2] 1392/93 pilgerte er nach Jerusalem.
Im Jahr 1398 wurde Heinrich nach einer Hofintrige und im Rahmen einer allgemeinen Prozesswelle auf zehn Jahre verbannt. Als kurz darauf John of Gaunt starb, verlängerte der König diese Verbannung auf Lebenszeit, um sich das reiche Erbe Heinrichs anzueignen. Als Richard jedoch zu einem Irland-Feldzug aufbrach, landete Heinrich Bolingbroke in Yorkshire und erhielt sofort einen gewaltigen Zulauf aus nahezu dem gesamten englischen Adel. Richard II. kehrte umgehend aus Irland zurück, doch sein Heer löste sich auf und lief zum Großteil zu Heinrich über. Dieser nahm Richard gefangen und schaffte ihn nach London. Im Tower eingekerkert, wurde Richard II. gezwungen, die Krone abzugeben und Heinrich Bolingbroke, der sich nun Heinrich IV. nannte, als Nachfolger einzusetzen. Das einberufene Parlament erklärte Richard der Krone für unwürdig. Am 13. Oktober 1399 wurde Heinrich IV. gekrönt.
Mit der Absetzung des Königs war die Thronfolge aber noch keineswegs klar. Bei strenger Auslegung des Erbrechts hätte Edmund Mortimer, 5. Earl of March, in der Erbfolge vor Heinrich gestanden. Dies war für Heinrich und den Kronrat jedoch nicht akzeptabel, da angesichts der Minderjährigkeit Edmunds die Gefahr bestand, dass Richard, der zu diesem Zeitpunkt noch lebte, den Thron zurückerobern würde oder dass ein minderjähriger König erneut zu Bürgerkrieg und zu Anarchie geführt hätte. Heinrich gelang es, den eigenen Herrschaftsanspruch, mit Bezugnahme auf seine enge Verwandtschaft zu seinem Vorgänger, durch Parlamentsbeschlüsse und mit Verweis auf das Gottesgnadentum durchzusetzen. Angesichts dieser fadenscheinigen Begründungen blieben während seiner gesamten Regierungszeit massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Thronfolge bestehen, die vor allem durch Kritik und Intrigen aus dem Klerus entstanden, der Heinrich gegenüber wegen der antiklerikalen Einstellung seines Vaters John of Gaunt eher feindlich gesinnt war. Er versuchte eine politische Annäherung an den deutschen König Ruprecht, indem er die Vermählung seiner ältesten Tochter Blanca mit dessen ältestem Sohn Ludwig III. dem Bärtigen, in die Wege leitete. Die „englische Heirat“ fand am 6. Juli 1402 in Köln statt.
Realpolitisch konnte Heinrich IV. in seiner kurzen Regierungszeit eine Reihe von Erfolgen erzielen. Wenige Monate nach der Machtübernahme gelang es ihm, einen Aufstand mächtiger Parteigänger Richards II. niederzuschlagen. Kurz darauf wurde Richard während seiner Haft im Schloss Pontefract ermordet, vermutlich auf Befehl Heinrichs. In den folgenden Jahren kam es mehrfach zu Revolten der mächtigen nordenglischen Adelsfamilie Percy, die Heinrich kurz zuvor noch bei der Durchsetzung seines Thronanspruchs unterstützt hatte, sowie zu einem ungewöhnlich umfassenden, bis 1410 andauernden Aufstand der Waliser unter Owain Glyndwr. Der Percy-Aufstand endete mit der Niederlage des aus der Familie stammenden Herzogs von Northumberland 1408 in der Schlacht bei Branham Moor. Aus allen diesen Auseinandersetzungen ging Heinrich als Sieger hervor. Der Erfolg des Königs ist zum Teil auch den militärischen Fähigkeiten seines ältesten Sohnes Heinrich zu verdanken, der später König Heinrich V. wurde. Verbündete fand er vor allem im Klerus, insbesondere in Thomas Arundel, Erzbischof von Canterbury. Dies bedeutete eine Stärkung der Commons im Parlament, die zeitweise ihr Mitspracherecht in der königlichen Haushaltsführung ausweiten konnten. Eine weitere Folge dieser Politik war das harte Vorgehen gegen die Lollarden, eine Bewegung, die grundlegende kirchliche Lehrsätze bezweifelte und vor allem in der Spätphase von Heinrichs Herrschaft als Ketzerei verfolgt wurde.
1406 nahmen englische Soldaten den späteren Jakob I. von Schottland gefangen, der auf der Reise nach Frankreich war. Jakob blieb Gefangener bis zum Ende von Heinrichs Herrschaft.
Ab 1405 zeigte der König zunehmende Krankheitssymptome. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich im Winter 1408/09 dramatisch. Dennoch behielt er die Macht fest in der Hand, obwohl ihn sein Sohn, der spätere Heinrich V., zum Rückzug aus der Politik drängte. Dies führte zu einem Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn, das aber kurz vor Heinrichs IV. Tod beendet wurde. Heinrich IV. wurde von verschiedenen Krankheiten heimgesucht, unter anderem auch Epilepsie. Am 20. März 1413 starb er im Jerusalemzimmer im Haus des Abtes von Westminster an einer Hautkrankheit, die wohl Lepra war, und wurde in der Kathedrale von Canterbury begraben. Eine Exhumierung einige Jahrhunderte später brachte zum Vorschein, dass sein Körper hervorragend einbalsamiert worden war.
In vielen Chroniken des Mittelalters wird Heinrich IV. als Despot und Usurpator bezeichnet. Dabei handelt es sich wahrscheinlich aber um eine von kirchlichen Kreisen gefärbte Darstellung, mit der der Klerus auf die Einschränkung seiner Macht durch Heinrich, vor allem aber durch seinen Vater, reagierte.
Nachkommen
1380 heiratete Heinrich Mary de Bohun, mit der er zwei Töchter und fünf Söhne hatte:
- Eduard (* April 1382) starb früh
- Heinrich V. (1387–1422), König von England
- Thomas of Lancaster (1388–1421), Herzog von Clarence
- John (1389–1435), Herzog von Lancaster, Bedford, Kendal und Richmond
- Humphrey (1390–1446), Herzog von Gloucester
- Blanca, auch Blanche (1392–1409) ∞ Ludwig III. von der Pfalz
- Philippa (1394–1430) ∞ 1406 Erich von Pommern, König von Dänemark, Norwegen und Schweden
Seine Ehefrau Mary starb am 4. Juni 1394. 1403 heiratete Heinrich Johanna von Navarra, die Tochter Karls II. von Navarra. Sie war die Witwe von Johann V. von der Bretagne, dem sie vier Töchter und vier Söhne geboren hatte, aber sie und Heinrich bekamen keine Kinder.
Rezeption
Heinrich IV. ist die titelgebende Hauptfigur von William Shakespeares zweiteiligem Drama Heinrich IV.
Literatur
- Marie Louise Bruce: The Usurper King. Henry of Bolingbroke 1366–99. The Rubicon Press, London 1986.
- CP = Georg Edward Cokayne: The complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom - extant, extinct or dormant. Reprint der Ausgabe London, St. Catherine Press: 1910–1959, Stroud u.a.: Sutton 2000. ISBN 0-904387-82-8.
Einzelnachweise
- ↑ Siehe: thePeerage.com und Royal Genealogical Data; für eine genauere Auseinandersetzung mit der Problematik siehe: CP, S. 412.
- ↑ Werner Paravicini: Die Preußenreisen des europäischen Adels. Teil 1, Thorbecke, Sigmaringen 1989, ISBN 3-7995-7317-8, S. 149 (Beihefte der Francia, Band 17/1).
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Eduard IV. (England)
Eduard IV. (* 28. April 1442 in Rouen; † 9. April 1483) aus dem Haus York war von 1461 bis 1470 und von 1471 bis 1483 König von England.
Abstammung
Eduard war der erste Sohn von Richard Plantagenet, Herzog von York, Graf von March, und dessen Gemahlin Cecily Neville. Richard hatte ein begründetes Anrecht auf den englischen Thron, aus seiner Sicht sogar ein größeres als Heinrich VI. selbst. Heinrichs VI. Großvater, Heinrich IV., hatte den englischen Thron usurpiert, obwohl sein Cousin Edmund Mortimer, 5. Earl of March, als Vertreter einer älteren Familienlinie das größere Anrecht auf die Thronfolgerschaft hatte. Die Linie Mortimer stammte über weibliche Erbfolge vom zweitältesten überlebenden Sohn Eduards III., Lionel von Antwerpen, ab, Heinrich VI. war der Urenkel des drittältesten Sohnes Eduards III., John of Gaunt. Eduard war der Urenkel von Edmund of Langley, des vierten Sohnes Eduards III., und über seine Großmutter Anne Mortimer, der Schwester Edmund Mortimers, gleichzeitig Urururenkel Lionels von Antwerpen. In Eduard waren demzufolge die Thronansprüche der zweiten (Clarence-Mortimer) sowie der vierten Linie (York) des Königshauses Plantagenet vereinigt, während sich Heinrich VI. auf die dritte Linie (Lancaster) und sein bereits seit drei Generationen bestehendes Königtum berief. Die Auseinandersetzungen zwischen ihnen und ihren Sympathisanten gingen als Rosenkriege in die englische Geschichtsschreibung ein.
Herrschaftsantritt und erste Regierungsjahre
Eduards Vater Richard fiel schon früh im Verlauf der Rosenkriege 1460 in der Schlacht von Wakefield, kurz nachdem er von Heinrich VI. als sein Nachfolger anerkannt worden war. Der zu diesem Zeitpunkt 18-jährige Eduard übernahm an Stelle seines Vaters die Führung des Hauses York. Auch die mächtige nordenglische Magnatenfamilie Neville unterstützte unter Richard dem Jüngeren, dem Kingmaker, die Yorkisten. Dieser musste aber bei St. Albans eine Niederlage gegen lancastrische Truppen hinnehmen. Eduard erfocht jedoch im Februar 1461 bei Mortimer's Cross einen ersten glanzvollen Sieg. Unmittelbar vor der Schlacht war es ihm gelungen, sein angesichts einer Luftspiegelung, die drei Sonnen zeigte, in Panik verfallendes Heer in die Offensive zu zwingen. Diese Begebenheit begründete seinen Ehrennamen Sunne in Splendour. Gemeinsam mit Richard von Warwick fügte Eduard am Palmsonntag 1461 in der Schlacht von Towton den lancastrischen Truppen eine vernichtende und damit vorerst entscheidende Niederlage zu. Am 28. Juni wurde er als Eduard IV. zum englischen König gekrönt. Dadurch ging die Herrschaft vom Haus Lancaster (rote Rose) an das Haus York (weiße Rose) über. Die Anfangsphase seiner Regierung war von Erfolgen gekrönt: Lancastrische Aufstände in Wales und in Nordengland wurden niedergeschlagen, Schottland zum Frieden gezwungen und schließlich der geisteskranke Heinrich VI. im Londoner Tower gefangen gesetzt.
Der Höhepunkt der Rosenkriege
Derweil trat das Haus Lancaster unter der Führung der Königin Margarete von Anjou, der Gemahlin Heinrichs VI., sein Exil in Schottland an. Gemeinsam mit ihrem Sohn Edward of Westminster, dem Prinzen von Wales, sammelte sie Truppen für eine lancastrische Gegenoffensive. Der Zeitpunkt war gekommen, als Richard Neville 1470 von York auf die Seite Lancasters wechselte. Dazu war es gekommen, weil Eduard IV. am 1. Mai 1464 ohne das Wissen seiner Berater Elizabeth Woodville geheiratet hatte. In den drei vorhergehenden Jahren hatte Neville sich darum bemüht, eine Ehe zwischen Eduard und Bonne von Savoyen, der Schwägerin des französischen Königs Ludwig XI. auszuhandeln. Als im September 1464 bekannt wurde, dass der König bereits geheiratet hatte, fühlte der Earl of Warwick sich hintergangen und gedemütigt.
Elizabeth Woodville gehört zu den am meisten diskutierten Frauengestalten des englischen Mittelalters. Sie stammt väterlicherseits aus dem niederen englischen Rittertum und über ihre Mutter Jacquetta von Luxemburg aus dem europäischen Hochadel, war aber selbst nur Ritterliche. Ihr erster Mann Sir John Grey hatte zum lancastrischen Lager gehört. Vermutlich hatte die Heirat Eduards IV. mit ihr nicht nur politische Gründe. Zwar dürfte der demonstrative Protest des jungen Königs gegen seine mächtigen Berater, allen voran Richard Neville, eine Rolle gespielt haben, doch hätten sich im europäischen Adel zahlreiche geeignetere Kandidatinnen gefunden. Nicht nur dieses Verhalten Eduards löste Empörung in der englischen Öffentlichkeit aus, sondern auch Elisabeths Bestreben, ihre zahlreichen Geschwister mit einträglichen Adelstiteln zu versorgen.
1469 kam es zum endgültigen Bruch zwischen Eduard IV. und Richard Neville. Dieser zog sich nach Calais zurück, begleitet von Eduards jüngerem Bruder George Plantagenet, 1. Herzog von Clarence, der kurz darauf Nevilles älteste Tochter Isabelle heiratete. Zeitgleich entfachte Richard Neville in Nordengland einen Aufstand gegen die Krone unter Robin of Redesdale und verbündete sich mit dem Haus Lancaster unter Margarete von Anjou. Die Aufständischen siegten am 26. Juli bei Edgecote gegen ein königliches Kontingent, das von Eduards Schwiegervater Graf Rivers und dessen Sohn John Woodville befehligt wurde. Richard Neville ließ die beiden umgehend hinrichten. Richards Bruder, Erzbischof George Neville von York, konnte Eduard IV. selbst in Middleham gefangen setzen. Da der König im Gegensatz zu seiner Woodville-Verwandtschaft weiterhin äußerst beliebt war, musste Neville ihn im Oktober wieder freilassen. Ein weiterer Aufstandsversuch im kommenden Frühjahr schlug fehl. Richard Neville und George Plantagenet mussten erneut nach Calais fliehen.
In dieser Situation scheint Neville von seinem Vorhaben, George zum neuen König zu machen, umgeschwenkt zu sein und unterstützte von nun an unmittelbar das Haus Lancaster mit dem immer noch lebenden Heinrich VI. Im Juli 1470 trafen Richard Neville und Margarete von Anjou zusammen, um die zukünftige Wiedereinsetzung Heinrichs zu beschließen. Darüber hinaus sagte Ludwig XI. finanzielle und militärische Unterstützung für das Vorhaben zu. Angesichts dieser Übermacht gingen Eduard IV. und sein Bruder Richard, der Herzog von Gloucester und spätere englische König Richard III., im Oktober 1470 nach Alkmaar in Holland ins Exil.
Das Haus Lancaster schien die Rosenkriege für sich entschieden zu haben. Richard Neville und Georg Plantagenet zogen am 6. Oktober prunkvoll in London ein. Am 13. Oktober wurde Heinrich VI. erneut als König eingesetzt. Das Parlament erklärte Eduard IV. für abgesetzt. Dieser begann im burgundischen Exil allerdings bereits mit dem Sammeln von Truppen. Zudem hatte ihm Elizabeth Woodville nach drei Töchtern endlich einen Sohn und Thronfolger geboren. Sein Schwager Herzog Karl der Kühne von Burgund sagte ihm im Januar 1471 Geld und Truppen zu. Der Königsmacher Richard Neville hatte derweil unter der Londoner Stadtbevölkerung, die Eduard unterstützte, auch die letzten Sympathien verloren. Heinrichs VI. Schwachsinnigkeit trat bei seinen wenigen offiziellen Auftritten deutlich zu Tage, Clarence zeigte sich politisch vollkommen uninteressiert und Margarete befand sich in Frankreich. Am 14. März 1471 landeten Eduard IV. und sein Bruder Richard bei Ravenspur und marschierten in Richtung London. Kurz darauf traf Clarence sich mit seinen Brüdern, erhielt von Eduard die Vergebung und schloss sich wieder dem Haus York an.
Das folgende Osterfest sollte blutig werden. Richard Neville fiel im April 1471 in der Schlacht von Barnet, das entscheidende Gefecht zwischen den Truppen Yorks und Lancasters sollte aber am 4. Mai bei Tewkesbury stattfinden. Nicht zuletzt aufgrund der militärischen Unerfahrenheit Eduards, des Sohns Heinrichs VI., der gemeinsam mit seiner Mutter und einem französischen Heer nach England gekommen war, wurde die Schlacht von Tewkesbury zu einer vernichtenden Niederlage für Lancaster. Der Prinz selbst wurde auf der Flucht erschlagen, möglicherweise von Clarence, wichtige lancastrische Anführer nach einem Schauprozess hingerichtet. Margarete geriet in die Gefangenschaft Eduards IV. Noch in der Nacht, nachdem der Sieger in London einzog, wurde Heinrich VI. im Tower ermordet. Mit ihm erlosch die Linie der Lancasters.
Eduard IV. war Souverän des Hosenbandordens und zur Festigung seiner Allianz mit seinem Schwager Herzog Karl der Kühne von Burgund wurde er 1468 in den Orden vom Goldenen Vlies gewählt und 1470 aufgenommen.
Die letzten Regierungsjahre
Fast sofort begannen neue Auseinandersetzungen, diesmal zwischen den beiden jüngeren Brüdern Eduards, Georg von Clarence und Richard von Gloucester. Georg hatte als Ehemann Isabella Nevilles den Anspruch auf die Hälfte der umfangreichen Nevillschen Besitzungen, die von der Krone eingezogen worden waren. Durch den Tod seines Schwagers Edward of Westminster, der mit der jüngeren Neville-Tochter Anne verheiratet gewesen war, beanspruchte er das komplette Erbe. Hier setzte allerdings der neunzehnjährige Richard an, der Anne heiraten wollte. Georg konnte Richards Ansprüche vorerst nicht ganz unterdrücken, machte aber seine Zustimmung zur Hochzeit im Februar 1472 von der massiven Zuteilung politischer Ämter und Neville-Ländereien durch Eduard IV. abhängig. Richard durfte schließlich Anne heiraten, wurde aber mit kleineren Ländereien und Ämtern in Nordengland vergleichsweise bescheiden bedacht. Dort gelang es ihm aber in den Folgejahren, eine stabile Machtbasis aufzubauen, vor allem in der vormals lancastrischen Stadt York.
Georg sank derweil immer weiter in der Gunst seines Bruders Eduard IV. Nach dem Tod seiner Frau Isabella 1476 versuchte er, eine Hochzeit mit Maria, der Erbin Burgunds, zu arrangieren, was Eduard ihm aber verbot. Als er kurz darauf in mehreren Prozessen unzulässig Druck auf die Gerichte ausübte, leitete Eduard einen Hochverratsprozess gegen seinen Bruder ein. Am 18. Februar 1478 wurde der Tod Georgs bekanntgegeben. Der Sage nach durfte er, als letzte Gnade seines Bruders, seine Todesart aussuchen: George Plantagenet, der Herzog von Clarence, wurde in einem Fass Malmsey-Wein ersäuft.
Nach dem Wiedererlangen seiner Herrschaft wurde Eduard IV. schnell auch außenpolitisch wieder aktiv. Verbündet mit dem Herzog von Burgund ging er gegen Frankreich vor und landete 1475 bei Calais, schloss aber schnell mit Ludwig XI. Frieden und lieferte Margarete von Anjou gegen umfangreiche Lösegeldzahlungen an ihn aus.
Im Innern stützte Eduard IV. sich auf Ritterschaft und Städte und schritt energisch gegen die geistlichen und weltlichen Lords ein. Eine kluge Finanzwirtschaft und strenge Eintreibung der Steuern und Zölle machten ihn zu einem der reichsten Fürsten seiner Zeit; durch Verträge mit der Hanse (Frieden von Utrecht (1474)) und den Niederländern suchte er Sicherheit der Schifffahrt herzustellen.
Am 9. April 1483 starb Eduard überraschend nach nur einwöchiger Krankheit. Das Königreich hinterließ er seinem ältesten Sohn Eduard, zum Verweser bestimmte er Richard von Gloucester, der sich kurz darauf selbst als Richard III. zum König machte.
Nachkommen
Er hatte aus seiner Ehe mit Elisabeth sieben Töchter und drei Söhne:
- Elizabeth of York (1466–1503) ∞ Heinrich VII. von England
- Mary (1467–1482)
- Cecily (20. März 1469–24. August 1507)
- ∞ John III. von Welles,
- ∞ Thomas Kyme
- Eduard V. (1470–1483), König von England
- Margaret (10. April 1472–11. Dezember 1472)
- Richard (1473–1483), Herzog von York und Norfolk oo Anne Mowbray
- Anne (2. November 1475–23. November 1510) ∞ Thomas Howard, 3. Herzog von Norfolk
- George (1477–März 1479), Herzog von Windsor
- Catherine (14. August 1479–15. November 1527) ∞ Wilhelm von Devon
- Bridget (10. November 1480–1517)
Uneheliche Kinder: Mit Lady Eleanor Talbot
- Edward de Wigmore († 1468) Wahrscheinlich im Kindesalter verstorben.
Mit Elizabeth Lucy oder Elizabeth Waite
- Elizabeth Plantagenet. (* ca. 1464) ∞ Sir Thomas Lumley 1477.
- Arthur Plantagenet, 1st Viscount Lisle (* 1460/1470–3. März 1542)
Mit Lucy oder Waite
- Grace Plantagenet
- Mary Plantagenet ∞ Henry Harman
Literatur
- Sachbücher
- Gila Falkus: The life and times of Edward IV. Weidenfeld & Nicolson, London 1981, ISBN 0-297-78009-3.
- Michael Hicks: Edward IV. Arnold Books, London 2004, ISBN 0-340-76006-0.
- Charles D. Ross: Edward IV. (Yale english monarchs series). New Haven, Conn. 1998, ISBN 0-300-07371-2.
- Raphael de Smedt (Hrsg.): Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. (Kieler Werkstücke, D 3) 2., verbesserte Auflage, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2000, ISBN 3-631-36017-7, S. 153f.
- Belletristik
- Posie Graeme-Evans: Der Eid der Heilerin. Roman ("The innocent"): Goldmann, München 2008, ISBN 978-3-442-46886-7.
- Posie Graeme-Evans: Die Heilerin von Brügge. Roman ("The exiled"). Goldmann, München 2008, ISBN 978-3-442-46676-4.
- Posie Graeme-Evans: Der Triumph der Heilerin. Roman ("The uncrowned queen"). Goldmann, München 2007, ISBN 978-3-442-46407-4.
- Rosemary H. Jarman: Die Rache der Königin. Roman ("The king's grey mare"). Molden-Verlag, München 1979, ISBN 3-217-05129-7.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Lord Mayor of London
Der Lord Mayor of London ist der Bürgermeister der City of London und der Vorsitzende der Corporation of London. Der vollständige Titel lautet „The Right Honourable The Lord Mayor of London“. Sein Amt ist nicht mit dem des Mayor of London zu verwechseln, der für das größere Gebiet von Greater London zuständig ist, während der Amtsbereich des Lord Mayor sich nur auf die City erstreckt. In der City ist der Lord Mayor der höchste Würdenträger, nur der Monarch steht über ihm.
Der Lord Mayor wird jedes Jahr neu gewählt, und zwar Ende September oder Anfang Oktober. Einen Tag nach der Amtsübernahme wird die Parade Lord Mayor’s Show durchgeführt (siehe unten), wobei der Lord Mayor in die City of Westminster reist, um im Beisein der obersten Richter dem Monarchen Treue zu schwören. Das Amt des Lord Mayors ist vor allem zeremonieller Natur. Der derzeitige (Amtsjahr 2009/10) Lord Mayor ist Nick Anstee. [1]
Titel und Ehren
In Großbritannien gibt es 66 Städte; 30 davon werden von einem Lord Mayor angeführt (in Schottland von einem Lord Provost). Der Lord Mayor of London trägt als Mitglied des Privy Council den Ehrentitel „The Right Honourable“. Dieses Recht steht sonst nur den Lord Mayors von Bristol, York, Cardiff und Belfast zu, außerdem den Lord Provosts von Edinburgh und Glasgow.
Ist eine Frau der Lord Mayor, so trägt sie ebenfalls diesen Titel. Die Ehefrau eines Lord Mayors wird als „Lady Mayoress“ bezeichnet, für den Ehemann eines weiblichen Lord Mayors gibt es keinen entsprechenden Titel. Der Lord Mayor wird mit „My Lord Mayor“ angesprochen, seine Frau als „My Lady Mayoress“.
Seit dem 16. Jahrhundert war es Brauch, dass die Lord Mayors bei Amtsantritt zu Rittern geschlagen wurden und bei ihrem Rücktritt den Titel eines Baronets erhielten. Dieser Automatismus kommt heute allerdings nicht mehr zur Anwendung. Die Verleihung des Adelstitels wurde 1964 abgeschafft. Seit 1993 werden die Lord Mayors auch nicht mehr zu Rittern geschlagen. Es kommt allerdings manchmal vor, dass ihnen von ausländischen Staatsoberhäuptern Ehrentitel und Orden verliehen werden.
Geschichte
Das Amt des Lord Mayors wurde 1189 geschaffen, die Bezeichnung dazu wird aber erst seit 1414 verwendet. Seit 1215 werden die Lord Mayors nicht mehr vom Monarchen ernannt, sondern werden durch Vertreter der City of London gewählt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr; es ist nicht üblich, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.
Fast 700 Personen dienten bereits als Lord Mayor of London. Dame Mary Donaldson wurde 1983 als bisher einzige Frau gewählt. Nur zwei Lord Mayors wurden viermal und nur zwei wurden dreimal gewählt. Diese Ausnahmefälle geschahen jedoch bereits im 14. bzw. im frühen 15. Jahrhundert. Der letzte Lord Mayor, der für zwei Amtsperioden gewählt wurde, war Robert Fowler in den Jahren 1883 und 1885.
Die Wahl
Der Lord Mayor wird durch die Common Hall gewählt, einer Versammlung von Vertretern der Livery Companies, der Zünfte der Stadt. Die Versammlung wird durch den amtierenden Lord Mayor einberufen und findet am 29. September in der Guildhall statt. Fällt dieser Tag auf das Wochenende, so findet die Versammlung am nächsten Werktag statt. Die Wahl erfolgt durch Handerheben. Falls ein Mitglied der Wahlbehörde eine geheime Wahl wünscht, so findet diese zwei Wochen später statt.
Seit 1385 muss ein Lord Mayor vorher als Sheriff gedient haben, seit 1435 muss er aus den Reihen der Ratsherren (Aldermen) gewählt werden. In 25 Wahlkreisen wird je ein Alderman gewählt, der dieses Amt auf Lebzeiten (oder bis zu seinem Rücktritt) ausübt. Es ist jedoch üblich, dass sich die Aldermen alle sechs Jahre zur Wiederwahl stellen. Ein neu gewählter Lord Mayor muss sein Amt als Alderman nicht ablegen.
Der Lord Mayor wird im November vereidigt. Diese Zeremonie wird silent ceremony (stille Zeremonie) genannt, weil außer einer kurzen Erklärung des neu Gewählten keine Reden gehalten werden. In der Guildhall übergibt der scheidende Lord Mayor seinem Nachfolger die Amtsinsignien; ein Siegel, eine Brieftasche, ein Schwert (Sword of State) und eine zeremonielle Keule.
Lord Mayor’s Show
Einen Tag nach der Vereidigung nimmt der Lord Mayor an einer Parade namens Lord Mayor’s Show teil. Diese führt von der City zu den Royal Courts of Justice in Westminster, wo der Lord Mayor im Beisein der höchsten Richter dem Monarchen Treue schwört.
Bis zur Einführung des Gregorianischen Kalenders in Großbritannien (1751) fand die Parade am 28. Oktober statt, danach am 9. November. Seit 1959 findet die Lord Mayor’s Show jeweils am zweiten Samstag im November statt.
Früher war die Route von Jahr zu Jahr unterschiedlich, weil der Umzug jeweils durch den Wahlkreis des neuen Lord Mayors führte. Seit 1952 ist die Route jedoch unverändert geblieben. Einst reiste der Lord Mayor hoch zu Ross nach Westminster oder fuhr mit dem Boot auf der Themse, je nach gewählter Route. Nachdem Sir Gilbert Heathcote im Jahre 1710 von einem betrunkenen Blumenmädchen vom Pferd gerissen wurde, benutzt der Lord Mayor seitdem eine Staatskutsche. Boote werden seit 1856 nicht mehr verwendet. Die heute verwendete, kunstvoll verzierte und vergoldete Staatskutsche wurde 1757 gebaut und kostete damals 1065 Pfund und 3 Pence, nach heutigem Wert etwa 120.000 Pfund oder 180.000 Euro.
Die zwölf größten Livery Companies nehmen jedes Mal an der Parade teil. Dazu zählen die Zünfte der Samt- und Seidenhändler, der Lebensmittelhändler, der Stoffhändler, der Fischhändler, der Goldschmiede, der Schneider, der Pelzhändler, der Kleiderhändler, der Salzhändler, der Eisenwarenhändler, der Weinhändler und der Stoffverarbeiter. Die kleineren Zünfte müssen auf eine Einladung hoffen. Außerdem marschieren Blaskapellen und Vertreter der Armee mit.
Die Parade beginnt an der Guildhall. Der Lord Mayor reiht sich beim Mansion House, der offiziellen Residenz, am Ende des Umzugs ein. Unterwegs hält der Lord Mayor an der Saint Paul’s Cathedral, um den Segen des Dekans zu erhalten. In den Royal Courts of Justice legt er einen Treueschwur ab. Nach der Rückkehr zum Mansion House wird er von Vertretern der Corporation of London empfangen. Die Parade beginnt um elf Uhr vormittags und dauert rund 2½ Stunden. Abends gibt es ein Feuerwerk zu bestaunen.
Aufgaben
Die Aufgaben des Lord Mayor sind hauptsächlich zeremonieller und weniger politischer Natur. Er empfängt und beherbergt ausländische Würdenträger. Um für den britischen Finanzsektor zu werben, bereist er das Ausland; normalerweise jene Länder, die gerade den EU-Vorsitz führen. Mehrmals im Jahr veranstaltet der Lord Mayor in seiner Residenz Bankette, an denen wichtige Regierungsmitglieder vielbeachtete Reden (sogenannte Mansion House Reden) halten, darunter der Premierminister, der Finanzminister und der Außenminister.
Der Lord Mayor übt auch zahlreiche andere Funktionen aus. Er ist der oberste Magistrat der City of London, Admiral des Londoner Hafens, Kanzler der City University, Oberbefehlshaber der Kadetten und Reservetruppen der City sowie Treuhänder der Saint Paul's Cathedral.
Rechte und Privilegien
Die Residenz des Lord Mayors ist das Mansion House. Der Bau wurde nach dem Großen Brand von London im Jahre 1666 beschlossen, begann aber erst 1739. Sir Crispin Gascoigne war 1752 der erste Bewohner.
Es wird fälschlicherweise oft angenommen, dass der Lord Mayor dem Monarchen den Zutritt zur Stadt verwehren kann. Diese Annahme basiert auf einem falschen Verständnis der Zeremonie, die bei einem Besuch des Monarchen stattfindet. An der Temple Bar präsentiert der Lord Mayor dem Monarchen das perlenbesetzte Sword of State (Staatsschwert) als Zeichen der Treue. Der Monarch wartet also nicht etwa auf die Erlaubnis, die City betreten zu dürfen.
Die Bedeutung des Amtes zeigt sich in der Zusammensetzung des Accession Councils. Diese Versammlung proklamiert die Thronbesteigung des Monarchen. Dem Accession Council gehören der Lord Mayor und die Aldermen der City, hohe anglikanische Geistliche, Mitglieder des Oberhauses und die Privy Counsellors (Kronräte) an. Bei den Krönungsbanketten, die bis 1821 durchgeführt wurden, hatte der Lord Mayor von London zusammen mit seinem Amtskollegen aus Oxford das Recht dem königlichen Butler zu assistieren. Der Lord Mayor von Winchester assistierte dem königlichen Koch.
Der Lord Mayor ist dazu berechtigt, das Collar of SS zu tragen. Dies ist eine Kette aus 28 goldenen, s-förmigen Gliedern (der genaue Grund dafür ist unbekannt). Man nimmt an, dass die Kette einst Sir Thomas More gehörte und ihm vor seiner Exekution im Jahre 1535 abgenommen wurde.
Einzelnachweise
- ↑ Current Lord Mayor auf http://www.xxx
xxx – Entsprechend unserer Statuten werden uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführende Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechende Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
 |
 |
|
Der obige Ergänzungsartikel wurde aus der Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend der geltenden GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version finden Sie auf den Seiten der Wikipedia. Eine Liste der Autoren finden Sie auf der entsprechenden Wikipediaseite unter dem Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehende Informationen und Hinweise finden Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung der u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wurden.
|
|